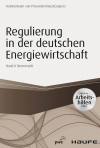Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft
Band II Strommarkt
Schlagworte
- I–L Titelei/Inhaltsverzeichnis I–L
- 1–14 1 Einführung 1–14
- 1.1 Energiewende und Strommarktdesign
- 1.2 Kernfragen des Strommarktdesigns
- 1.3 Der Strommarkt 2.0
- 1.4 Energiewende als Chance für Unternehmen
- 1.5 Anpassung der Unternehmensstrategien
- 15–84 2 Grundlagen des Strommarkts 15–84
- 2.1 Technisch-wirtschaftliche Grundlagen der Stromwirtschaft
- 2.1.1 Stromerzeugung
- 2.1.1.1 Konventionelle Stromerzeugung
- 2.1.1.2 Erneuerbare Stromerzeugung
- 2.1.1.3 Einteilung von Kraftwerkstypen nach ihrem Verwendungszweck
- 2.1.2 Stromübertragung und -verteilung
- 2.1.3 Stromimport und -export
- 2.1.4 Stromverbrauch
- 2.2 Kostenstrukturen und Preise
- 2.2.1 Kosten der Stromerzeugung
- 2.2.1.1 Kapitalkosten
- 2.2.1.2 Betriebskosten
- 2.2.1.3 Brennstoffkosten
- 2.2.1.4 Kosten für CO2-Emissionen
- 2.2.2 Kosten der Stromübertragung und -verteilung
- 2.2.2.1 Netzentgelte
- 2.2.2.2 Einflussfaktoren auf die Netzentgelte
- 2.2.3 Strompreis einschließlich Umlagen und Steuern
- 2.2.3.1 Welche Umlagen und Steuern werden erhoben?
- 2.2.3.2 Struktur der Preisbestandteile und Einflussgrößen
- 2.3 Preisbildung auf dem deutschen Strommarkt
- 2.3.1 Die unterschiedlichen Preisbildungsmechanismen
- 2.3.1.1 Over The Counter (OTC-Handel)
- 2.3.1.2 Börsenhandel
- 2.3.1.3 Preisbildung an der Börse
- 2.3.3 Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
- 2.4 Preisaufsicht
- 2.4.1 Kartellrechtliche Preisaufsicht
- 2.4.2 Markttransparenz durch das neue Strommarktgesetz
- 2.4.3 Weitere Möglichkeiten der Marktpreisaufsicht
- 2.4.3.1 ACER
- 2.4.3.2 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
- 2.4.3.3 Handelsüberwachungsstelle der
- 2.5 Bedeutung der deutschen Stromwirtschaft für Deutschland und Nachbarn
- 2.5.1 Vorgehen und verwendete Daten für die Analyse
- 2.5.2 Verflechtung der deutschen Stromwirtschaft mit weiteren Wirtschaftssektoren im Inund Ausland
- 2.5.3 Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte der deutschen Stromwirtschaft
- 2.5.3.1 Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt
- 2.5.3.2 Beschäftigung
- 2.5.3.3 Treibhausgas
- 2.5.4 Volkswirtschaftliche Einschätzung der Energiewende
- 85–202 3 Der Strommarkt für die Energiewende 85–202
- 3.1 Politische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingungen
- 3.1.1 Energiepolitik in der EU und in Deutschland
- 3.1.2 EU-Vorgaben und Umsetzung in deutsches Regelwerk
- 3.1.2.1 Binnenmarktrichtlinien
- 3.1.2.2 Umweltund klimapolitische Richtlinien
- 3.1.2.3 Digitalisierung des Messwesens
- 3.1.2.4 Beihilfenrechtlicher Rahmen
- 3.1.3 Oberziele in Deutschland
- 3.1.3.1 Umweltverträglichkeit
- 3.1.3.2 Wirtschaftlichkeit
- 3.1.3.3 Versorgungssicherheit
- 3.2 Emissionshandel
- 3.2.1 Logik des Emissionshandels
- 3.2.2 Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels
- 3.2.3 Der Emissionshandel in der Kritik
- 3.3 Marktintegration erneuerbarer Energien
- 3.3.1 Heranführung an den Markt
- 3.3.1.1 Die Entwicklung bis zum EEG 2014
- 3.3.1.2 Das EEG 2017
- 3.3.1.3 Ausdehnung des Ausschreibungsmodells
- 3.3.1.4 Prozessund Systemaspekte des EEG 2017
- 3.3.1.5 Exkurs: Dezentrale Erzeugungskonzepte
- 3.3.2 Bilanzkreistreue
- 3.4 Anreize für Neuinvestitionen in Erzeugungskapazität
- 3.4.1 Reicht der Energy-only-Markt aus?
- 3.4.2 Arten von Kapazitätsmechanismen
- 3.4.3 Investitionsanreize durch konsistente Preissignale
- 3.5 Kraftwerksmix für die Energiewende
- 3.5.1 Veränderung des Kraftwerksparks
- 3.5.2 Ausstieg aus der Kernenergieerzeugung
- 3.5.2.1 Änderungen des Atomgesetzes
- 3.5.2.2 Verfahren bei Stilllegung, Rückbau und Endlagerung
- 3.5.2.3 Finanzierung des Kernenergieausstiegs
- 3.5.2.4 Klageverfahren
- 3.5.3 Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Kohle?
- 3.5.3.1 Stand der Diskussion
- 3.5.3.2 Sicherheitsbereitschaft für Braunkohle
- 3.5.3.3 Effekte des Kohleausstiegs auf die CO2-Emissionen
- 3.5.4 Gaskraftwerke
- 3.5.4.1 Aktuelle Rolle der mit Erdgas befeuerten Kraftwerke
- 3.5.4.2 Wirtschaftliche Situation der Gaskraftwerke
- 3.6 Versorgungssicherheit
- 3.6.1 Europäischer Regelungsrahmen (Strom und Gas)
- 3.6.2 Nationaler Regelungsrahmen
- 3.6.3 Vorgaben zur Abschaltkaskade
- 3.6.4 Regelenergie
- 3.6.5
- 3.6.6 Netzreserve
- 3.6.7 Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft
- 3.7 Vernetzungen in Europa
- 3.7.1 Bedeutung der Grenzkuppelkapazitäten
- 3.7.2 Status Quo: Verbundnetz Strom
- 3.7.3 Öffnung der Märkte für Regelenergie
- 3.7.4 Auftrennung der DE-AT Strompreiszone
- 203–278 4 Technologien zur Umsetzung der Energiewende 203–278
- 4.1 Smart Grid und intelligente Messsysteme
- 4.1.1 Smart Grid in der Energiewende
- 4.1.2 Anforderungen an ein
- 4.1.3 Smart Meter Gateway und Administration
- 4.1.4 Typische Betriebsund Geschäftsprozesse
- 4.1.5 IT-Architektur und Technologiestack von der Zentrale bis zum Zählerschrank
- 4.1.6 Flexibilität im Energiesystem aus Netzsicht
- 4.1.7 Flexibilität im Energiesystem aus Vertriebssicht
- 4.1.8 Rolle von Speichern, Demand Side Management undvirtuellen Kraftwerken für das Smart Grid
- 4.1.9 Smart Meter Rollout und Bedeutung für das deutscheEnergiesystem
- 4.1.9.1 Das Messstellenbetriebsgesetz
- 4.1.9.2 Moderne Messeinrichtung
- 4.1.9.3 Intelligente Messsysteme
- 4.2 Virtuelle Kraftwerke
- 4.2.1 Begriffsdefinition
- 4.2.2 Virtuelle Kraftwerke im Smart Market und im SmartGrid: Nutzen und Einsatzfelder
- 4.2.3 Technologien und Komponenten virtueller Kraftwerke
- 4.2.4 Virtuelle Kraftwerke: Eine Integrationsaufgabe in Echtzeit
- 4.3 Speicher
- 4.3.1 Überblick zu Stromspeichertechnologien
- 4.3.2 Marktüberblick Deutschland
- 4.3.3 Entwicklungen und Trends
- 4.3.4 Stromspeicher und EEG sowie Stromsteuer
- 4.4 Power-to-X
- 4.4.1 Power-to-Gas
- 4.4.1.1 Spartenübergreifende Systemlösung – Definition und Standortbestimmung
- 4.4.1.2 Produkte Wasserstoff (Technologie Elektrolyse) und Methan (Technologie Methanisierung)
- 4.4.1.3 Bedeutung als Stromspeicher und Systemdienstleister
- 4.4.1.4 Potenziale im Zusammenhang mit dem Erdgasnetz
- 4.4.1.5 Umsetzungsstand in Deutschland und entwicklungstechnische Tendenzen
- 4.4.1.6 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4.4.1.7 Kriterien für eine Standortwahl/erfolgskritische Faktoren
- 4.4.1.8 Bedeutung von Power-to-Gas für den Mobilitätssektor
- 4.4.2 Power-to-Heat
- 4.4.2.1 Sektorübergreifende Systemlösung – Definition und Standortbestimmung
- 4.4.2.2 Die Power-to-Heat-Technologie
- 4.4.2.3 Bedeutung als Systemdienstleister
- 4.4.2.4 Umsetzungsstand in Deutschland und entwicklungstechnische Tendenzen
- 4.4.2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4.4.2.6 Kriterien für eine Standortwahl/erfolgskritische Faktoren
- 4.5 Lastmanagement (Demand Side Management)
- 4.5.1 Flexibilisierung des Stromsystems
- 4.5.2 Demand Side Management
- 4.5.3 Lastmanagement zur Integration erneuerbarer Energien
- 4.5.4 Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten und sonstige Erlösmöglichkeiten
- 4.5.5 Arten von Lastmanagement
- 4.5.6 Entwicklungen im Bereich
- 4.5.7 Potenziale von Lastmanagement
- 4.5.8 Zukünftige Herausforderungen
- 279–318 5 Energieeffizienz und Sektorkopplung 279–318
- 5.1 Energieeffizienz
- 5.1.1 Politikziel Energieeffizienz
- 5.1.2 Energieaudits und Energiemanagementsysteme
- 5.1.2.1 Energieaudits nach DIN EN 16247-1
- 5.1.2.2 Energiemanagementsystem nach ISO 50001
- 5.1.3 Energieeffizienz-Netzwerke
- 5.1.3.1 Bedeutung
- 5.1.3.2 LEEN-Managementsystem
- 5.1.3.3 30 Pilot-Netzwerke
- 5.1.3.4 Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
- 5.1.3.5 Herausforderungen bei Energieeffizienz-Netzwerken
- 5.2 Wärme
- 5.2.1 Überblick
- 5.2.2 Rahmenbedingungen
- 5.2.3 Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende im Wärmemarkt
- 5.2.4 Weiterentwicklung rechtlicher Vorgaben im Wärmemarkt
- 5.2.4.1 Gebäudeenergiegesetz (RefE)
- 5.2.4.2 Mieterstromgesetz (RefE)
- 5.3 Alternative Antriebstechnologien und Lösungsansätze im Bereich Verkehr
- 5.3.1 Rahmenbedingungen für Mobilität und Verkehr in Deutschland
- 5.3.1.1 Wachsender Verkehr
- 5.3.1.2 Ansprüche an „grüne Städte“
- 5.3.1.3 Überschreitung von Schadstoff-Grenzwerten in Ballungszentren
- 5.3.1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 5.3.1.5 Klimapolitische Debatte
- 5.3.2 Alternative Antriebe als Bausteine eines künftigen Mobilitätssystems
- 5.3.2.1 Marktentwicklung und Herausforderungen
- 5.3.2.2 Elektroantrieb
- 5.3.2.3 Brennstoffzellentechnologie
- 5.3.2.4 Gasbetriebene Fahrzeuge
- 5.3.3 Spezifische Lösungsansätze für Städte und Kommunen
- 5.3.4 Ausblick und Chancen
- 319–364 6 Digitalisierung in der Energiewirtschaft 319–364
- 6.1 Veränderungen durch Digitalisierung
- 6.1.1 Digitalisierung als Megatrend
- 6.1.2 Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette
- 6.1.3 Chancen und Herausforderungen für Energieversorger
- 6.2 Data Analytics als prozessübergreifendeEntscheidungsgrundlage
- 6.2.1 Zusammenspiel der Marktteilnehmer und Auswirkungen auf die Datenund Prozessqualität
- 6.2.2 Datenbasierte Lösungsansätze
- 6.2.3 Wettbewerb und Kundenwert
- 6.3 Datensicherheit
- 6.3.1 Wachsendes Gefahrenpotenzial – auch für kritische Infrastrukturen
- 6.3.2 Die Zukunft des Internetprotokolls – Chancen und Risiken
- 6.3.3 Das
- 6.3.4 Gesetzliche und regulatorische Anforderungen zur digitalen Sicherheit
- 6.3.4.1 Kritische Infrastrukturen
- 6.3.4.2 IT-Sicherheitsgesetz
- 6.3.4.3 IT-Sicherheitskatalog der BNetzA
- 6.3.5 Einrichtung eines InformationssicherheitsManagementsystems (ISMS)
- 6.4 Blockchain-Anwendungen in derEnergiewirtschaft
- 6.4.1 Vertrauen ohne Mittelsmann
- 6.4.2 Anwendungsbeispiele in der Energiewirtschaft
- 6.4.3 Entwicklung, Chancen und Risiken
- 6.5 Wandel zu einem digitalen EVU
- 6.5.1 Fokus auf den Faktor Mensch
- 6.5.2 Neue Formen der Zusammenarbeit, Mitsprache und Arbeitsplatzgestaltung als wichtige Bestandteile
- 6.5.3 d.quarks – elementare Bausteine der digitalen Transformation
- 6.5.3.1 Agile Kollaboration
- 6.5.3.2 Partizipation
- 6.5.3.3 Arbeitsplatzgestaltung
- 6.5.4 Entwicklung einer digitalen Kultur
- 365–440 7 Geschäftsmodelle im Strommarkt der Energiewende 365–440
- 7.1 Herkömmliche Geschäftsmodelle unter Druck
- 7.2 Erzeuger
- 7.2.1 Erzeugungskonzepte von der dezentralen Einzelanlage über das Großkraftwerk bis zum Anlagencluster
- 7.2.2 EOM, Regelleistung, Direktvermarktung,Kapazitätsmarkt: Gibt es den optimalen Markt?
- 7.2.3 Chancen, Risiken und
- 7.2.4 Stärkenund Schwächenprofile der verschiedenen Arten von Erzeugungsanlagen
- 7.2.5 Anlagenzugriff: Die zukünftige Rolle des Anlagen-
- 7.2.6 Virtuelle Kraftwerke als Geschäftsmodell
- 7.2.6.1 Marktüberblick Deutschland und Einflüsse auf europäischer Ebene
- 7.2.6.2 Ausblick auf die nächsten fünf Jahre
- 7.2.7 Veränderungen im Geschäftsmodell von Großkraftwerken
- 7.3 Handel und Beschaffung einschließlich Bilanzkreisverantwortliche
- 7.3.1 Der Energiehandel als Geschäftsmodell
- 7.3.2 Optimierung und
- 7.3.2.1 Grundsätzliches Vorgehen
- 7.3.2.2 Intraday-/Day-Ahead-Handel und Regelenergie
- 7.3.2.3 Terminhandel
- 7.4 Netzbetreiber
- 7.4.1 Smart Grid Op
- 7.4.2 Bereitstellung von Prozessen und IT
- 7.4.3 Nutzung der Breitbandtechnologie
- 7.4.4 Aufbau einer E-Mobility-Struktur
- 7.5 Energiedienstleistungen
- 7.5.1 Geschäftsmodell Energiedienstleister
- 7.5.2 Von der Energieberatung zum Energiemanagement
- 7.5.3 Wachstumschancen – Welche Themen haben Zukunftspotenzial?
- 7.5.4 Kernkompetenzen für den Dienstleistungsmarkt
- 7.6 Vertrieb
- 7.6.1 Kundenbedürfnisse – Was erwartet der Kunde?
- 7.6.2 Kundensegmentierung
- 7.6.3 Der Einfluss der Digitalisierung
- 7.6.4 Der Wandel vom Commodity- zum Lösungsanbieter
- 7.6.4.1 Serviceangebote zur Erweiterung des Produktportfolio
- 7.6.4.2 Verknüpfung mit Produkten aus dem energiefernen Bereich
- 7.6.4.3 Whitelabel-Produkte anbieten und umsetzen
- 7.6.4.4 Vertriebsplattformen
- 7.6.5 Kernfähigkeiten zur Umsetzung der neuen Produktwelt
- 7.7 Verbraucher (Industrie, Gewerbe, Haushalt,
- 7.7.1 Stromkosten
- 7.7.2 EEG-Umlage
- 7.7.2.1 Eigenerzeugung, Eigenversorgung, Stromspeicher und Mieterstrommodelle i.S.d. EEG 2017
- 7.7.2.2 Besondere Ausgleichsregelung gem. §§ 63 ff. EEG 2017
- 7.7.3 KWKG-Umlage
- 7.8 Geschäftsmodelle im Messstellenbetrieb
- 7.8.1 Einführung in die Geschäftsmodelllandschaft des Messstellenbetriebs
- 7.8.2 Geschäftsmodell des grundzuständigen Messstellenbetreibers
- 7.8.3 Geschäftsmodell des wettbewerblichen Messstellenbetreibers
- 7.8.4 Geschäftsmodell des Smart Meter Gateway Administrators
- 441–480 8 Investoren und ihre Transaktionsentscheidungen 441–480
- 8.1 Transaktionsumfeld im Strommarkt
- 8.2 Investoren
- 8.2.1 Überregional-integrierte Energieversorger
- 8.2.2 Regionale Energieversorger und Kommunen
- 8.2.3 Finanzinvestoren
- 8.2.4 Bürgerbeteiligungen und Privatinvestoren
- 8.3 Transaktionsobjekte im Strommarkt
- 8.3.1 Konventionelle Stromerzeugung
- 8.3.2 Erneuerbare Energien
- 8.3.3 Exkurs: Auswirkungen der EEG-Novelle auf denOnshore-Windenergiemarkt aus Sicht der Kapitalgeber
- 8.3.3.1 Allgemein erwartete Konsequenzen für den deutschenOnshore-Windenergiemarkt
- 8.3.3.2 Investorenzuwachs schmälert die Renditen
- 8.3.3.3 Rolle der Banken
- 8.3.3.4 Nachfrage nach Onshore-Projekten
- 8.3.4 Dezentrale Stromerzeugung und virtuelle Kraftwerke
- 8.3.5 Energiedienstleistungen und digitale Kundenlösungen
- 8.3.6 Netze und
- 8.3.6 Netze und Smart Grids
- 8.4 Bewertung der Transaktionsobjekte
- 8.4.1 Bewertungsmethoden
- 8.4.2 Finanzielle Überschüsse und
- 8.4.3 Energiespezifische Besonderheiten bei der Planung der
- 8.4.4 Kapitalisierungszinssatz
- 8.4.5 Energiespezifische Besonderheiten bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes
- 8.4.6 Transaktionswerte
- 8.5 Fazit und Ausblick
- 481–486 9 Ausblick auf Strommarkt 2030 481–486
- 487–521 Stichwortverzeichnis 487–521
- 522–526 Abbildungsverzeichnis 522–526