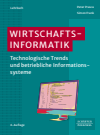Wirtschaftsinformatik
Technologische Trends und betriebliche Informationssysteme
Zusammenfassung
In den meisten Organisationen ist die IT inzwischen zum »Business Enabler« geworden. Mit deren Hilfe werden neue Geschäftsmodelle erst ermöglicht und ohne die digitale Transformation wären Organisationen nicht mehr wettbewerbsfähig. IT-Kräfte müssen sich daher nicht nur mit modernen Technologien und Trends vertraut machen, sondern auch komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen.
Hierbei kann die Wirtschaftsinformatik als anwendungsorientierte Wissenschaft einen wertvollen Beitrag leisten. Sie ist an eben dieser Schnittstelle zwischen IT und Betriebswirtschaftslehre verortet. Einer ihrer Schwerpunkte liegt auf der Analyse und Entwicklung betrieblicher Informationssysteme, die in der Wirtschaft und der Verwaltung eingesetzt werden.
Das Buch gibt eine Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Wie in den vorherigen Auflagen werden aktuelle technologische Trends in einen betriebswirtschaftlichen Kontext gestellt, um deren Nutzen für Unternehmen zu verdeutlichen. Neu mit Ausführungen u.a. zu Cloud-Computing, modernen Webtechnologien, Internet of Things, Blockchain und Kryptowährungen sowie zu Unternehmenssoftware der SAP.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–30 1 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 13–30
- 1.1 Womit beschäftigt sich die Wirtschaftsinformatik?
- 1.2 Was macht ein Wirtschaftsinformatiker im Unternehmen?
- 1.3 Grundbegriffe der Wirtschaftsinformatik
- 1.3.1 Zeichen, Daten, Information, Wissen
- 1.3.2 Daten- und Informationsverarbeitung
- 1.3.3 Informations- und Anwendungssysteme
- 1.3.4 Anwendungssoftware
- 1.4 Aufbau des Lehrbuchs
- 1.4.1 Prozessorientierung und Integration als Leitgedanken
- 1.4.2 Themenbereiche des Buches
- 31–94 2 Technologische Grundlagen und Trends 31–94
- 2.1 Modell der Technologieauswirkungen
- 2.2 Verarbeitung
- 2.2.1 Von Neumann-Architektur
- 2.2.1.1 Aufbau der von Neumann-Architektur
- 2.2.1.2 Arbeitsspeicher
- 2.2.1.3 Zentralprozessor
- 2.2.1.4 Datenwege
- 2.2.2 Systembetrieb
- 2.2.2.1 Betriebsarten und Nutzungsformen
- 2.2.2.2 Betriebssysteme
- 2.2.3 Programmierung
- 2.2.3.1 Übersetzungsprogramme
- 2.2.3.2 Maschinensprachen und Assembler
- 2.2.3.3 Prozedurale Sprachen
- 2.2.3.4 Deskriptive Sprachen
- 2.2.3.5 Wissensbasierte Sprachen
- 2.2.3.6 Objektorientierte Sprachen
- 2.2.3.7 Software-Plattformen
- 2.2.4 Benutzungsschnittstelle
- 2.3 Speicherung
- 2.3.1 Datenbanken
- 2.3.1.1 Datenorganisation
- 2.3.1.2 Datenbankarchitektur
- 2.3.1.3 Logische Datenorganisation
- 2.3.1.4 Physische Datenorganisation
- 2.3.2 Datenbankentwicklungen und -funktionen
- 2.4 Kommunikation und Netzwerke
- 2.4.1 Verbindungstechnik und Übertragungsformen
- 2.4.2 Protokolle als Voraussetzung für die Netzwerkkommunikation
- 2.4.2.1 ISO-OSI-Referenzmodell
- 2.4.2.2 TCP/IP-Protokoll
- 2.4.3 Netzwerke
- 2.4.3.1 Internetworking
- 2.4.3.2 Client-Server-Architekturen
- 2.5 Internet
- 2.5.1 Dienste im Internet
- 2.5.1.1 Basisdienste
- 2.5.1.2 World Wide Web
- 2.5.1.3 Web Services
- 2.5.1.4 Suchmaschinen
- 2.5.1.5 Mobiles Internet
- 2.5.2 Webtechnologien und Sprachen
- 2.5.3 Sicherheit im Internet
- 2.6 Technologische Trends
- 95–108 3 Organisatorische Trends 95–108
- 3.1 Unternehmen im Spannungsfeld zwischen IT und Wettbewerb
- 3.2 Der Zusammenhang zwischen Organisation und IT
- 3.2.1 Der Einfluss der Organisation auf die IT
- 3.2.2 Der Einfluss der IT auf die Organisation
- 3.2.3 Die gegenseitige Beeinflussung von Organisation und IT
- 3.3 Von der Funktional- zur Prozessorganisation
- 3.3.1 Grundlagen der Prozessorientierung
- 3.3.2 Prozessorientierte Organisationsgestaltung
- 3.4 Neue Ansätze zur organisatorischen Gestaltung
- 109–142 4 Methoden der Wirtschaftsinformatik 109–142
- 4.1 Modellierungsmethoden
- 4.1.1 Überblick
- 4.1.2 Geschäfts- und Wertschöpfungsmodellierung
- 4.1.3 Funktionsmodellierung
- 4.1.4 Datenmodellierung
- 4.1.5 Prozessorientierte Organisationsmodellierung
- 4.1.5.1 Prozessmodellierung mit ereignisorientierten Prozessketten
- 4.1.5.2 Verwendung von Referenzmodellen zur Prozessmodellierung
- 4.1.6 Business Process Modeling Notation
- 4.1.7 Objektorientierte Modellierung
- 4.2 Projektmanagement
- 4.2.1 Projektinitialisierung
- 4.2.2 Projektplanung
- 4.2.3 Durchführung
- 4.2.4 Qualitätssicherung
- 4.2.5 Dokumentation
- 4.2.6 Projektabschluss
- 143–172 5 Bereitstellung von Anwendungssystemen 143–172
- 5.1 Standardsoftware vs. Individualsoftware
- 5.1.1 Standardsoftware
- 5.1.2 Individualsoftware
- 5.2 Einführung von Standardsoftware
- 5.2.1 Auswahl von Standardsoftware
- 5.2.2 Einführungskonzepte für Standardsoftware
- 5.2.2.1 Sequenzielle Einführung einzelner Module
- 5.2.2.2 Prozessorientierte Einführung
- 5.3 Systementwicklung
- 5.3.1 Phasenkonzepte der Systementwicklung
- 5.3.1.1 Charakteristika der Phasenkonzepte
- 5.3.1.2 Vor- und Nachteile der Systemlebenszykluskonzepte
- 5.3.2 Prototyping
- 5.3.2.1 Charakteristika des Prototyping
- 5.3.2.2 Vorgehensweise des Prototyping
- 5.3.2.3 Vorteile und Nachteile des Prototypings
- 5.3.3 Spiralmodell
- 5.3.3.1 Charakteristika des Spiralmodells
- 5.3.3.2 Vorteile und Nachteile des Spiralmodells
- 5.3.4 Agile Vorgehensmodelle
- 5.3.4.1 Charakteristika agiler Methoden
- 5.3.4.2 Extreme Programming
- 5.3.4.3 Scrum
- 5.3.5 Software-Entwicklungswerkzeuge
- 173–200 6 Branchenneutrale Anwendungssysteme zur Unterstützung innerbetrieblicher Prozesse 173–200
- 6.1 Überblick: Von der Stand-alone-Lösung zu integrierten ERP-Systemen
- 6.2 Rechnungswesenprozesse
- 6.2.1 Finanzbuchhaltung
- 6.2.2 Betriebsbuchhaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnung
- 6.3 Personalprozesse
- 6.3.1 Administrative Teilprozesse
- 6.3.2 Dispositive Teilprozesse
- 6.4 Vertriebsprozesse
- 6.4.1 Administrative Teilprozesse
- 6.4.2 Dispositive Teilprozesse
- 6.5 Informationsbedarfsdeckungsprozesse
- 6.5.1 Interne Informationsbedarfsdeckungsprozesse
- 6.5.2 Externe Informationsbedarfsdeckungsprozesse
- 6.5.3 Planungs-/Entscheidungsprozesse
- 201–218 7 Anwendungssysteme zur Unterstützung innerbetrieblicher Prozesse in der Fertigungsindustrie und im Handel 201–218
- 7.1 Fertigungsindustrie
- 7.1.1 Betriebswirtschaftlich orientierte Prozessketten
- 7.1.1.1 Begriff und Ziele von Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen
- 7.1.1.2 Teilschritte des Sukzessivplanungskonzepts
- 7.1.2 Technisch-orientierte Prozessketten
- 7.1.3 Computer-Integrated Manufacturing
- 7.2 Handel: Warenwirtschaftssysteme
- 7.2.1 Begriff und Ziele von Warenwirtschaftssystemen
- 7.2.2 Teilprozesse in Warenwirtschaftssystemen
- 219–250 8 Unternehmensübergreifende Anwendungssysteme 219–250
- 8.1 Überblick: E-Business und E-Commerce
- 8.2 E-Procurement (elektronische Beschaffung)
- 8.2.1 Von der papierbasierten zur internetgestützten Beschaffung
- 8.2.2 Betrieb des E-Procurement-Systems
- 8.3 Elektronische Marktplätze
- 8.3.1 Typisierung elektronischer Marktplätze
- 8.3.2 Handelsmechanismen und Servicekomponenten
- 8.3.3 Vor- und Nachteile der Marktplatzteilnahme
- 8.4 Vertriebsprozesse im Internet
- 8.4.1 Phasen des Vertriebsprozesses
- 8.4.2 Geschäftsmodelle für Online-Shops
- 8.4.3 Aufbau von Online-Shops
- 8.5 ePayment
- 8.5.1 Prepaid-Verfahren
- 8.5.2 Pay-Now-Verfahren
- 8.5.3 Pay-Later-Verfahren
- 8.6 Customer Relationship Management
- 8.7 Supply Chain Management
- 8.8 E-Services
- 8.9 Mobile Business
- 251–278 9 Unterstützung der Gruppenarbeit 251–278
- 9.1 Überblick: Computerunterstützte Gruppenarbeit
- 9.2 Workgroup-Computing
- 9.2.1 Einsatzfelder für Workgroup-Computing
- 9.2.2 Computerunterstützte Sitzungen
- 9.2.3 Information-Sharing
- 9.2.3.1 Bausteine
- 9.2.3.2 Information-Sharing im Intranet
- 9.2.4 Digitale Kollaboration
- 9.2.4.1 Bausteine
- 9.2.4.2 Anwendungsszenarios
- 9.2.5 Enterprise 2.0
- 9.3 Workflow-Computing
- 9.3.1 Einsatzfelder für Workflow-Computing
- 9.3.2 Architektur der WfMS
- 279–306 10 Informationsmanagement 279–306
- 10.1 Überblick
- 10.2 Aufgaben des Informationsmanagements
- 10.3 Unternehmensstrategie und Informationsmanagement
- 10.4 IT-Governance
- 10.5 Enterprise Architecture Management
- 10.6 Aufbauorganisatorische Gestaltung des Informationsmanagements
- 10.6.1 Aufbauorganisatorische Verankerung des Informationsmanagements
- 10.6.2 Alternativen der organisatorischen Gestaltung des Informationsmanagements
- 10.7 Ablauforganisatorische Gestaltung des Informationsmanagements
- 10.8 Sourcing
- 10.9 Inhalte und Ziele des IT-Controllings
- 10.10 Datensicherheit und Datenschutz
- 10.10.1 Datensicherheit
- 10.10.2 Datenschutz
- 307–308 Schlusswort 307–308
- 309–316 Stichwortverzeichnis 309–316