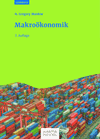Makroökonomik
Zusammenfassung
Der „Mankiw" ist nicht nur ein maßgebliches Standardwerk an deutschen Hochschulen. Übersetzt in zahlreiche Sprachen wird der Klassiker weltweit erfolgreich in Lehrveranstaltungen eingesetzt.
Der Autor diskutiert Themen wie Inflation, Arbeitslosigkeit und Wachstum und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Geld-, Fiskal- und Außenwirtschaftspolitik.
Die 7. Auflage wurde umfassend überarbeitet und berücksichtigt die Aktualisierungen der 8. und 9. US-Auflage. Die einzelnen Kapitel wurden didaktisch optimiert und neu geordnet. Eine zentrale Neuerung ist das Kapitel „Das Finanzsystem". Es präsentiert wesentliche makroökonomische Forschungsergebnisse der letzten Jahre.
Schlagworte
- I–XXXVI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXXVI
- 1–52 Teil I: Einführung 1–52
- 1–16 1 Makroökonomik als Wissenschaft 1–16
- 1.1 Womit sich die Makroökonomik beschäftigt
- 1.2 Ökonomische Denkweise
- 1.3 Das weitere Vorgehen
- Zusammenfassung
- 17–52 2 Empirische Beobachtungen und Makroökonomik 17–52
- 2.1 Die Erfassung des Wertes der ökonomischen Aktivitäten: Das Bruttoinlandsprodukt
- 2.2 Die Erfassung der Lebenshaltungskosten: Der Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte
- 2.3 Erfassung der Unterbeschäftigung: Die Arbeitslosenquote
- 2.4 Fazit: Von Wirtschaftsstatistiken zu Wirtschaftsmodellen
- Zusammenfassung
- 53–252 Teil II: Klassische Theorie – die Volkswirtschaft bei langfristiger Betrachtung 53–252
- 53–96 3 Das Bruttoinlandsprodukt: Entstehung, Verteilung und Verwendung 53–96
- 3.1 Wodurch wird die Gesamtproduktion von Waren und Dienstleistungen bestimmt?
- 3.2 Die Aufteilung des Nationaleinkommens auf die Produktionsfaktoren
- 3.3 Die Determinanten der Güternachfrage
- 3.4 Gleichgewicht und Zinssatz
- 3.5 Fazit
- Zusammenfassung
- 97–120 4 Das Geldsystem: Was es ist und wie es funktioniert 97–120
- 4.1 Was ist Geld?
- 4.2 Die Rolle der Banken im Geldsystem
- 4.3 Wie Zentralbanken das Geldangebot beeinflussen
- 4.4 Fazit
- Zusammenfassung
- 121–156 5 Inflation: Ursachen, Wirkungen und soziale Kosten 121–156
- 5.1 Die Quantitätstheorie des Geldes
- 5.2 Seigniorage: Der Ertrag aus dem Drucken von Geld
- 5.3 Inflation und Zinssätze
- 5.4 Der Nominalzinssatz und die Nachfrage nach Geld
- 5.5 Die sozialen Kosten der Inflation
- 5.6 Hyperinflation
- 5.7 Fazit: Die klassische Dichotomie
- Zusammenfassung
- 157–160 Anhang zu Das Cagan-Modell: Die Wirkungen des gegenwärtigen und des zukünftigen Geldangebots auf das Preisniveau 157–160
- 161–204 6 Die offene Volkswirtschaft 161–204
- 6.1 Die internationalen Kapital- und Güterströme
- 6.2 Sparen und Investitionen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft
- 6.3 Wechselkurse
- 6.4 Fazit
- Zusammenfassung
- 205–216 Anhang zu Die große offene Volkswirtschaft 205–216
- 217–252 7 Arbeitslosigkeit 217–252
- 7.1 Arbeitsmarktdynamik und natürliche Arbeitslosenquote
- 7.2 Arbeitsplatzsuche und friktionelle Arbeitslosigkeit
- 7.3 Reallohnstarrheit und strukturelle Arbeitslosigkeit
- 7.4 Arbeitsmarkterfahrungen: Die Vereinigten Staaten
- 7.5 Arbeitsmarkterfahrungen: Europa
- 7.6 Fazit
- Zusammenfassung
- 253–338 Teil III: Wachstumstheorie – die Volkswirtschaft bei sehr langfristiger Betrachtung 253–338
- 253–290 8 Wirtschaftswachstum I: Kapitalakkumulation und Bevölkerungswachstum 253–290
- 8.1 Kapitalakkumulation
- 8.2 Das Golden-Rule-Niveau des Kapitalstocks
- 8.3 Bevölkerungswachstum
- 8.4 Fazit
- Zusammenfassung
- 291–338 9 Wirtschaftswachstum II: Technologie, Empirie und Politik 291–338
- 9.1 Technologischer Fortschritt im Solow-Modell
- 9.2 Von der Theorie des Wachstums zur Empirie
- 9.3 Wachstumspolitik
- 9.4 Über das Solow-Modell hinaus: Endogene Wachstumstheorie
- 9.5 Fazit
- Zusammenfassung
- Anhang zu Zurechnung der Wachstumsursachen
- 339–528 Teil IV: Konjunkturtheorie – die Volkswirtschaft bei kurzfristiger Betrachtung 339–528
- 339–374 10 Einführung in das Problem gesamtwirtschaftlicher Schwankungen 339–374
- 10.1 Konjunkturzyklen aus empirischer Sicht
- 10.2 Die Bedeutung des Zeithorizonts in der Makroökonomik
- 10.3 Gesamtnachfrage
- 10.4 Gesamtangebot
- 10.5 Stabilisierungspolitik
- 10.6 Fazit
- Zusammenfassung
- 375–406 11 Gesamtwirtschaftliche Nachfrage I: Entwicklung des IS-LM-Modells 375–406
- 11.1 Der Gütermarkt und die IS-Kurve
- 11.2 Der Geldmarkt und die LM-Kurve
- 11.3 Fazit: Das kurzfristige Gleichgewicht
- Zusammenfassung
- 407–440 12 Gesamtwirtschaftliche Nachfrage II: Anwendung des IS-LM-Modells 407–440
- 12.1 Die Erklärung wirtschaftlicher Schwankungen im Rahmen des IS-LM-Modells
- 12.2 IS-LM als Theorie der Gesamtnachfrage
- 12.3 Die Weltwirtschaftskrise
- 12.4 Fazit
- Zusammenfassung
- 441–482 13 Noch einmal offene Volkswirtschaft: Das Mundell-Fleming-Modell und das Wechselkursregime 441–482
- 13.1 Das Mundell-Fleming-Modell
- 13.2 Die kleine offene Volkswirtschaft bei flexiblen Wechselkursen
- 13.3 Die kleine offene Volkswirtschaft bei festen Wechselkursen
- 13.4 Zinssatzdifferentiale
- 13.5 Feste oder flexible Wechselkurse
- 13.6 Von der kurzfristigen zur langfristigen Betrachtung: Das Mundell-Fleming-Modell bei Änderungen des Preisniveaus
- 13.7 Ein abschließender Hinweis
- Zusammenfassung
- 483–490 Anhang zu Ein kurzfristiges Modell der großen offenen Volkswirtschaft 483–490
- 491–522 14 Arbeitslosigkeit, Inflation und gesamtwirtschaftliches Angebot 491–522
- 14.1 Die grundlegende Theorie des Gesamtangebots
- 14.2 Inflation, Arbeitslosigkeit und die Phillips-Kurve
- 14.3 Fazit
- Zusammenfassung
- 523–528 Anhang zu Die Mutter aller Modelle 523–528
- 529–638 Teil V: Themen der makroökonomischen Theorie 529–638
- 529–570 15 Ein dynamisches Modell der Gesamtnachfrage und des Gesamtangebots 529–570
- 15.1 Elemente des Modells
- 15.2 Analyse des Modells
- 15.3 Verwendung des Modells
- 15.4 Zwei Anwendungen: Lektionen für die Geldpolitik
- 15.5 Fazit: Auf dem Weg zu DSGE-Modellen
- Zusammenfassung
- 571–608 16 Theorie des Konsumverhaltens 571–608
- 16.1 John Maynard Keynes und die Konsumfunktion
- 16.2 Irving Fisher und die intertemporale Entscheidung
- 16.3 Franco Modigliani und die Lebenszyklus-Hypothese
- 16.4 Milton Friedman und die Hypothese des permanenten Einkommens
- 16.5 Robert Hall und die Random-Walk-Hypothese
- 16.6 David Laibson und die Bedeutung unmittelbarer Belohnung
- 16.7 Fazit
- Zusammenfassung
- 609–638 17 Investitionen 609–638
- 17.1 Ausrüstungsinvestitionen
- 17.2 Wohnungsbauinvestitionen
- 17.3 Lagerinvestitionen
- 17.4 Fazit
- Zusammenfassung
- 639–724 Teil VI: Themen der makroökonomischen Wirtschaftspolitik 639–724
- 639–662 18 Alternative Konzeptionen der Stabilisierungspolitik 639–662
- 18.1 Aktive oder passive Wirtschaftspolitik?
- 18.2 Wirtschaftspolitik: Regelbindung oder Einzelfallentscheidung?
- 18.3 Fazit: Politik in einer unsicheren Welt
- Zusammenfassung
- 663–666 Anhang zu Zeitinkonsistenz und Tradeoff zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit 663–666
- 667–696 19 Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit 667–696
- 19.1 Die Höhe der Staatsverschuldung
- 19.2 Messprobleme
- 19.3 Die traditionelle Sicht der Staatsverschuldung
- 19.4 Die ricardianische Sicht der Staatsverschuldung
- 19.5 Alternative Konzeptionen der Staatsverschuldung
- 19.6 Fazit
- Zusammenfassung
- 697–724 20 Das Finanzsystem: Chancen und Gefahren 697–724
- 20.1 Wozu sind Finanzsysteme eigentlich da
- 20.2 Finanzkrisen
- 20.3 Fazit
- Zusammenfassung
- 725–734 Epilog: Was wir wissen – und was nicht 725–734
- Die vier wichtigsten Erkenntnisse der Makroökonomik
- Die vier wichtigsten ungeklärten Fragen der Makroökonomik
- Fazit
- 735–750 Glossar 735–750
- 751–756 Stichwortverzeichnis 751–756