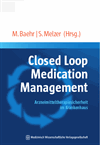Closed Loop Medication Management
Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus
Zusammenfassung
Obwohl die Arzneimitteltherapie zunehmend komplexer, risikoreicher und kostenintensiver wird, verharrt der Arzneimittelversorgungsprozess im Krankenhaus in überkommenen Strukturen und folgt traditionellen Prozessen. Entsprechend schlecht ist die Ergebnisqualität: Nach Infektionsgefahren stellen Medikationsfehler für Patienten im Krankenhaus das größte Risiko dar. Die Datenlage zu Patienten, die durch vermeidbare Medikationsfehler und horrende Folgekosten geschädigt wurden, ist erdrückend. Obwohl dies seit Jahren bekannt ist, geschieht bislang wenig. Doch die Situation wird sich in Kürze ändern müssen. Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität stehen auf der aktuellen politischen Agenda ganz oben und der Arzneimittelversorgungsprozess ist ein wichtiger Querschnittsprozess mit erheblichem Einfluss auf die Ergebnisqualität.
Der geschlossene Medikationsprozess (Closed Loop of Medication Administration) mit elektronischer Verschreibung, pharmazeutischer Validierung und Unit-Dose-Versorgung ist der Goldstandard zur Lösung prozessualer Probleme bei der Arzneimittelversorgung.
Das Buch vermittelt mit direktem Praxisbezug alles Wissenswerte zum Aufbau des Closed Loop Medication Managements. Neben der theoretischen Aufarbeitung von Schwächen und Risiken des traditionellen Versorgungsprozesses liegt der Schwerpunkt auf konkreten praktischen Gesichtspunkten der innovativen Arzneimittelversorgung. Im Fokus stehen die notwendige Infrastruktur, die Auswahl von Soft- und Hardware, das Changemanagement in Apotheke und Klinik sowie die Wirtschaftlichkeit.
Schlagworte
- C1–xii Titelei/Inhaltsverzeichnis C1–xii
- 1–22 Der Arzneimittelversorgungsprozess – Eine Bestandsaufnahme 1–22
- 1–13 1 Traditionelle Arzneimittelversorgung in der Klinik 1–13
- 1.1 Arzneimittelanamnese
- 1.2 Arzneimittelverordnung
- 1.3 Transkription
- 1.4 Bereitstellen der Medikation
- 1.5 Zubereiten parenteraler Medikamente
- 1.6 Applikation
- 1.7 Dokumentation
- 1.8 Wirtschaftliche Folgen von Medikationsfehlern
- 14–22 2 Bedeutung des Medikationsprozesses aus Sicht des Qualitäts- und klinischen Risikomanagements 14–22
- 2.1 AMTS im Rahmen von Zertifizierungsverfahren
- 2.2 AMTS im Rahmen von Meldesystemen des Qualitäts- und klinischen Risikomanagements
- 23–42 Gesetzliche Rahmenbedingungen 23–42
- 23–32 1 Qualität und Qualitätssicherung im SGB V 23–32
- 1.1 Bestimmung von Qualität durch G-BA und IQTIG
- 1.1.1 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
- 1.1.2 Das IQTIG
- 1.2 Fazit für die Arzneimittelversorgung
- 33–42 2 Das E-Health-Gesetz und dessen mögliche Auswirkungen auf die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) 33–42
- 2.1 Schwerpunkte des E-Health-Gesetzes
- 2.2 Arzneimitteldaten auf der eGK
- 2.3 Patientenbeteiligung durch den Medikationsplan
- 2.4 Medikationsplan im E-Health-Gesetz
- 2.5 Dreiseitige Vereinbarung
- 2.6 Patientenfach
- 2.7 Verwendung von Smartphones
- 2.8 Interoperabilität
- 2.9 Kommunikation
- 2.10 Ausblick
- 43–84 Lösungsansatz Closed Loop Medication Management 43–84
- 43–55 1 Elemente des CLMA 43–55
- 1.1 Verordnung
- 1.2 Validierung durch klinische Pharmazeuten
- 1.3 Pharmazeutische Unit-Dose-Logistik
- 1.4 Dokumentation der Applikation
- 1.5 Arzneimittelanamnese und Entlassmanagement
- 56–71 2 Closed Loop Medication – Eine internationale Sicht 56–71
- 2.1 Ursprünge und Stand – Europa vs. Vereinigte Staaten (U.S.)
- 2.2 Hindernisse und begünstigende Entwicklungen
- 2.3 Fallbeispiele für herausragende Umsetzung von CLMA in Europa
- 2.3.1 Antonius Ziekenhuis Sneek/Emmeloord, Niederlande
- 2.3.2 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate, Italien
- 2.3.3 Hospital de Dénia, Marina Salud S.A., Spanien
- 2.3.4 Izmir Tire Devlet Hastanesi, Türkei
- 2.3.5 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Deutschland
- 72–84 3 Unit-Dose-Versorgung in Deutschland 72–84
- 3.1 Warum wurde die Unit-Dose-Versorgung im Krankenhaus eingeführt?
- 3.2 Wo findet Unit-Dose-Versorgung statt?
- 3.3 Wie groß sind die Versorgungsstrukturen?
- 3.4 Welches Sortiment wird über Unit-Dose beliefert?
- 3.5 Wie findet die Endkontrolle der Blister statt?
- 3.6 Wie wird die Medikation erfasst und welche Software wird zur Anforderung genutzt?
- 3.7 Wie hoch ist der Personalaufwand in der Apotheke?
- 3.8 Unit-Dose aktuell
- 85–244 Closed Loop Medication Management und Unit-Dose-Versorgung – Praktiker beantworten Fragen 85–244
- 85–92 1 Strategie – Prozess – Baukörperentwicklung: Der Masterplan für das Bauen von Krankenhäusern und Krankenhausapotheken 85–92
- 1.1 Strategie
- 1.1.1 Unternehmensanalyse
- 1.1.2 Umfeldanalyse
- 1.1.3 Strategieentwicklung – Zielszenario
- 1.2 Betriebsorganisationsplanung
- 1.3 Baukörperentwicklung
- 93–103 2 Arzneimitteltherapiesicherheit 93–103
- 2.1 Wie erhöht der Prozess die AMTS?
- 2.1.1 Schnittstellenmanagement
- 2.1.2 Lesbarkeit, eindeutige Verordnung auf Produktebene – Koppelung an die Logistik
- 2.1.3 Informationen zu Arzneimitteln am Point of Care: Ärzte und Pflege
- 2.1.4 Automatische AMTS-Prüfung – Dosierung, Interaktionen, Kontraindikationen, etc.
- 2.1.5 Informationen zu Arzneimitteln am Patienten (keine „Verblindung“, Beipackzettel)
- 2.1.6 Einfacher Zugriff von allen am Medikationsprozess beteiligten Berufsgruppen
- 2.1.7 Dokumentation der Arzneimitteltherapie
- 2.2 Welchen Stellenwert haben klinische Apothekerim Closed Loop?
- 2.2.1 Klinisch-pharmazeutische Dienstleistungen in Deutschland
- 2.2.2 Aufgaben von Apothekern im Closed Loop
- 2.2.3 Was leisten Apotheker im Rahmen der Unit-Dose-Versorgung?
- 2.2.4 Wie hoch ist die Akzeptanz von pharmazeutischen Interventionen?
- 104–122 3 Automation 104–122
- 3.1 Dispensierautomaten
- 3.1.1 Schlauchblister-Automaten
- 3.1.2 Ringblister-Automaten
- 3.1.3 Kartenblister-Automaten
- 3.2 Entblistergeräte
- 3.3 Optische Kontrollsysteme
- 3.4 Welche Fragen müssen bei der Entscheidung für einen Automaten gestellt werden?
- 3.5 Zusammenfassung
- 123–129 4 Kreuzkontamination bei Schachtautomaten 123–129
- 4.1 Wie ist die Kreuzkontamination gesetzlich reglementiert?
- 4.2 Welche Reglementierungen gibt es vonseiten der Automatenhersteller?
- 4.3 Nach welchen Kriterien kann die Kreuzkontamination beurteilt werden?
- 4.4 Welchen Einfluss hat die Kreuzkontamination auf den Patienten?
- 4.5 Was sollte der Verwender von Schachtautomaten beachten?
- 130–144 5 Change Management 130–144
- 5.1 Veränderungen im Klinikalltag durch die Einführung des Closed Loop Prozesses
- 5.1.1 Was ändert sich aus der Sicht des Arztes?
- 5.1.2 Was ändert sich aus der Sicht des Apothekers?
- 5.1.3 Was ändert sich aus der Sicht des Pflegedienstes?
- 5.1.4 Werden Pflegekräfte durch die Unit-Dose-Versorgung eingespart?
- 5.1.5 Was ändert sich aus der Sicht des Patienten?
- 5.1.6 Wie wird aus der Einführung des Closed Loop ein erfolgreiches Projekt?
- 5.1.7 Wie begegnet man Emotionen im Change Management?
- 5.1.8 Besteht Klarheit über die Projektstruktur, Projektgruppenzusammensetzung und Projektleitung?
- 5.1.9 Ist der Lenkungsausschuss implementiert?
- 5.1.10 Ist der Projektablauf geklärt?
- 5.1.11 Ist der Standardprozessablauf definiert?
- 5.1.12 Wurde an die Beteiligung der Arbeitnehmervertretung gedacht?
- 5.1.13 Ist ein Datenschutzvermerk notwendig?
- 5.1.14 Wie sieht das Kommunikationskonzept aus?
- 5.1.15 Wie sieht das Schulungskonzept aus?
- 5.1.16 Sind die Details für den Transport geklärt?
- 5.1.17 Wie sieht die konkrete Anschlussplanung aus?
- 5.2 Was ist beim Change Management in der Apotheke zu beachten?
- 5.3 Welches sind die kritischen Erfolgsfaktoren?
- 145–148 6 Kundenorientierung 145–148
- 6.1 Was bedeutet der CLMA für den Pflegedienst?
- 6.2 Profitiert der Patient von der Versorgungsform?
- 6.3 Wie sehen Ärzte den CLMA?
- 149–156 7 Ökologische Nachhaltigkeit 149–156
- 7.1 Welcher Abfall fällt im traditionellen Arzneimittelversorgungsprozess an?
- 7.2 Welches Abfallaufkommen gibt es im patientenbezogenen Versorgungsprozess?
- 7.3 Wie sind Verpackungsmaterialien ökologisch zu bewerten?
- 7.4 Wie kommt Schüttware in den Handel?
- 7.5 Wie wird die Abfallmenge bei traditioneller und Unit-Dose-Versorgung berechnet?
- 157–168 8 Prozessmanagement 157–168
- 8.1 Wie sieht der Unit-Dose-Prozess aus?
- 8.2 Wie oft und für welchen Zeitraum werden die Unit-Dose-Medikamente geliefert?
- 8.3 Welche Arzneimittel können im Unit-Dose-System geliefert werden?
- 8.4 Wie wird mit oralen Arzneimitteln verfahren, die nicht maschinell verpackt werden können?
- 8.5 Welche Arzneimittel können über das „Picking“ geliefert werden?
- 8.6 Was passiert an Sonn- und Feiertagen?
- 8.7 Wie werden Intensivstationen versorgt?
- 8.8 Wie werden die Unit-Dose-Tüten auf Station angeliefert?
- 8.9 Was passiert auf der Station auf den letzten 50 Metern?
- 8.10 Wie sieht ein Ausfallplan für den logistischen Prozess aus?
- 169–175 9 Prozesssteuerung in der Apotheke 169–175
- 9.1 Welche Probleme stellen sich für die Prozesssteuerung?
- 9.2 Welche Prozesse müssen bedacht werden?
- 9.3 Welche Voraussetzungen müssen für die Prozesssteuerung erfüllt sein?
- 9.4 Wie verbessert man Prozesse?
- 9.4.1 Schulung
- 9.4.2 Kommunikation
- 9.4.3 Aufmerksamkeit
- 9.5 Welche Lösungsansätze zur Prozessoptimierung gibt es?
- 9.5.1 Stetige Reevaluation
- 9.5.2 Software
- 176–182 10 Wie ist ein Aufnahme- und Entlassmanagement zu organisieren? 176–182
- 10.1 Pharmazeutisches Aufnahmemanagement
- 10.1.1 Welche Ressourcen werden benötigt?
- 10.1.2 Wo und wann sollte man die pharmazeutische Arzneimittelanamnese etablieren?
- 10.1.3 Was ist hilfreich?
- 10.1.4 Wie kann man beginnen?
- 10.1.5 Wenn etwas nicht wie geplant abläuft?
- 10.2 Pharmazeutisches Entlassmanagement
- 10.2.1 Was gehört zu einem pharmazeutischen Entlassmanagement und welche Ressourcen werden benötigt?
- 10.2.2 Information über zu entlassende Patienten
- 10.2.3 Der Medikationsplan
- 10.2.4 Übergabe der Entlassmedikation an den Patienten
- 10.3 Ausblick
- 183–191 11 Unit-Dose-Versorgung für Fremdhäuser 183–191
- 11.1 Transportlogistik
- 11.1.1 Erhöht die Unit-Dose-Versorgung die Lieferfrequenz?
- 11.1.2 Welche Transportmöglichkeiten kommen infrage?
- 11.1.3 Welche Änderung in der Prozesskette ist für die Fremdhausbelieferung notwendig?
- 11.1.4 Welche Aspekte sind bei der Gestaltung des Arzneimitteltransports zu beachten?
- 11.1.5 Welche laufenden Kosten sind für den Arzneimitteltransport einzuplanen?
- 11.1.6 Wie werden laufende Medikationsänderungen bei Fremdhäusern mit Unit-Dose bearbeitet?
- 11.1.7 Sind Cito-Anforderungen bei einer Unit-Dose-Fremdhausversorgung möglich?
- 11.2 Servicelevel
- 11.2.1 Welches Arzneimittelsortiment wird im Rahmen der Unit-Dose-Versorgung an Fremdhäuser geliefert?
- 11.2.2 Wie kann die Apothekervisite gestaltet werden?
- 11.2.3 Welchen Umfang sollte die Plausibilitätsprüfung des Apothekers haben?
- 11.2.4 Was beinhaltet die Stationsvereinbarung?
- 11.2.5 Welche personellen Ressourcen sind für eine Fremdhausbelieferung mit Unit-Dose und Apothekervisite nötig?
- 11.3 EDV-Konzept
- 11.3.1 Welchen Einfluss hat das vorhandene Krankenhausinformations-System (KIS) auf die Fremdhausversorgung?
- 11.3.2 Wer ist Inhaber der Software zur Unit-Dose-Versorgung bei Fremdhausbelieferung?
- 11.3.3 Durch wen erfolgt die Datenpflege im Medikationssystem?
- 11.3.4 Welche Arzneimittelliste ist in der Unit-Dose-Versorgung hinterlegt?
- 11.3.5 Welche Anforderungen an den Datenschutz ergeben sich aus der Unit-Dose-Versorgung von Fremdhäusern?
- 192–211 12 Rechtliche Rahmenbedingungen der Unit-Dose-Versorgung 192–211
- 12.1 Begriffsdefinitionen
- 12.2 Rechtliche Rahmenbedingen des Unit-Dose-Herstellungsprozesses in der Krankenhausapotheke
- 12.2.1 Handelt es sich bei der Verblisterung von Fertigarzneimitteln um einen Herstellungsprozess im Sinne des Arzneimittelgesetzes?
- 12.2.2 Ist für das patientenindividuelle Verblistern eine Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG erforderlich?
- 12.2.3 Besteht für das patientenindividuelle Verblistern eine arzneimittelrechtliche Zulassungspflicht nach § 21 AMG?
- 12.2.4 Verblistern nur mit zugelassenen Arzneimitteln
- 12.2.5 Anwendbare Vorschriften
- 12.2.6 Welche apothekenrechtlichen Anforderungen sind nach der Apothekenbetriebsordnung zu erfüllen?
- 12.2.7 Der Verblisterungsprozess
- 12.2.8 Kennzeichnung
- 12.2.9 Management von Packungsbeilagen
- 12.2.10 Umgang mit Betäubungsmitteln und T-Rezept-pflichtigen Arzneimitteln
- 12.3 Rechtliche Rahmenbedingungen innerhalb des Closed Loop Medikationsprozesses
- 12.3.1 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- 12.3.2 Form der ärztlichen Verschreibung
- 12.3.3 Die pharmazeutische Plausibilitätsprüfung nach § 17 Abs. 5 ApBetrO
- 12.3.4 Was ist hinsichtlich der Wahrung des Patientengeheimnisses zu beachten?
- 12.3.5 Ordnungsgemäße Entsorgung von Arzneimitteln im Rahmen der Unit-Dose-Versorgung
- 12.3.6 Mitgabe von Unit-Doses im Rahmen des Entlassmanagements
- 12.4 Besondere Haftung im Rahmen der Unit-Dose-Versorgung
- 12.5 Fazit
- 212–236 13 Verordnungssoftware 212–236
- 13.1 Einleitung
- 13.1.1 Verordnungssoftware
- 13.1.2 Was leistet ein CPOE?
- 13.1.3 Aktueller Stand in Deutschland
- 13.2 Grundanforderungen
- 13.2.1 Ergonomie
- 13.2.2 Rollen
- 13.2.3 Anordnung
- 13.2.4 Verabreichung und Dokumentation
- 13.2.5 Clinical Decision Support (CDS)
- 13.2.6 Materialwirtschaft
- 13.2.7 Abrechnung
- 13.2.8 Datenschutz
- 13.3 Spezielle Fachbereiche
- 13.3.1 Chirurgie
- 13.3.2 Innere Medizin
- 13.3.3 Ambulanz
- 13.3.4 Pädiatrie
- 13.3.5 Onkologie
- 13.4 Integration
- 13.4.1 EDV-Schnittstellen
- 13.4.2 Versorgungsschnittstellen
- 13.5 Tipps für die Praxis
- 13.6 Pflege- und Wartungsaufwand
- 13.6.1 Hauskatalogpflege
- 13.6.2 Therapiestandardpflege
- 13.6.3 Anwenderschulung
- 13.6.4 Anwenderbetreuung
- 13.6.5 Anwendungsbetreuung
- 13.6.6 Fehlermanagement
- 237–244 14 Eckpunkte für eine wirtschaftliche Bewertung der Unit-Dose-Arzneimittel-Versorgung im Krankenhaus 237–244
- 14.1 Wie hoch ist das Investitionsvolumen?
- 14.2 Wie hoch ist der Personalbedarf?
- 14.3 Ermittlung möglicher Einsparungen