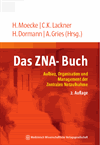Das ZNA-Buch
Aufbau, Organisation und Management der Zentralen Notaufnahme
Zusammenfassung
An die Zentrale Notaufnahme stellen sich besondere medizinische und organisatorische Anforderungen. Das breite Spektrum der Behandlungsanlässe erfordert die Zusammenarbeit aller medizinischen Fachdisziplinen eines Hauses. Zugleich kann eine Zentrale Notaufnahme nur dann erfolgreich arbeiten, wenn die erforderlichen organisatorischen, logistischen und personellen Voraussetzungen geschaffen und standardisierte medizinische Prozesse mit funktionierenden Schnittstellen zu den Fachabteilungen etabliert werden.
Für ein Krankenhaus bedeutet eine Zentrale Notaufnahme die Chance, sehr gute Behandlungs- und Betreuungsqualität sichtbar zu machen. Eine gut geführte Notaufnahme prägt den Ruf einer Klinik und positioniert das Haus positiv gegenüber den Mitbewerbern.
Die Neuauflage des ZNA-Buches vermittelt dem Fach- und Führungspersonal der Zentralen Notaufnahme relevante Management-Kenntnisse, Konzepte und Methoden sowie das konkrete Handwerkszeug für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Krankenhausplanern und -managern, die an Aufbau oder Weiterentwicklung einer Zentralen Notaufnahme arbeiten, bietet das Buch eine umfassende Wissensgrundlage und eine Anleitung für die Planung, Umsetzung und Optimierung einer Notaufnahme, Notfallambulanz, eines Notfallzentrums oder einer Rettungsstelle.
Schlagworte
- C1–xx Titelei/Inhaltsverzeichnis C1–xx
- 1–20 A Die ZNA im Kontext der Gesundheitsversorgung 1–20
- 1 Die Zentrale Notaufnahme im Unternehmen Krankenhaus
- 2 Die Notaufnahmen – die dritte Säule der Gesundheitsversorgung
- 3 Erwartungen eines Klinikdirektors an eine moderne zentrale Notaufnahme im Klinikum
- 4 Erwartungen der Fachabteilungen und nachfolgend aufnehmender Kliniken an die Notaufnahme
- 4.1 Patientenzentrierte Erwartungen
- 4.2 Organisatorische Erwartungen
- 21–60 B Notaufnahme-Konzepte im Krankenhaus 21–60
- 1 Zahlen, Daten, Fakten – Zentrale Notaufnahmen in Deutschland
- 2 Die ZNA als Portalklinik – stand alone – dezentral
- 2.1 ZNA-Rahmenbedingungen
- 2.2 ZNA als Portalklinik – stand alone – dezentral
- 3 Die Zusammenarbeit der ZNA mit den KV Notfallpraxen (Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst)
- 4 Notaufnahme: Realitäten in strukturschwachen Regionen
- 4.1 Akutversorgung
- 4.2 Alt, allein, hilflos
- 4.3 Notarztdienst
- 5 Zentrale Notaufnahme mit oder ohne Routine- bzw. Normalambulanz
- 6 Zentrale Notaufnahme mit Notaufnahmestation
- 6.1 Aufnahmestation
- 6.2 Intermediate Care (IMC)
- 7 Regional Health Care (RHC):
- 7.1 Strategische Neuausrichtung für die Zukunft
- 7.2 Strukturelle und operative Optimierungsversuche
- 7.3 Organisatorisch-infrastrukturelle Anforderungen
- 7.3.1 Leitstellenkonzept
- 7.3.2 Krankenhauskonzept
- 61–112 C Prozesse und Schnittstellen der ZNA 61–112
- 1 Das Dilemma der Nicht-Planbarkeit
- 1.1 Äußere Einflüsse
- 1.2 Innere Einflüsse
- 1.3 Lösungsansätze
- 1.3.1 Personalplanung
- 1.3.2 Räumliche Ausstattung
- 1.3.3 Prozesse
- 1.4 Grenzen des Machbaren
- 2 Exkurs: Prozesse beherrschen, die den Erfolg der Einrichtung ausmachen
- 2.1 Organisation
- 2.2 Verschwendung
- 2.3 Wertschöpfung
- 2.4 Workflow-Management
- 3 Standardisierung: Behandlungspfade und SOPs in der ZNA?
- 3.1 Standard Operating Procedures (SOPs) in der ZNA
- 3.2 Implementierung von SOPs in der ZNA
- 3.3 Bedeutung von SOPs in der ZNA für das Qualitäts- und Risikomanagement
- 3.4 Effekte der SOP Implementation in der ZNA
- 4 Patientenflussteuerung und Wartezeitenmanagement – Medizinische und ökonomische Aspekte und Patientenzufriedenheit
- 4.1 Medizinische und ökonomische Folgen des Wartens
- 4.2 Auswirkungen auf die Patientenzufriedenheit
- 4.3 Die Psychologie des Wartens in der Notaufnahme
- 4.4 Entstehung von Wartezeiten in der Notaufnahme
- 4.5 Fazit
- 5 Schnittstelle Rettungsdienst – ZNA
- 5.1 Räumliche Voraussetzungen
- 5.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
- 5.3 Verfahren zur Patientenversorgung
- 5.4 Integration klinischer Notfallmedizin in den Rettungsdienst
- 5.4.1 Vorteile einer Personalgestellung aus der ZNA für den Rettungsdienst
- 5.4.2 Nachteile einer Personalgestellung aus der ZNA für den Rettungsdienst
- 6 Sondersituation: die ZNA als Schaltstelle beim Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten (MANV), im Katastrophenfall und bei Epidemien
- 6.1 Rolle der ZNA beim MANV/im Katastrophenfall
- 6.2 ZNA bei Epidemien
- 7 Interne Schnittstellen der ZNA
- 7.1 Was versteht man im Bereich der Medizin unter dem Begriff Interdisziplinarität?
- 7.2 Aufgaben einer interdisziplinären Notaufnahme
- 7.2.1 Interne Schnittstellen einer ZNA
- 7.2.2 Externe Schnittstellen
- 8 Modernes Belegungsmanagement über die ZNA
- 8.1 Problemerfassung
- 8.2 Problemanalyse
- 8.3 Problemlösungen
- 8.4 Zusammenfassung
- 9 Boarding
- 9.1 Hintergrund
- 9.2 Übertragung auf die Notaufnahme
- 9.3 Voraussetzungen
- 9.4 Fazit
- 10 Der Patient kommt immer zuerst: das Notfall-Flusskonzept
- 113–160 D Betriebswirtschaft in der ZNA 113–160
- 1 Erlösquellen einer Notaufnahme
- 1.1 An der Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung
- 1.2 Relevanz
- 1.3 KV-Notfallpatienten
- 1.4 Vollstationäre Patienten
- 1.5 Arbeitsunfälle
- 1.6 Vorstationäre Patienten
- 1.7 Privatpatienten
- 1.8 Weitere Versorgungsformen in der Notaufnahme
- 1.9 Kostenträger
- 1.10 Fazit und Ausblick
- 2 ZNA als Cost Center
- 2.1 Unternehmensorganisation als Erfolgsfaktor
- 2.2 Das Center-Konzept
- 2.3 Die verschiedenen Center-Formen
- 2.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Center-Konzepts
- 2.5 Übertragbarkeit des Center-Gedankens auf die ZNA
- 2.6 Fazit
- 3 Interne Abrechnungsmodelle der ZNA
- 3.1 Klassische Methoden der Erlösverteilung
- 3.1.1 Pauschale Erlösverteilungsmethoden
- 3.1.2 Differenzierte Erlösverteilungsmethoden
- 3.1.3 Eingeschränkte Anwendbarkeit der Erlösverteilungsmodelle in Notaufnahmen
- 3.2 Interne Abrechnungsmodelle für die Anwendung in Notaufnahmen
- 3.2.1 Interne Abrechnungsmodelle mit Pauschalausgleich
- 3.2.2 Interne Abrechnungsmodelle mit Leistungsausgleich
- 3.3 Fazit
- 4 Brauchen Notaufnahmen ein Benchmarking?
- 4.1 Rahmenbedingungen
- 4.2 Was heißt eigentlich Benchmarking?
- 4.2.1 Internes Benchmarking
- 4.2.2 Externes Benchmarking
- 4.2.3 Phasen des Benchmarking-Prozesses
- 4.3 Benchmarking in der ZNA
- 4.4 Beispiel internes Benchmarking einer Notaufnahme
- 5 Finanzplanung und Leistungserfassung einer Notaufnahme
- 5.1 Finanzplanung
- 5.1.1 Grundlagen
- 5.1.2 Erlöse
- 5.1.3 Posten der Finanzplanung
- 5.2 Leistungserfassung
- 5.2.1 Art der Leistungserfassung
- 5.3 Fazit
- 161–190 E Planung und Implementierung einer ZNA 161–190
- 1 Krankenhausplanung, Bedarfsanalyse, bestehende Notfallversorgung
- 1.1 Notfallversorgung und Notaufnahme
- 1.2 Krankenhausplanung
- 1.3 Bedarf
- 1.4 Notfallversorgung in der Krankenhausplanung
- 1.5 Rettungskette
- 1.6 Krankenhausreform
- 1.7 Ausblick
- 2 Businessplan für die ZNA
- 2.1 Bedarfsanalyse ZNA
- 2.1.1 Kennzahlerhebung
- 2.1.2 Personal
- 2.1.3 Technische Ausstattung
- 2.2 Bedarfsanalyse aus Sicht des Krankenhauses
- 2.2.1 Synergismen Notfall/Elektivpatient
- 2.2.2 Funktion der ZNA im klinischen Lenkungsprozess
- 3 Gestaltung einer Notaufnahme für effektive und effiziente Behandlungsabläufe
- 4 Von der Idee bis zur Umsetzung: Implementierung, Schnittstellen, Kommunikationsstrukturen
- 4.1 Ausgangssituation
- 4.2 Idee
- 4.3 Umsetzung
- 4.4 Institutionalisierung und Implementierung einer ZNA im Krankenhaus
- 4.4.1 Strukturen innerhalb der ZNA
- 4.5 Schnittstelle ZNA – externe Partner
- 4.6 Schnittstelle ZNA – interne Partner
- 4.7 Kommunikationsstrukturen und -routinen in der ZNA und innerhalb des Hauses
- 191–220 F Architektur, Ausstattung, Technik, IT 191–220
- 1 Architektur der Zentralen Notaufnahme
- 1.1 Die ZNA im Mittelpunkt der Klinikplanung
- 1.2 Die Betriebsorganisation als Grundstein der Planung
- 1.3 Funktionsplanung/Verbindungen innerhalb der ZNA und zu anderen Funktionsstellen
- 1.4 Raumplanung/Kapazitäten
- 1.5 Räume und Raumgrößen in der ZNA
- 1.6 Planung der ZNA
- 1.7 Flächen‑/Kostenmodell
- 1.8 Fazit
- 2 Technik und Medizintechnik der ZNA: Wie (Medizin‑)Technik die ZNA-Prozesse unterstützt
- 2.1 Trage versus Bett
- 2.2 Röntgentechnik für die Notaufnahme
- 2.3 Mobile Diagnostik und mobiles Monitoring
- 2.4 Fachequipment in der Notaufnahme
- 2.5 EKG in der Notaufnahme
- 2.6 Labortechnik in der Notaufnahme
- 2.7 Beatmungsgeräte für den Schockraum
- 2.8 Kleingeräte
- 3 Informationstechnologie in der ZNA: Wie IT die ZNA-Prozesse unterstützt
- 3.1 Grundkonzept der IT-Ausstattung
- 3.2 Auswahl der Hardware
- 3.3 Umfang der IT-Ausstattung
- 3.4 Auswahl der Software
- 3.5 Benutzerauthentifizierung
- 3.6 Visualisierung und Steuerung
- 3.7 Sonstige IT-Konzepte
- 3.8 IT-Sicherheit
- 221–262 G Personalmanagement 221–262
- 1 Personalplanung
- 1.1 Überblick Personalplanung
- 1.2 Anreize und Mitarbeitermotivation
- 1.3 Patientenaufkommen
- 1.4 Patienten- und Leistungsspektrum
- 1.5 Personalbedarfskalkulation Ärzte (nach Gries et al. 2011)
- 1.5.1 Zeitbedarf
- 1.5.2 Personalbedarfsplanung – Berechnung
- 1.6 Jahresbedarf
- 1.7 Personalpool
- 1.8 Weitere Aspekte der Personaleinsatzplanung
- 2 Patientenfrequenzmodell – ein innovativer Ansatz zur Schichtplanung in der ZNA
- 2.1 Analyse der Patientenfrequentierung pro Zeiteinheit als Maß für die Arbeitsverdichtung
- 2.2 Entwicklung der Schichtplanung
- 2.3 Personalbedarfsermittlung
- 2.4 Evaluationsmöglichkeiten
- 3 Dienstplanung und Arbeitszeiten für einen attraktiven Arbeitsplatz in der Pflege
- 3.1 Der Bezugsrahmen ZNA
- 3.2 Kapazitäts- und Besetzungsplanung
- 3.3 Schichtplanung und Rufbereitschaft
- 3.4 Personalausfallkonzepte und Jobrotation
- 3.5 Personalauswahl und Arbeitgeberattraktivität
- 3.6 Ausstattung des Arbeitsumfeldes
- 3.7 Fazit
- 4 Arbeitsplatzattraktivität
- 4.1 Warum in der ZNA arbeiten?
- 4.2 Personalkonzept, Personalführung
- 4.3 Fort- und Weiterbildung
- 4.4 Dienstplangestaltung
- 4.5 Den Arbeitsplatz mitgestalten
- 4.6 Arbeitsumfeld
- 4.7 Vision des attraktiven ZNA-Arbeitsplatzes
- 5 Interdisziplinarität
- 263–294 H Führung, Kommunikation, Teamentwicklung und Veränderung 263–294
- 1 Führungskompetenzen für Notaufnahmekräfte: das Team als Leistungsträger
- 1.1 Situativer Führungsstil
- 1.2 Berufsgruppenübergreifende Teamkultur
- 1.3 Gleichberechtigte Kommunikation
- 1.4 Motivation durch Wertschätzung
- 1.5 Feedback
- 1.6 Fazit
- 2 Team, Führung, Change-Management
- 2.1 Was macht ein funktionierendes Team aus?
- 2.2 Und wenn es nicht funktioniert? – Teambildung, Change-Management und Re-Engineering
- 2.3 Wer steuert den Prozess? Führung und was dazu gehört
- 3 Strategien und Tools zur Konfliktlösung
- 3.1 Transparenz der Abhängigkeiten und funktionalen Werte
- 3.2 Funktionierende Prozesse
- 3.3 Emotionen berücksichtigen
- 3.4 Definition und Gebrauch des Wertes „Notfall“
- 3.5 Handlungsmöglichkeiten vergrößern
- 4 Selbstführung – Stressbelastung, Stärkung der Resilienz
- 4.1 Stress heute – was heißt das?
- 4.2 Im Dauerstress weniger Kreativität und Bewusstheit
- 4.3 Stressreduktion – geht das?
- 4.4 Besondere Belastungen in Gesundheitsberufen?
- 4.5 Resilienz – Widerstandsfähigkeit und wie ich diese durch Selbstführung stärken kann?
- 5 Exkurs: Qualität und Quantität durch Effizienz
- 295–320 I Die ZNA: Marketing für das Krankenhaus 295–320
- 1 Die ZNA als Marketingfaktor
- 2 Öffentlichkeit und Marketing
- 2.1 Einführung
- 2.2 Die Marketingstrategie
- 2.2.1 Die „Kunden“ der ZNA
- 2.2.2 Bedarf und Bedürfnisse der Zielgruppen
- 2.2.3 Antworten auf den „Kundenbedarf“
- 2.2.4 „Triage“ der Maßnahmen
- 2.2.5 Der Marketingplan
- 2.2.6 Marketingumsetzung
- 2.2.7 Umsetzungssteuerung
- 2.3 Öffentlichkeitsarbeit
- 2.4 Fazit
- 3 Kundenorientierung und -zufriedenheit – im Innen- und Außenverhältnis
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Patienten
- 3.3 Pflegekräfte der Notaufnahme
- 3.4 Klinikärzte
- 3.5 Geschäftsführung
- 3.6 Hausärzte
- 3.7 Rettungsdienste
- 3.8 Öffentlichkeit
- 3.9 Die Notaufnahme als Kunde
- 321–366 J Qualitätsmanagement 321–366
- 1 Kennzahlen und Qualitätsindikatoren
- 1.1 Kernkompetenzen einer Notaufnahme
- 1.2 Notaufnahmequalität aus der Perspektive von AQUA, IQTIG, QSR und G-BA?
- 1.3 Notaufnahmequalität: die internationale Perspektive
- 1.4 Qualitätsoffensive Deutschland
- 1.4.1 Register
- 1.4.2 Qualitätsindikatoren für die Notaufnahme
- 1.4.3 Qualitätsindikatoren für geriatrische Notfallpatienten – GeriQ-ED
- 1.4.4 Der Krankenhausplan – Berlin 2016–2020
- 1.5 Zertifizierung – DGINAZert/DIOcert
- 1.6 Ein explorativer Ansatz: diagnostische Effizienz
- 1.7 Befragungen – Patienten, Rettungsdienst, Mitarbeiter
- 1.8 Zusammenfassung
- 2 Qualitätsindikatoren und Benchmarks
- 2.1 Strukturqualität
- 2.2 Prozessqualität
- 2.3 Ergebnisqualität
- 2.4 Vergleichende Qualitätsparameter
- 2.5 Neue Ansätze
- 3 Instrumente, Werkzeuge und Praxis des Qualitätsmanagements
- 3.1 Qualitätswerkzeuge
- 3.2 Praxis des Qualitätsmanagements
- 3.3 Neue Ansätze: Peer Review
- 4 Verfahren zur Zertifizierung von Notaufnahmen
- 4.1 DIN EN ISO 9001:2015
- 4.2 European Foundation for Quality Management EFQM
- 4.3 KTQ und ProCum Cert
- 4.4 DGINAZert
- 5 Der Datensatz „Notaufnahme“ der DIVI
- 5.1 Sektion „Notaufnahmeprotokoll“ der DIVI
- 5.2 Aufbau des Datensatz „Notaufnahme“
- 5.3 Konsentierung und Verfügbarkeit
- 5.4 Weitere Entwicklung und Aussichten
- 367–416 K Risikomanagement 367–416
- 1 Crew Resource Management (CRM) in der ZNA
- 1.1 Zusammenarbeit will gelernt sein – Fehlermanagement auch
- 1.2 Crew Resource Management (CRM) erhöht die Sicherheit
- 1.3 Kommunikation ist der Mittelpunkt der Teamarbeit
- 1.3.1 Die Kommunikationstreppe
- 1.4 Sicherheit durch das 10-Sekunden-für-10-Minuten-Prinzip
- 1.5 Training von CRM im Team
- 2 Instrumente, Werkzeuge und Praxis des Risikomanagements
- 3 Patientensicherheit
- 3.1 Fehler in der Medizin
- 3.2 Patientensicherheit in der Notaufnahme
- 3.2.1 Kommunikation in Übergabesituationen
- 3.2.2 Teamwork
- 4 Diagnose-Irrtümer
- 4.1 Ursachen für Diagnose-Irrtümer
- 4.2 Vermeidung von Diagnose-Irrtümern
- 5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in der ZNA – Leitsymptom Arzneimittel?
- 5.1 Zur Häufigkeit von UAW und Medikationsfehlern in Notaufnahmen
- 5.2 Der AMTS-Prozess in deutschen Notaufnahmen
- 5.3 Risiken der Digitalisierung
- 5.4 AMTS – To-do’s
- 6 CIRS und weitere Reporting-Systeme
- 6.1 CIRS
- 6.2 Weitere Reporting-Systeme
- 7 Komplikations- und Zwischenfallmanagement
- 7.1 VOR dem Zwischenfall
- 7.2 WÄHREND des Zwischenfalls
- 7.3 NACH dem Zwischenfall
- 8 Umgang mit Fehlern
- 8.1 Traditioneller Umgang mit Fehlern
- 8.2 Betriebskultur – Sicherheitskultur
- 8.3 Team-basierte Kultur der positiven Kritik
- 8.4 Risikomanagement
- 8.5 Das Prinzip der kontinuierlichen Veränderung (change management)
- 8.6 Umgang mit Fehlern – Zusammenfassung
- 417–444 L Hygienemanagement 417–444
- 1 Allgemeine Hygienemaßnahmen in der ZNA
- 1.1 Einführung
- 1.2 Hygienemaßnahmen in der ZNA
- 1.2.1 Basis‑/Standardhygiene
- 1.2.2 Händehygiene
- 1.2.3 PSA – die persönliche Schutzausrüstung
- 2 Spezielle Maßnahmen bei infektiösen Patienten
- 2.1 Maßnahmen bei resistenten Erregern
- 2.1.1 MRSA
- 2.1.2 VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken)
- 2.1.3 Multiresistente gramnegative Erreger 3‑/4MRGN, ESBL
- 2.1.4 Gastroenteritiden
- 2.2 Saisonale Influenza
- 2.3 Hygienemaßnahmen bei Nachweis von Ektoparasiten (Läusen und Krätze)
- 445–490 M ZNA und Recht 445–490
- 1 Die Vertragsbeziehungen bei der Notfallbehandlung
- 1.1 Der Behandlungsvertrag mit dem Patienten
- 1.2 Anspruch des Patienten auf notwendige Krankenhausleistungen
- 1.3 Vergütung und Abrechnung der Notfallbehandlung
- 2 Strafrechtliche Verantwortung und zivilrechtliche Haftung bei Patientenschäden; Organisationsverschulden
- 2.1 Strafrechtliche Verantwortung
- 2.2 Zivilrechtliche Haftung für Patientenschäden
- 2.3 Haftung für Organisationsverschulden bei Patientenschäden
- 3 Arbeitsteilung und rechtliche Verantwortung
- 3.1 Sicherung des Facharztstandards durch Arbeitsteilung
- 3.2 Delegation an nichtärztliches Personal
- 3.3 Zivil- und strafrechtliche Folgen der Arbeitsteilung und Kompetenzzuweisung
- 4 Aufklärung und Einwilligung des Notfallpatienten
- 4.1 Einwilligung als Ausdruck der freien Selbstbestimmung
- 4.2 Umfang der Aufklärungspflicht
- 4.3 Einwilligungsfähigkeit des Patienten
- 4.4 Aufklärung und Einwilligung bei der Behandlung einwilligungsunfähiger Patienten
- 4.5 Sonderfall: Verweigerung medizinisch gebotener Maßnahmen durch gesetzliche Vertreter, Vorsorgebevollmächtigte und nahe Angehörige einwilligungsunfähiger Patienten
- 5 Dokumentationspflichten und Schutz der Daten
- 5.1 Rechtsgrundlagen
- 5.2 Umfang der Dokumentationspflichten
- 5.3 Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen Dokumentationspflichten
- 5.4 Datenschutz
- 6 Gewalt und Delinquenz von Patienten
- 6.1 Schweigepflicht
- 6.2 Gegenwärtige rechtswidrige Angriffe
- 6.3 Sorgfaltspflichten bei tatgeneigten Patienten
- 7 Drogen- und Alkoholkonsum von Patienten
- 7.1 Aufklärung und Einwilligung von Patienten
- 7.2 Folgen für den Behandlungsverlauf und den Heilungserfolg
- 7.3 Keine Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden
- 7.4 Umgang mit illegalen Fundstücken
- 8 Zwangsmaßnahmen
- 8.1 Begriff
- 8.2 Unterbringungsähnliche Maßnahmen bei nicht untergebrachten Personen
- 8.2.1 Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
- 8.2.2 Anordnung und Dokumentation
- 8.2.3 Einschaltung des Betreuungsgerichts
- 9 Schweigepflicht und Datenschutz
- 9.1 Schweigepflicht
- 9.1.1 Gegenstand und Umfang
- 9.1.2 Adressaten
- 9.1.3 Verletzung der Schweigepflicht
- 9.1.4 Berechtigung bzw. Verpflichtung zur Offenbarung
- 9.2 Datenschutz
- 10 Strahlenschutz und Röntgen; Medizinproduktegesetz (MPG); Hygienerichtlinie
- 11 Kindeswohlgefährdung
- 11.1 Begriff
- 11.2 Behandlung gegen den Willen der Sorgeberechtigten
- 11.3 Offenbarungsbefugnis gegenüber Dritten
- 491–548 N Ethische Fragen und soziale Verantwortung 491–548
- 1 ZNA als Anlaufstellen bei sozialen Problemen
- 1.1 „Soziale Randbedingungen“
- 1.2 Veränderungen der Gesellschaft
- 2 Gewalt und Delinquenz in der ZNA
- 3 Interkulturelle Kompetenz in der ZNA
- 3.1 Gegenseitiger Respekt in der Klinik – Notwendigkeit des Einforderns?
- 3.2 Nächtliche Inanspruchnahme von Notaufnahmen – seit Tagen andauernde Bauchschmerzen
- 3.3 Kohäsive Familienstrukturen – Anteilnahme bei Erkrankung
- 3.4 Lebensbedrohliche Erkrankung vs. Dissimulation von Symptomen
- 3.5 Morbus mediterraneus – emotionaler Schmerz- und Krankheitsausdruck
- 3.6 Unspezifische Krankheitsbeschreibung und Körperintegrität
- 3.7 Ansätze zur Schaffung einer interkulturell und religiös kompetenten ZNA
- 4 Herausforderungen in der Akut- und Notfallversorgung von Geflüchteten
- 4.1 Kulturelle Besonderheiten der medizinischen Versorgung
- 4.2 Herausforderungen durch Zugangsbarrieren
- 4.2.1 Rechtlich
- 4.2.2 Kulturell
- 4.2.3 Sprachlich
- 4.3 Problematik für Notaufnahmen
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 Versorgung von Patientinnen und Patienten mit (häuslichen) Gewalterfahrungen – das S.I.G.N.A.L. Interventionsprogramm
- 5.1 Häusliche Gewalt und Folgen für die Gesundheit
- 5.2 Pflegende und Behandelnde sind Schlüsselpersonen bei Intervention und Prävention
- 5.3 Interventionsschritte
- 5.4 Rahmenbedingungen
- 6 Sterben und Tod in der Notaufnahme
- 6.1 Unerwartet
- 6.2 Unvermeidbar
- 7 Persönlichkeits- und Datenschutz als technisches, organisatorisches und ethisches Problem
- 7.1 Datenschutzrechtliche Grundlagen
- 7.1.1 Datenschutz und berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht
- 7.1.2 Grundsatz der Erforderlichkeit
- 7.2 Die zentrale Notaufnahme
- 7.2.1 Datenerhebung
- 7.2.2 Weitere Datenverarbeitung
- 7.2.3 Schutzmaßnahmen
- 8 Besonderheiten des geriatrischen Notfallpatienten
- 8.1 Was ist ein geriatrischer Patient?
- 8.2 Multimorbidität
- 8.3 Polypharmazie
- 8.4 Sonderfall „AZ-Verschlechterung“
- 8.5 Kognition: Delir oder Demenz?
- 8.6 Triage/Screening/Assessment
- 8.7 Geschütze Räume/gesonderte Betreuung
- 8.8 Ethik
- 8.9 Kurzstationäre Behandlung geriatrischer Notfallpatienten (INKA)
- 8.10 Zusammenfassung
- 549–576 O Qualifikation und Fortbildung 549–576
- 1 Fort- und Weiterbildungskonzepte in der klinischen Notfallmedizin – was ist sinnvoll?
- 1.1 Fortbildungskonzepte in der klinischen Notfallmedizin
- 1.1.1 Reanimation und Traumaversorgung
- 1.1.2 Simulation
- 1.1.3 Notfallsonografie
- 1.1.4 Weitere Kurskonzepte
- 1.2 Weiterbildungskonzepte in der klinischen Notfallmedizin
- 1.2.1 Weiterbildung in der klinischen Notfallmedizin in Europa
- 1.2.2 Curriculum der European Society for Emergency Medicine (EuSEM)
- 1.2.3 Weiterbildung in der klinischen Notfallmedizin in Deutschland
- 1.3 Fazit
- 2 Fort- und Weiterbildungskonzepte in der Pflege
- 2.1 Aufgaben der Pflegenden in der ZNA
- 2.2 Geforderte Fähigkeiten
- 2.3 Qualifikationen
- 2.4 Personaleinarbeitung und -entwicklung
- 2.5 Kompetenzbezogene Personalportfolios
- 2.6 Fortbildung
- 2.7 Schlussfolgerungen
- 3 Organisation und Methoden der Fortbildung von ZNA-Mitarbeitern
- 3.1 Präsenztrainings, digital unterstützte Lernformate und Blended Learning
- 3.2 Besonderheiten des simulationsbasierten Lernens
- 3.3 Lehr-lern-theoretische Begründung simulationsbasierten Lernens
- 3.4 Befundlage zum Erfolg verschiedener Lernformate und Empfehlungen
- 577–664 P Strukturelle Voraussetzungen und Grenzen des Machbaren 577–664
- 1 Ersteinschätzung – das Manchester Triage System und seine Alternativen
- 1.1 Unterschied Triage und Ersteinschätzung
- 1.2 Auswahl des geeigneten Systems
- 1.2.1 Australasian Triage Scale (ATS)
- 1.2.2 Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)
- 1.2.3 Emergency Severity Index
- 1.2.4 Manchester Triage System (MTS)
- 1.2.5 Ergebnis der Analyse
- 1.3 Aufbau des Manchester Triage Systems
- 1.3.1 Präsentationsdiagramme
- 1.3.2 Generelle Indikatoren
- 1.3.3 Spezielle Indikatoren
- 1.3.4 Zeitrahmen der Dringlichkeitsstufen
- 1.4 Prozess der Ersteinschätzung
- 1.5 Fallbeispiel
- 1.6 Unterstützung der Ersteinschätzung mit IT
- 1.7 Audit der Ersteinschätzung
- 1.8 Deutsches Netzwerk
- 2 Management Massenanfall Verletzter oder Erkrankter
- 2.1 Grundsätzliche Überlegungen
- 2.2 Führungsstruktur
- 2.3 Alarmierungsstruktur
- 2.4 Versorgungsstrukturen
- 3 Das Management der Influenza-Pandemie
- 3.1 Erste Influenza-Pandemie des 21. Jahrhunderts 2009–2010 und ihre Lehren
- 3.2 Influenza-Pandemieplanung in der Klinik, Schwerpunkt ZNA
- 3.3 Krankenhausmanagement für den Pandemiefall in der interpandemischen Phase
- 4 Das Management von Brandverletzten – Voraussetzungen, Versorgungs- und Verlegungsstrategien
- 4.1 Epidemiologie
- 4.2 Notfallmedizinische Erstversorgung
- 4.3 Verlegungsstrategien
- 4.4 Versorgung von Brandverletzungen in der ZNA
- 4.5 Thermomechanische Kombinationstraumen
- 5 Das Management von schwerem Trauma, SHT und Polytrauma – organisatorische, personelle, räumliche und apparative Voraussetzungen
- 5.1 Grundsätzliche Organisation, Personalstruktur
- 5.2 Räumliche Voraussetzungen
- 5.3 Apparative Voraussetzungen
- 6 Das Management des akuten Koronarsyndroms – organisatorische, personelle, räumliche und apparative Voraussetzungen
- 6.1 Organisatorische Voraussetzung
- 6.2 Personelle Ausstattung
- 6.3 Räumliche Ausstattung
- 6.4 Apparative Ausstattung
- 7 Das Management von gynäkologischen/geburtshilflichen Notfällen – organisatorische, personelle, räumliche und apparative Voraussetzungen
- 7.1 Organisatorische Voraussetzungen
- 7.2 Personelle Voraussetzungen
- 7.3 Räumliche Voraussetzungen
- 7.4 Apparative Voraussetzungen
- 8 Das Management von pädiatrischen Notfällen – organisatorische, personelle, räumliche und apparative Voraussetzungen
- 8.1 Personal
- 8.2 Organisation und Ausstattung
- 9 Das Management von geriatrischen Notfällen und hochbetagten Notfallpatienten – am Beispiel des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee
- 9.1 Einleitung
- 9.2 Prozessentwicklung: Identifizierung geriatrischer Patienten in der Notaufnahme
- 9.3 Mögliche Patientenwege an der Notaufnahme für geriatrische Patienten
- 10 Das Management von neurologischen Notfällen – organisatorische, personelle, räumliche und apparative Voraussetzungen
- 10.1 Einführung
- 10.2 Organisatorische Voraussetzungen der Versorgung von neurologischen Notfällen
- 10.3 Personelle Voraussetzungen der Versorgung von neurologischen Notfällen
- 10.4 Räumliche Mindest-Voraussetzungen der Versorgung von neurologischen Notfällen
- 10.5 Apparative Voraussetzungen der Versorgung von neurologischen Notfällen
- 11 Das Management der akuten psychischen Störung
- 11.1 Häufigkeit und Relevanz psychiatrischer Notfälle
- 11.2 Diagnosestellung
- 11.2.1 Der psychopathologische Befund
- 11.2.2 Weiterführende Diagnoseinstrumente
- 11.3 Eigen- und Fremdgefährdung
- 11.3.1 Suizidalität und Autoaggression
- 11.3.2 Fremdgefährdung
- 11.4 Pharmakotherapie
- 11.4.1 Antipsychotika
- 11.4.2 Benzodiazepine
- 11.5 Krisenintervention
- 11.6 Rechtliche Situation und Dokumentationspflicht
- 665–696 Q ZNA-Modelle international 665–696
- 1 Zentrale Notfallaufnahmen in der Schweiz
- 1.1 Grundlagen
- 1.1.1 Gesundheitswesen
- 1.1.2 Spitalsektor
- 1.1.3 Notfallmedizin
- 1.1.4 Notfallkonsultationen
- 1.1.5 Notfallpflege
- 1.2 Organisationsmodelle von Notfallstationen
- 1.2.1 Notfallzentren an Spitälern der tertiären Versorgungsstufe
- 1.2.2 Notfallzentren an größeren Kantons- oder Regionalspitälern mit erweiterter Grundversorgung
- 1.2.3 Notfallaufnahmen an kleineren und peripheren Spitälern
- 1.2.4 Notfallpraxen
- 1.3 Herausforderungen
- 1.4 Ausblick
- 2 Notaufnahme in Australien
- 2.1 Ausgangssituation
- 2.2 Problemanalyse
- 2.3 Notaufnahme in Australien
- 2.3.1 Triage
- 2.3.2 Notfallpatienten
- 2.3.3 Weitere Leistungsangebote im Emergency Department
- 2.3.4 Besetzung und Ausbildung
- 3 Entwicklung der Notfallmedizin in den USA
- 3.1 Die Anfänge der Notfallmedizin in den USA
- 3.2 16. August 1968, die Geburt des American College of Emergency Physicians (ACEP)
- 3.3 Akademische Notfallmedizin: University Association for Emergency Medical Services (UA/EMS)
- 3.4 Weitere Standesorganisationen
- 3.5 Emergency Medicine wird 1977 eine Fachgesellschaft (Conjoint Board)
- 3.6 1989 Emergency Medicine wird ein Primary Board (eigene Fachgesellschaft)
- 3.7 Europäischer Ausblick
- 4 ZNA – das dänische Modell
- 4.1 Überblick
- 4.2 Die präklinische Notfallversorgung
- 4.3 Die klinische Notfallversorgung
- 4.4 Ausblick
- 697–721 Sachwortverzeichnis 697–721