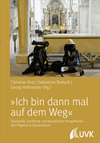Ich bin dann mal auf dem Weg
Spirituelle, kirchliche und touristische Perspektiven des Pilgerns in Deutschland
Zusammenfassung
Die Welt ist im permanenten gesellschaftlichen und technischen Wandel begriffen. Zudem hat hierzulande jeder Mensch unzählige Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Im Zuge dessen fällt es dem Einzelnen oft nicht leicht, die Orientierung zu behalten. Viele suchen daher nach Richtung und Halt im eigenen Leben. Immer mehr Menschen greifen dabei auf eine Glaubenspraxis zurück, die Jahrtausende alt ist: sie pilgern.
Zahlreiche Expertinnen und Experten aus Theorie und Praxis beleuchten interdisziplinär die spirituellen, kirchlichen und touristischen Perspektiven des Pilgerns in Deutschland. Sie schaffen damit eine eindrucksvolle wissenschaftliche Grundlage zum Thema und setzen dabei theologische, soziologische, psychologische und touristische Maßstäbe.
Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler, Kirchen und Praktiker.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–32 Spirituelle Reisen: Können Kirchen und Tourismus gemeinsam Gäste finden? 13–32
- 1 Was ist und von was handelt Spiritueller Tourismus?
- 2 Wo findet sich überall Spiritualität im Tourismusmarkt?
- 2.1 Vom Pilgern und Wandern auf spirituellen Wegen
- 2.2 Von Klöstern und Kultur an spirituellen Orten
- 3 Welche Menschen machen sich auf eine spirituelle Reise?
- 3.1 Von Gläubigen und von Kunden auf dem Weg
- 3.2 Von hybriden Ruhe- und Erlebniswelten in Klöstern
- 3.3 Kulturelles und Spirituelles Wachstum
- 4 Welche Rolle spielt die Gastgeberschaft im Spirituellen Tourismus?
- 4.1 Niederschwellige Religiosität in der Gesellschaft
- 4.2 Touristische und spirituelle Qualität für alle Gäste
- 33–62 Pilqern und Protestantismus: Lässt sich das spirituelle Phänomen theologisch befragen? 33–62
- 1 Einleitung
- 1.1 Die traditionelle protestantische Gänsehaut beim Pilgern
- 1.2 Das Pilgern als Adiaphoron
- 1.3 Der Pilgerboom und seine Motive
- 1.4 Anliegen
- 1.5 Vorgehen
- 2 Das Itinerar der Egeria (um 380)
- 2.1 Der Text
- 2.2 Die Absicht der Egeria
- 2.3 Die Nähe des Heiligen
- 3 Augustinus (428)
- 3.1 Zwei Sätze zur Bedeutung Augustins
- 3.2 Die Confessiones
- 3.3 Das Wegmotiv: die Aeneis eines Lebens
- 3.4 Die Tränen und Gott: die Bekehrung
- 4 Bonaventura (1275)
- 4.1 Pilgerfahrt des Geistes
- 4.2 Der innere Weg
- 4.3 Die ersten Stufen des Pilgerweges
- 4.4 Der Übertritt
- 4.5 Vergleich mit Egeria
- 4.6 Reformatorische Anklänge
- 5 John Bunyan (1675)
- 5.1 Bunyan und sein Pilgerbuch
- 5.2 Das Anliegen des Buches
- 6 Hape Kerkeling (2006)
- 6.1 Die Motivation: Die Frage ‚Wer bin ich?‘
- 6.2 Die Achtsamkeit auf die Fügung
- 6.3 Tod und Leben
- 6.4 Gott
- 6.5 Bekehrung?
- 6.6 Der Sinn des Pilgerns
- 6.7 Zusammenfassung
- 7 Vergleich und Folgerungen
- 7.1 Vieldeutiges Pilgern
- 7.2 Pilgern heute
- 7.3 Folgerungen
- 63–76 Praxisbeispiel | Spiritueller Sommer in Südwestfalen: Wandern als religiöses und touristisches Phänomen Welche Beweggrunde und Motive ergeben sich aus der touristischen Analyse? 63–76
- 1 Kirchen entdecken den Tourismus und Touristiker entdecken Kirchen und Spiritualität – eine inspirierende Verbindung
- 2 Pilgerreisen: Betrachtungen zur Angebotsseite
- 3 Gründe und Motive für den Pilgerboom aus Sicht der Tourismuswissenschaft
- 4 Fallbeispiel „Spiritueller Sommer“ in Südwestfalen
- 5 Fazit und Ausblick
- 77–100 Der erforschte Pilger: Was wissen wir über die Sinnsucher von gestern, heute und morgen? 77–100
- 1 Pilgern in der Forschung
- 2 Pilgertypen und Motivationen – wer pilgert?
- 3 Leiblichkeit und Wirkung – was geschieht beim Pilgern?
- 4 Pilgern als Ritual – wie wird gepilgert?
- 5 Religion oder Wandern – was ist Pilgern?
- 6 Pilgern als Indikator des religionskulturellen Wandels
- 7 Pilgern in den Medien
- 8 Pilgern als (Spiritueller) Tourismus
- 9 Pilgerforschung wohin?
- 101–120 Offene Kirchen am Weg: Welche touristischen und kirchlichen Potenziaie sind ncch zu heben? 101–120
- 1 Erfahrungen und Beobachtungen
- 2 Offene und öffentliche Kirche
- 2.1 Offene Kirchen symbolisieren die Gegenwart und die Botschaft Gottes
- 2.2 Offene Kirchen symbolisieren die Orientierungskraft des christlichen Glaubens
- 2.3 Offene Kirchen symbolisieren, dass es in unserer Welt kirchliche „Rastplätze für Leib und Seele“ gibt
- 2.4 Offene Kirchen symbolisieren die Niederschwelligkeit kirchlicher Orte
- 2.5 Offene Kirchen symbolisieren die Gastfreundschaft christlicher Gemeinden
- 2.6 Offene Kirche symbolisieren die lebendigen Zeugnisse des Glaubens
- 3 Offene Kirchen als Potenzial für die Kirchen
- 4 Offene Kirchen als Potenzial für den Tourismus
- 5 Offene Kirchen als Impulsgeber für die Kirchentheorie
- 5.1 Parochie und passagere kirchliche Orte lassen sich nicht gegeneinander ausspielen
- 5.2 Kirche nimmt kritisch-reflektierend die Bedürfnisse einer postmodernen Gesellschaft auf
- 5.3 Die Kirche ist nicht nur ein Haus der Gemeinde, sondern auch ein Haus für Einzelne
- 6 Offene Kirchen als touristische Schätze und kirchliche Leuchttürme am Weg – ein Fazit
- 121–128 Praxisbeispiel | Pilgerzentrum St.Jacobi in Hamburg: Pilgern in der GroBstadt Lassen sich Spiritueller und Stadtetourismus vereinbaren? 121–128
- 1 Einleitung
- 2 Pilgern
- 3 Pilgern in der Großstadt
- 4 Pilgerzentren
- 5 Nachsorge nach der Pilgerwanderung
- 6 Die Chancen des Pilgerns in der Großstadt
- 7 Die Grenzen
- 8 Pilgern und Städtetourismus
- 129–140 Pilgern gleich Wandern plus Gottvertrauen: Wie passt das Pilgern in den Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern? 129–140
- 1 Pilgern = Wandern?
- 2 Motivlage beim Wandern
- 3 Pilgern im Angebotsportfolio des Wanderns
- 4 Warum tut sich Tourismus mit Pilgern in der Regel schwer?
- 5 Kooperationen zwischen Wandervereinen und Kirchen?
- 6 Ausblick: Wandern und Pilgern
- 141–158 Radfahren und Radweqekirchen entlanq der Flusse: 1st der höhere Gang mit dem Pilgergedanken in Einklang zu bringen? 141–158
- 1 Pilgern und Fahrradtourismus – ein Vergleich
- 2 Die Faszination des Radwegetourismus – Von der Notlösung zum Hightech-Vergnügen
- 3 Die Radwegekirchen – Unterbrechung als spirituelle Pause
- 4 Das Pilgern vom Fahrrad aus gesehen – Die Perspektive des Unterschiedes
- 159–168 Praxisbeispiel | Bergspiritualität in den Alpen: Bergwandern zu sich selbst und zu Gott 1st Pilgern auf Gipfel und näher am Himmel effektiver? 159–168
- 1 Berge erleben – Bergerlebnis
- 2 Beobachtungen
- 3 Chancen der Kirchen
- 3.1 Ökumene
- 3.2 Chance des Internets
- 3.3 Unterschiedlichste Kooperationspartner
- 4 Berge als schweigende Lehrer
- 5 Ausbildung der Bergbegleiter
- 6 Der Mehrwert
- 169–184 Rituale des Pilgerns und ihre bioqrafische Bedeutunq: Was sind denn da für neue Pilgertypen unterwegs? 169–184
- 1 Einführung
- 2 Biografische Aspekte der Pilgerschaft
- 3 Die fünf biografisch determinierten Pilgertypen
- 3.1 Biografische Bilanzierung
- 3.2 Biografische Krise
- 3.3 Biografische Auszeit
- 3.4 Biografischer Übergang
- 3.5 Biografischer Neustart
- 4 Biografische Veränderungsprozesse nach der Pilgerschaft
- 5 Forschungsperspektiven
- 185–202 Autonomie und Symbiose der Sinnsuchen Geht es beim Pilgern und dem Tourismus nur noch um Andersheit? 185–202
- 1 Reisen als Alteritätsraum
- 1.1 Andernorts und doch bei sich
- 1.2 Vom Spielraum des Seinkönnens zum Verlust des Ich
- 2 Pilgern als Suche nach dem ganz Anderen
- 3 Autonomie und Symbiose in heutiger Pilgerpraxis
- 3.1 Autonomie durch Herausforderung
- 3.2 Symbiose als Aufgehen in Natur
- 4 Symbiotisches Pilgern als postmodernes Reisen
- 4.1 Pilgern und Postmoderne
- 4.2 Pilgern und Tourismus
- 203–214 Praxisbeispiel | Pilgerweg Loccum-Volkenroda im Hannoverschen: Und den Segen gebe ich Wie lassen sich Ehrenamt und Pilgerkirche strategist verbinden? 203–214
- 1 Einstimmung
- 2 Der Pilgerweg Loccum-Volkenroda
- 3 Ehrenamtliches Engagement am Pilgerweg
- 4 Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher PilgerbegleiterInnen
- 4.1 Organisation eines Pilgerangebots
- 4.2 Inhalte
- 4.3 Zentrale Themen und Methoden in den Kursen
- 5 Fazit
- 215–228 Pilgern auf dem Lutherweg: Sind Reformation und Wallfahren doch vereinbar? 215–228
- 1 Bestimmung einer Ausgangslage
- 2 Was meint Reformation?
- 3 Die Dinge ändern sich: Luther(pilger)wege in Deutschland
- 3.1 Wandern ist Erholung
- 3.2 Wandern ist Erbauung
- 3.3 Wandern ist Bildung
- 4 Wie qualifizieren verlässlich geöffnete Kirchen den Lutherweg?
- 5 Versuch einer Perspektive
- 229–244 Pilgern in der Peripherie der Jakobswege: Wie kann der Pilgertourismus entlang des Pommerschen Jakobsweges aussehen? 229–244
- 1 Der postmoderne alternative Pilgertourismus
- 2 Der Pommersche Jakobsweg
- 3 Untersuchung der Zielgruppen
- 4 Praktischer Verwertungszusammenhang und Handlungsempfehlungen zur Erschließung von neuen touristischen Räumen durch den Pommerschen Jakobsweg
- 5 Fazit
- 245–254 Praxisbeispiel | Benediktinerkloster Huysburg im Vorharz: Gastgeberschaft und Ruheorte auf dem Pilgerweg Was wünschen sich Wallfahrer auf der Rast? 245–254
- 1 Einleitung
- 2 Die Empfangenden: Die Mönchsregel Benedikts als Grundlage
- 3 Die Pilgernden
- 3.1 Die Ankommenden
- 3.2 Die Rastenden
- 3.3 Die Aufbrechenden
- 4 Tankstelle auch für Nicht-Pilgernde
- 5 Schluss
- 255–268 Aufbrechen, unterweqs sein und Kraft spüren: Was suchen Männer beim Pilgern? 255–268
- 1 Männer und Religion – eine Problemanzeige
- 2 Die Angst der Männer vor der Religion
- 3 Die Feminisierung von Kirche und Glauben
- 4 Männer glauben anders
- 5 Die Faszination des Pilgerns
- 5.1 Ortswechsel
- 5.2 Stoffwechsel
- 5.3 Wortwechsel
- 6 Männernachtpilgerweg von Gründonnerstag auf Karfreitag
- 7 Fazit und Ausblick
- 269–280 Am Ende werden alle Sünden erlassen: Ist beim Pilgern im Spieffiim doch nur alles Fiktion? 269–280
- 1 Mediales Pilgern
- 1.1 Dem Sohn folgen: „Dein Weg“
- 1.2 Katharsis: „Die Dienstagsfrauen“
- 1.3 Versöhnt Sterben: „Ich trag dich bis ans Ende der Welt“
- 1.4 Gruppendynamisch pilgern: „Saint Jacques … Pilgern auf Französisch“
- 2 Pilgern als Transformationsritus
- 3 Übergang Getragen werden
- 4 Eingliedern: Neues Leben
- 5 Religion: Starke Formen für distanzierte Subjekte
- 6 Mediale Transformation
- 281–286 Praxisbeispiel | Zwischen den Zeiten in Sachsen: Ich-Werden von Jugendlichen unterwegs Kann Pilgern eine Methode der Sozialen Arbeit werden? 281–286
- 1 Pilgern als Methode der Sozialen Arbeit
- 2 Erprobung in der Praxis
- 3 Wissenschaftliche Evaluierung
- 4 Transfer in die Soziale Arbeit
- 5 Fazit
- 287–306 Pilgern im21. Jahrhundert: Sind die Menschen gieichzeitig unterwegs zwischen Suche (Gott und Selbst), Wandern (Aktiv und Gesund) und Urlaub (Freizeit und Lifestyie)? 287–306
- 1 Begriffskarussell um das spirituelle Wandern
- 2 Weltweite Geschichte und christliche Tradition von Wallfahrt und Pilgerreise
- 3 Aktuelle und künftige Spielarten des Spirituellen Wanderns
- 4 Zur Entwicklung der Nachfrageseite des Spirituellen Wanderns in Europa
- 5 Zur Differenzierung der Angebotsseite des deutschen Pilgertourismus
- 6 Das europäische Pilgermodell der Jakobswege
- 7 Perspektiven des Spirituellen Wanderns für Kirchen und Tourismus
- 307–311 Autoren 307–311