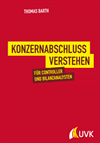Konzernabschluss verstehen
Für Controller und Bilanzanalysten
Zusammenfassung
Dem Konzernabschluss kommt eine besondere Bedeutung zu. Denn während der Jahresabschluss das einzelne Unternehmen abbildet, fasst der Konzernabschluss die Geschäftstätigkeit sämtlicher einzubeziehender Konzernunternehmen zusammen. Dies ist vor allem für Controller und Bilanzanalysten relevant, die im Rahmen ihrer Planungs-, Steuerungs-, Analyse- und Kontrollaufgaben vermehrt mit Konzernabschlüssen konfrontiert werden.
Dieses Buch erläutert kompakt und nachvollziehbar die grundlegende Erstellung eines Konzernabschlusses. Im Fokus stehen dabei die Techniken nach dem deutschen Handelsrecht (HGB). Die Unterschiede zu den International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, werden zu jedem größeren Kapitel erläutert.
Ziel des Buches ist es, die wesentlichen Informationen und die üblichen Methoden zur Konzernrechnungslegung darzustellen. Hierbei werden für die Leser schwierige Sachverhalte verständlich dargelegt und damit die Arbeit mit dem Konzernabschluss erleichtert.
Das Buch wendet sich an Controller, Bilanzanalysten und Studierende an Hochschulen sowie an andere Bildungseinrichtungen, die Veranstaltungen zur Konzernrechnungslegung anbieten.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–24 1. Konzern und Konzernabschluss 13–24
- 1.1 Begriff und Bedeutung des Konzernabschlusses
- 1.2 Bestandteile des Konzernabschlusses
- 1.3 Vorgehensweise zur Erstellung des Konzernabschlusses
- 1.4 Unterschiede zu den IFRS
- 25–44 2. Abgrenzung des Konsolidierungskreises 25–44
- 2.1 Stufenkonzeption nach HGB
- 2.1.1 Verbundene Unternehmen
- 2.1.2 Gemeinschaftsunternehmen
- 2.1.3 Assoziierte Unternehmen
- 2.1.4 Sonstige Unternehmen
- 2.2 Konzernrechnungslegungspflicht
- 2.2.1 Control-Konzept
- 2.2.2 Tannenbaumprinzip
- 2.3 Befreiung von der Pflicht zur Konzernrechnungslegung
- 2.4 Konsolidierungswahlrechte
- 2.5 Konsolidierungsgrundsätze
- 2.5.1 Einheitstheorie
- 2.5.2 Interessentheorie
- 2.6 Unterschiede zu den IFRS
- 45–60 3. Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse 45–60
- 3.1 Überblick
- 3.2 Vereinheitlichung der Bilanzstichtage
- 3.3 Einheitlichkeit von Bilanzansatz, Bewertung und Gliederung
- 3.4 Währungsumrechnung
- 3.5 Unterschiede zu den IFRS
- 61–146 4. Konsolidierung 61–146
- 4.1 Einführung
- 4.2 Kapitalkonsolidierung
- 4.2.1 Methodik der Kapitalkonsolidierung
- 4.2.2 Ursachen und Behandlung von Unterschiedsbeträgen
- 4.2.3 Erstkonsolidierungszeitpunkt
- 4.2.4 Schritte der Erstkonsolidierung bei einer Beteiligungsquote von 100 %
- 4.2.5 Folgekonsolidierung bei einer Beteiligungsquote von 100 %
- 4.2.6 Erstkonsolidierung mit Minderheitsbeteiligung
- 4.2.7 Folgekonsolidierung mit Minderheitsbeteiligung
- 4.2.8 Unterschiede zu den IFRS
- 4.3 Schuldenkonsolidierung
- 4.3.1 Einzubeziehende Bilanzposten
- 4.3.2 Erfolgsneutrale Schuldenkonsolidierung
- 4.3.3 Aufrechnungsdifferenzen
- 4.3.4 Unterschiede zu den IFRS
- 4.4 Zwischenergebniseliminierung
- 4.4.1 Voraussetzungen für die Zwischenergebniseliminierung
- 4.4.2 Definition des Zwischenerfolgs
- 4.4.3 Schritte zur Eliminierung der Zwischenergebnisse
- 4.4.4 Behandlung der Zwischengewinne/Zwischenverluste
- 4.4.5 Unterschiede zu den IFRS
- 4.5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
- 4.5.1 Definition und Behandlung von Innenumsatzerlöse
- 4.5.2 Definition und Behandlung anderer Erträge aus Lieferungen und Leistungen
- 4.5.3 Definition und Behandlung innerkonzernlicher Ergebnisübernahmen
- 4.5.4 Unterschiede zu den IFRS
- 4.6 Quotenkonsolidierung
- 4.6.1 Konsolidierungstechnik
- 4.6.2 Unterschiede zu den IFRS
- 4.7 Equity-Methode
- 4.7.1 Die Technik der Equity-Methode
- 4.7.2 Unterschiede zu den IFRS
- 147–150 Literatur 147–150
- 151–156 Stichwortverzeichnis 151–156