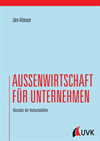Außenwirtschaft für Unternehmen
Klassiker der Hochschullehre
Zusammenfassung
In diesem Klassiker der Hochschullehre aus dem Jahr 2001 wird die Außenwirtschaft verständlich erklärt – der Blickwinkel der Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt.
Dieses Buch wendet sich an alle, die – insbesondere aus unternehmerischer Sicht – mit Fragen der Außenwirtschaft befasst sind. Unter Verzicht auf abstrakte Theorie gibt der Autor einen Überblick über die wichtigsten Problemkreise des Außenhandels, darunter die Markterschließung, das Marketing, die Organisation, die Finanzierung, die Kaufvertragsgestaltung, die INCOTERMS, die Zahlungsbedingungen, das Währungsrisiko, das Zollrecht und die Exportkontrolle.
All dies macht dieses Buch zu einer Fundgrube für Importeure und Exporteure. Zahllose Beispiele und Praxistipps in allen Abschnitten ergänzen das Wissen für den unternehmerischen Alltag. Die erste Auflage dieses Buches wurde deshalb vom Bundesverband Deutscher Unternehmer (BDU) zum Fachbuch des Jahres 1995 gewählt.
- I–XXII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXII
- 1–6 A «Raus in die Welt» - Chancen und Risiken 1–6
- 7–97 B Marktauswahl und Markterschließung 7–97
- B.1. Strategische Grundsatzentscheidungen
- B.2. Geschäftsanbahnung
- B.3. SWOT-Analyse
- B.3.1. Stärken und Schwächen (SW-Analyse)
- B.3.2. Chancen und Risiken (OT-Analyse)
- B.4. Marktauswahl (Markt-Audit)
- B.4.1. Budgetierung
- B.4.2. Grobanalyse
- B.4.3. Feinanalyse
- B.4.4. Markteintrittsbarrieren und Markteintrittsrisiken
- B.4.5. Entscheidungsfindung: Bewertung der Analysedaten
- B.5. Strategien der Markterschließung
- B.6. Markteintrittsformen
- B.6.1. Direkter Export und Import
- B.6.2. Indirekter Export und Import
- B.6.2.1. Entscheidungskriterien
- B.6.2.2. Formen indirekten Handels
- B.6.1.3. Tauschhandel/Kompensation
- B.6.1.4. Switch-Geschäfte
- B.6.1.5. Leasing
- B.6.3. Kooperation
- B.6.4. Vertragsfertigung und Veredelung
- B.6.5. Lizenzfertigung/Lizenzvergabe
- B.6.6. Franchising
- B.6.7. Direktinvestition
- B.6.7.1. Investitionsarten
- B.6.7.2. Motive für Investoren
- B.6.7.3. Motive der Gastländer
- B.6.7.4. Exkurs: Sonderwirtschaftszonen
- B.6.7.5. Standortanalyse für Direktinvestitionen
- B.6.7.6. Investitionsrechnungen
- B.6.7.7. Investitionsschutz
- B.6.8. Management von Joint Ventures: Fallbeispiel
- B.6.8.1. Zweck eines Joint Venture
- B.6.8.2. Vorbereitung
- B.6.8.3. Profil eines idealen Joint Venture
- B.6.8.4. Identifizierung des Partners (profile check)
- B.6.8.5. Gründung des Joint Venture
- B.6.8.6. Management des Joint Venture
- B.7. Internationaler Marketing-Mix
- B.7.1. Internationales Marketing/internationales Management
- B.7.2. Strategisches und operatives Marketing
- B.7.3. Adaption des Marketing-Mix
- B.7.3.1. Unterschiedliche <Zentrierungen>
- B.7.3.2. Produkt- und Programmpolitik
- B.7.3.3. Preispolitik, Kostenrechnung
- B.7.3.4. Distributionspolitik, Vertrieb, Logistik
- B.7.3.5. Kommunikationspolitik
- B.8. Internationales Beschaffungsmarketing
- B.9. Machbarkeitsstudie und Business Plan
- 98–123 C Organisation und Management 98–123
- C.1. Aufbau internationaler Führungsstrukturen
- C.1.1. Aufbauorganisation
- C.1.1.1. Zentralisierung und Dezentralisierung
- C.1.1.2. Stellen- und Funktionenbildung
- C.1.1.3. Beispiel: Export- und Importabwicklung
- C.1.2. Ablauforganisation
- C.2. Personelle Kapazitäten
- C.2.1. Kriterien zur Personalauswahl
- C.2.2. Vor- und Nachteile eines Auslandseinsatzes
- C.2.3. Vorbereitung und Fortbildung
- C.3. Interkulturelles Management: Geschäftsführung im und mit dem Ausland
- C.3.1. Strategische Ebene
- C.3.2. Arbeitsebene
- C.3.3. Andere Länder, andere Sitten
- 124–160 D Finanzierung des Außenhandels 124–160
- D.1. Cash Management (Treasury Management)
- D.2. Kurzfristige Finanzierung
- D.2.1. Exportfinanzierung
- D.2.1.1. Liefererkredit (Handelskredit)
- D.2.1.2. Vorauszahlungen, Anzahlungen
- D.2.1.3. Bankkreditlinien
- D.2.1.4. Währungskredit
- D.2.1.5. Euromarktfinanzierung
- D.2.1.6. Wechselkredit
- D.2.1.7. Export-Akkreditiv
- D.2.1.8. Ankauf und Bevorschussung bei Dokumenten-Inkassi
- D.2.1.9. Zessionskredit
- D.2.1.10. Lombardkredit
- D.2.1.11. Export-Factoring
- D.2.2. Importfinanzierung
- D.2.2.1. Vorschüsse durch Abnehmer
- D.2.2.2. Handelskredit (Liefererkredit)
- D.2.2.3. Bestellerkredit
- D.2.2.4. Wechselkredit, Avalkredit
- D.2.2.5. Bankkredite (Importkredit)
- D.2.2.6. Import-Akkreditiv
- D.2.2.7. Euromarktfinanzierung
- D.2.3. Aktuelle Tendenzen: Unternehmens-Rating
- D.3. Mittel- und langfristige Finanzierung
- D.3.1. Export-Leasing
- D.3.2. Forfaitierung
- D.3.3. Kreditlinien der AKA
- D.3.3.1. Plafond A: Lieferantenkredite
- D.3.3.2. Bestellerkredite: Plafonds C, D, E
- D.3.3.3. CIRR-Kredite
- D.3.3.4. Exkurs: Der OECD-Konsensus
- D.3.3.5. Projektfinanzierungen
- D.3.4. Kreditlinien der KfW
- D.3.5. Bundesmittel und EU-Mittel
- D.3.6. Finanzierungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit
- D.3.7. Exkurs: Der Euromarkt und Off-shore-Märkte
- 161–187 E Internationale Kaufverträge 161–187
- E.1. Angebotserstellung
- E.1.1. Funktionen des Angebots
- E.1.2. Vorverträge
- E.1.3. Bestätigungsschreiben
- E.2. Kaufmännische Vertragsinhalte
- E.3. Wichtige formale Vertragsaspekte
- E.4. Anwendbares Recht
- E.4.1. Rechtskreise
- E.4.2. Im Streitfall anzuwendendes Recht
- E.5. UNCITRAL-Kaufrecht (UN-Kaufrecht)
- E.5.1. Anwendungsbereich
- E.5.2. Einschränkungen
- E.5.3. Allgemeine Vertragsaspekte
- E.5.4. Aspekte für den Importeur
- E.5.5. Aspekte für den Exporteur
- E.6. Internationale Handelsbräuche
- E.7. Exkurs: Untemehmensformen im Ausland
- 188–198 F Rechtsverfolgung im Ausland 188–198
- F.1. Gütliche Einigung
- F.2. Vergleichsverfahren (Schlichtung)
- F.3. Gerichtliche Auseinandersetzung
- F.3.1. Der <Partner> klagt: Durchsetzung ausländischer Rechtstitel in Deutschland
- F.3.2. Durchsetzung eigener Ansprüche im Ausland
- F.4. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
- F.4.1. Schiedsgerichtsvereinbarung
- F.4.2. Formen und Schiedsordnungen
- F.4.3. Schiedsgerichtsklausel
- F.4.4. Schiedsverfahren
- F.4.5. Zusammensetzung des Schiedsgerichts
- F.4.6. Durchsetzbarkeit
- F.4.7. Vor- und Nachteile von Schiedsgerichten
- 199–281 G Liefer- und Zahlungsbedingungen 199–281
- G.1. Kaufmännische Dokumente im Außenhandel
- G.1.1. Funktionen der Dokumente
- G.1.2. Einteilung nach den Rechten
- G.1.3. Einteilung nach den Verwendungszwecken
- G.1.3.1. Zahlungsinstrumente
- G.1.3.2. Versicherungsdokumente
- G.1.3.3. Handelsdokumente
- G.2. Internationale Lieferklauseln
- G.2.1. Zweck
- G.2.2. INCOTERMS
- G.2.2.1. Entstehung und Verbreitung
- G.2.2.2. Einteilung
- G.2.2.3. Charakteristika der einzelnen Klauseln
- G.2.2.4. Eignung der INCOTERMS für bestimmte Transportmittel
- G.2.3. Beispiel: Klauseltext CIF
- G.2.4. Exkurs zur Transportversicherung im internationalen Handel
- G.3. Zahlungsbedingungen im internationalen Handel
- G.3.1. Interessenkonflikte
- G.3.2. Einige wichtige Details
- G.3.3. Nicht-dokumentäre (reine) Zahlungsabwicklung
- G.3.3.1. Vorauszahlung, Anzahlung, Abschlag
- G.3.3.2. Einfache (offene) Rechnung und offenes Zahlungsziel
- G.3.3.3. Bankgarantie
- G.3.3.4. Kompensation (Warentausch)
- G.3.4. Dokumentäre Zahlungsabwicklung
- G.3.4.1. Dokumenten-Inkasso
- G.3.4.2. Dokumenten-Akkreditiv (L/C)
- G.3.4.3. Restrisiken und Absicherungen
- G.3.5. Zahlungsbedingungen bei langfristigen Exportverträgen
- G.3.6. Exkurs: Zahlungsabwicklung mit dem Ausland
- G.3.6.1. Überweisung und Scheck
- G.3.6.2. SW IFT
- G.3.6.3. Einschränkende gesetzliche Rahmenbedingungen
- 282–381 H Risikomanagement im Außenhandel 282–381
- H.1. Allgemeines Risikomanagement
- H.1.1. Risiko und Chance
- H.1.2. Risikostrategien
- H.1.3. Risikoanalyse und -bewertung
- H.1.4. Risikopolitik: Instrumente
- H.1.5. Risikoarten (Überblick)
- H.1.5.1. Allgemeine Risiken in der Außenwirtschaft
- H.1.5.2. Länderrisiken
- H.1.5.3. Güterrisiken
- H.2. Zahlungsrisiken
- H.2.1. Arten des Zahlungsrisikos
- H.2.2. Risikobegrenzende Maßnahmen
- H.2.2.1. Bankauskünfte
- H.2.2.2. Zahlungsbedingungen und Forderungsverkauf
- H.2.2.3. Garantien und Bürgschaften
- H.3. Exportkreditbesicherung
- H.3.1. Private Exportkreditbesicherung
- H.3.2. Staatliche Exportkreditbesicherung
- H.3.2.1. Organisation
- H.3.2.2. Deckungspolitik
- H.3.2.3. Regreß und Umschuldungen
- H.3.2.4. Deckungsprinzipien
- H.3.2.5. Schuldnerarten: Garantien und Bürgschaften
- H.3.2.6. Risikoarten
- H.3.2.7. Deckungsformen
- H.3.2.8. Kosten
- H.3.2.9. Mitversicherung
- H.3.2.10. Projektfinanzierung
- H.3.2 ,11. Kautionsversicherungen
- H.3.2.12. Voraussetzungen für eine Entschädigung
- H.3.2.13. Versicherung von Bestellerkrediten
- H.3.2.14. Internationale Harmonisierungsbestrebungen
- H.4. Wechselkursrisiken (Währungsrisiken)
- H.4.1. Exposure
- H.4.2. Devisenmarkt
- H.4.2.1. Einflußfaktoren der Wechselkursbildung
- H.4.2.2. Wechselkursbegriffe
- H.4.3. Währungsmanagement: Risikobegrenzung beim Transaction Exposure
- H.4.3.1. Fakturierung in Inlandswährung
- H.4.3.2. Vorauszahlungen und Bestellerltredite
- H.4.3.3. Fakturierung in anderen Währungen
- H.4.3.4. Währungsklauseln
- H.4.3.5. Akkreditiv
- H.4.3.6. Forderungsverkauf
- H.4.3.7. Lagging (und Leading)
- H.4.3.8. Matching (Hedging, Netting, Covering)
- H.4.3.9. Fremdwährungskonten
- H.4.3.10. Devisen-Termin-Geschäfte
- H.4.3.11. Devisenoptionen
- H.4.3.12. Finanzderivate
- H.5. Zinsänderungsrisiko
- H.6. Produkthafrung
- H.6.1. Deutsches Produkthaftungsrecht
- H.6.2. US-Produkthaftungsrecht
- H.6.3. Japanisches Produkthaftungsrecht
- H.7. Markenpiraterie
- H.7.1. Problematik
- H.7.2. Zollamtliche Schutzmöglichkeiten
- H.7.3. Parallel-Importe und Erschöpfung
- H.7.4. Rechtliche Rahmenbedingungen des Markenrechts
- H.7.5. Schutzmöglichkeiten der Wirtschaft
- H.8. Seeräuber und Piraten - ein aktuelles Problem im Seehandel
- 382–454 J Außenhandelspolitik und Außenhandelsrecht 382–454
- J.1. Zweck von Ein- und Ausfuhrformalitäten
- J.2. Rechtsebenen: Nationales, supranationales und internationales Recht
- J.2.1. Supranationales Recht
- J.2.1.1. Allgemeines Völkerrecht
- J.2.1.2. Gemeinschaftsrecht
- J.2.2. Völkervertragsrecht (Internationales Recht)
- J.2.3. Nationales Recht
- J.2.3.1. Notwendigkeit
- J.2.3.2. Systematik des deutschen Rechts
- J.2.3.3. Deutsches Außenwirtschaftsrecht
- J.2.4. Überschneidungen der Rechtsebenen
- J.3. Internationales Außenwirtschaftsrecht
- J.3.1. WTO/GATT
- J.3.1.1. Grundsätze der WTO
- J.3.1.2. Nicht-tarifare Handelshemmnisse
- J.3.1.3. Wichtige Ausnahmen im GATT/WTO
- J.3.1.4. Streitschlichtung
- J.3.1.5. Perspektiven der WTO
- J.3.2. Maßnahmen gegen Dumping und Exportsubventionen
- J.3.2.1. Problematik
- J.3.2.2. Kriterien
- J.3.2.3. Vergeltungszölle
- J.3.2.4. Spezifische Dumpingformen
- J.4. Nationales Außenwirtschaftsrecht
- J.4.1. Geltungsbereich
- J.4.2. Arten und Umfang der Beschränkungsmöglichkeiten
- J.4.3. Verbote und Beschränkungen (V.u.B.)
- J.5. Zollrecht
- J.5.1. Grundlagen und Begriffe
- J.5.1.1. Rechtsgrundlagen des Zollrechts
- J.5.1.2. Zollrechtliche Begriffe und Definitionen
- J.5.1.3. Zollrechtliche Warenbegriffe
- J.5.2. Aufbau der Bundeszollverwaltung
- J.5.2.1. Struktur
- J.5.2.2. Zollämter
- J.6. Steuerliche Aspekte im Außenhandel
- J.6.1. Prinzip der Umsatzsteuer
- J.6.2. Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)
- J.6.3. Erwerbsteuer
- J.6.3.1. MWSt in den EG-Ländern
- J.6.3.2. Übergangsregelung
- J.6.3.3. Re-Importe
- J.6.4. Sonderverbrauchsteuern
- J.6.5. Steuerbefreiung bei der Ausfuhr
- J.7. Melderecht
- J.7.1. Zweck
- J.7.2. ExtraStat
- J.7.3. IntraStat
- J.7.4. Zahlungs- und Kapitalverkehr
- J.7.5. Nummernsalat
- J.8. Marktordnungsrecht (MOR)
- 455–565 K Einfuhrabfertigung 455–565
- K.1. Normalverfahren
- K.1.1. Prüfebenen bei der Einfuhr
- K.1.2. Informationsquellen zur Einfuhr
- K.1.3. Außenwirtschaftsrecht
- K.1.4. Zollabfertigung (Ablauf)
- K.1.5. Erleichterungen
- K.1.5.1. Allgemeine Voraussetzungen für die Bewilligung von Zollverfahren
- K.1.5.2. Vereinfachungen und Erleichterungen bei der Einfuhr
- K.1.6. Abfertigungsunterlagen
- K.2. Zölle und Zollpolitik
- K.2.1. Ökonomische Grundlagen
- K.2.1.1. Zollzwecke
- K.2.1.2. Zollarten und Zollwirkungen
- K.2.1.3. Einfuhrkontingente
- K.2.3. Bemessung der Einfuhrabgaben
- K.2.3.1. Tarifieren/Einordnen in den Zolltarif
- K.2.3.2. Zollwert
- K.2.3.3. EUSt-Wert
- K.2.3.4. Exkurs: Reiseverkehr
- K.2.4. Abwicklung der Zollschuld
- K.3. Warenursprung und Präferenzen (W.u.P.)
- K.3.1. Drei Ursprungsbegriffe . . . ,
- K.3.2. Nicht-präferentieller Ursprung
- K.3.2.1. Zweck
- K.3.2.2. Ursprungsbestimmung
- K.3.3. Präferentieller Ursprung
- K.3.3.1. Zweck
- K.3.3.2. Präferenzabkommen der EU
- K.3.3.3. Ursprungsregeln
- K.3.3.4. Praxistip: Ablaufschema zur präferentiellen Ursprungsbestimmung
- K.3.3.5. Einige Details
- K.3.3.6. Ermächtigter Ausführer
- K.3.3.7. Ursprungsnachweise
- K.3.3.8. Kritik
- K.3.4. Wettbewerbsrechtlicher Ursprung («Made in Germany»)
- K.4. Zollverfahren bei der Einfuhr
- K.4.1. Versandverfahren bei der Einfuhr
- K.4.1.1. Zweck
- K.4.1.2. Arten
- K.4.1.3. Ablauf
- K.4.1.4. Vereinfachungen
- K.4.1.5. Risiken und Probleme
- K.4.2. Aktive Veredelung
- K.4.2.1. Zweck
- K.4.2.2. Ablauf
- K.4.2.3. Abrechnung
- K.4.2.4. Draw-back-Verbot
- K.4.3. Freihäfen, Zollager und Freizonen
- K.4.3.1. Freihafenlagerung
- K.4.3.2. Zollagerverfahren
- K.4.4. Vorübergehende Verwendung
- K.4.4.1. Zweck
- K.4.4.2. Teil Verzollung
- K.4.5. Bleibende Verwendung
- K.4.6. Umwandlung
- K.4.7. Vernichtung oder Zerstörung
- K.4.8. Wiederausfuhr und Verbringen in einen Freihafen
- 566–639 L Ausfuhrabfertigung 566–639
- L.1. Begriffsbestimmungen
- L.2. Informationsquellen zur Ausfuhr
- L.3. Lieferungen in die EG
- L.4. Ausfuhrverfahren (Normalverfahren)
- L.4.1. Verfahrensschritte bei der Ausfuhrzollstelle
- L.4.2. Verfahrensschritte bei der Ausgangszollstelle
- L.4.3. Verfahrensvereinfachungen und Erleichterungen im Ausfuhrverfahren
- L.4.4. Abfertigungsunterlagen bei der Ausfuhr
- L.5. Zollverfahren bei der Ausfuhr
- L.5.1. Versandverfahren bei der Ausfuhr
- L.5.1.1. T1-/T2-Verfahren
- L.5.1.2. Abwicklung T1
- L.5.1.3. Abwicklung T2
- L.5.1.4. Vereinfachungen und Erleichterungen
- L.5.2. Versand mit dem Camet TTR
- L.5.3. Camet ATA
- L.5.4. Passive Veredelung
- L.5.4.1. Zweck
- L.5.4.2. Bewilligung und Durchführung
- L.5.4.3. Differenzvetzollung
- L.5.4.4. Probleme
- L.5.5. Andere Zollverfahren auf der Ausfuhrseite
- L.6. Exportkontrolle
- L.6.1. Strategische Ziele des deutschen Ausfuhrkontrollrechts
- L.6.2. Kriterien für Exportbeschränkungen
- L.6.2.1. Warenabhängige Beschränkungen
- L.6.2.2. Länderabhängige Beschränkungen
- L.6.2.3. Verwendungs-und'empfängerabhängige Beschränkungen
- L.6.3. Erleichterungen und Vereinfachungen
- L.6.4. Exkurs: Boykott und Embargo (am Beispiel des Golfkriegs)
- L.6.4.1. Begriffsabgrenzung
- L.6.4.2. Rechtliche Verankerung
- L.6.4.3. Entschädigung für Embargoschäden
- L.6.5. Ausfuhrkontrolle im Unternehmen
- L.6.5.1. Ausfuhrverantwortlicher
- L.6.5.2. Innerbetriebliche Organisation
- L.6.5.3. Genehmigungsverfahren
- L.6.5.4. Außenwirtschaftsrechtliche Betriebsprüfungen
- L.6.5.5. Sanktionen: Bußgelder und Strafen
- L.6.5.6. Bewertung der Exportkontrollen
- L.6.5.7. COCOM und Wassenaar-Abkommen
- 640–643 Literaturverzeichnis 640–643
- 644–666 Register 644–666