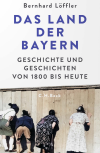Das Land der Bayern
Geschichte und Geschichten von 1800 bis heute
Zusammenfassung
Bayern ist nicht – Bayern wird gemacht. Das galt im Königreich nach 1806, unter der NS-Diktatur, aber auch noch im modernen Bayern mit seiner Hegemonialpartei und ihren mitunter monarchengleichen Akteuren. Je nach Nutzdenken oder beschworenen Traditionen, nach ideologischen, politischen oder touristischen Konzepten wurden und werden bis heute bestimmte BayernBilder erzeugt. Der Historiker Bernhard Löffler geht in seinem spannenden Buch der Konstruktion verschiedener Raumvorstellungen und Bayern-Bilder auf den Grund und legt so neue, ungewöhnliche Zugänge ins Land der Bayern. Tatsächlich gibt es in Bayern Berge, Wiesen, Wälder und Seen, Schlösser, Klöster und Kapellen, aber dieses weithin dominante Bild ist sehr selektiv. Oft erweisen sich Räume und Landschaften mehr als Projektionsflächen für Maler und Literaten, Historiker, Ethnologen und Naturschützer, Urlauber und Enthusiasten der Wander- und Waldvereine. Und sie werden instrumentalisiert von Ideologen, Politikern und Marketingexperten, vermessen, organisiert und in Dienst gestellt von Bürokraten, Kartographen und Verkehrsplanern. Bernhard Löffler erhellt in dieser erfrischenden Darstellung die Hintergründe «staatsbayerischer» Geschichte, erzählt von Landschaften, Regionen, vom bayerischen Eigensinn in der Welt – und wie sie zustande kamen, vom wem sie geprägt wurden, wie sie wirkten.
Schlagworte
- 2–6 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–6
- 7–18 Einleitung: Land, Landschaft, Räume – oder: Die Ungerechtigkeit der Welt beginnt mit der Verteilung der Berge 7–18
- 20–86 I «Allen Untertanen ein gemeinsames Vaterland»: Bayern 1800–2000 20–86
- 20–30 1. Revolution und Beständigkeit: Territorium und Grenzen seit 1800 20–30
- 31–45 2. Vermessung und Vermessenheit: Die kartographischstatistische Erfindung des Raumes Bayern 31–45
- 46–67 3. Von der Postkutsche zum Transrapid: Der Wandel von Mobilität, Kommunikation und Raumroutinen 46–67
- 68–86 4. Wie ordnet man den Raum? Eine komplizierte Geschichte der (ökonomischen) Landesplanung 68–86
- 89–186 II Regionen, Identitäten und Geschichte 89–186
- 89–99 1. Stämme, Gaue, Landesväter: Die Sprache des Regionalismus in Bayern 89–99
- 100–119 2. Flüsse, Kreise, Gebietsreformen: Bürokratie, Ideologie und lokale Identifikation 100–119
- 120–130 3. Wappen, Trachten, Vereine: Wie der Staat Geschichte macht 120–130
- 131–138 4. Meistererzählungen: Wie die Landesgeschichtsschreibung Staat macht 131–138
- 139–163 5. Vom Pfälzerwald bis in die Sudeten: «Geschichtslandschaften» und das Verständnis der Regionen (jenseits Altbayerns) 139–163
- 164–186 6. Heilige Orte, seltsame Orte, monströse Orte: Von Altötting über den Obersalzberg zum virtuellen Bayern 164–186
- 189–250 III Hohe Berge, Touristenträume und Wasserwerfer: Natur, Landschaft und Umwelt im Bild des modernen Bayern 189–250
- 189–199 1. Des Königs Ethnologe: W. H. Riehl und die problematische Suche nach der «naturgeschichtlichen Prägung des Volkscharakters» 189–199
- 200–222 2. Vom Walchensee bis Wackersdorf: Naturschutz, Umweltbewegung und Heimatpflege 200–222
- 223–250 3. Natur, Klischee, Tourismus: «Barockes Bayern» und die Produktion von landschaftlichen Sehnsuchtsräumen 223–250
- 253–322 IV Bayern und die Welt, Bayern in der Welt 253–322
- 253–277 1. Zitherspiel am Nil, Völkerschau daheim: Bayern und die fremden Welten 253–277
- 278–294 2. Arge Alp, Bayerische Tapas und Grüne Bänder: Übergangsräume und Verflechtungszonen 278–294
- 295–322 3. Eigensinn und Unterordnung: Die Kraft des Regionalen und Föderativen in Deutschland und Europa 295–322
- 323–330 Schlussbemerkung: Geschichte und Geschichten vom Land der Bayern 323–330
- 331–332 Dank 331–332
- 333–361 Anmerkungen 333–361
- 362–362 Abkürzungsverzeichnis 362–362
- 363–387 Quellen- und Literaturverzeichnis 363–387
- 388–388 Bildnachweis 388–388
- 389–393 Personenregister 389–393
- 394–400 Ortsregister 394–400
- 401–401 Zum Buch 401–401
- 402–402 Vita 402–402