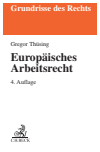Europäisches Arbeitsrecht
Zusammenfassung
Der vorliegende Band gibt einen prägnanten Überblick über das Europäische Arbeitsrecht. Er informiert über wesentliche Regelungen und einschlägige Rechtsprechung sowie über Bezüge zu den nationalen Rechtsordnungen. Enthalten ist außerdem ein Kapitel zum Internationalen Arbeitsrecht.
Die Vorteile des Buches:
-
anschauliche Darstellung und studiengerechte Aufbereitung
-
zahlreiche Beispiele und Übersichten
-
Zusammenfassungen der wichtigsten Entscheidungen des EuGH
Ideal als Ergänzung: Dütz / Thüsing, Arbeitsrecht
Schlagworte
- I–XXVI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXVI
- 1–38 § 1. Grundlagen 1–38
- 1–10 I. Was ist Europäisches Arbeitsrecht? 1–10
- 1. Begrifflichkeit
- 2. Regelungskompetenz der EU
- 3. Entstehung
- 4. Abgrenzung: Internationales Arbeitsrecht
- 10–16 II. Entwicklung des Europäischen Arbeitsrechts 10–16
- 1. Die Anfänge
- 2. Die Konsolidierung
- 3. Die Gegenwart
- 4. Die Zukunft?
- 16–24 III. Begrifflichkeiten des Europarechts 16–24
- 24–27 IV. Auslegung des Europarechts 24–27
- 27–29 V. Weg zur Überprüfung der Europarechtskonformität 27–29
- 29–38 VI. Rolle der Sozialpartner 29–38
- 1. Anhörungsrechte
- 2. Rechtssetzungskompetenzen
- 3. Umsetzungskompetenzen
- 38–82 § 2. Arbeitnehmerfreizügigkeit 38–82
- 38–42 I. Überblick 38–42
- 1. Zielsetzung
- 2. Gewährleistungsbereiche
- 3. Rechtfertigung
- 4. Unmittelbare Wirkung
- 5. Berechtigte
- 6. Verhältnis von Sekundär- und Primärrecht
- 42–48 II. Der Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit 42–48
- 1. Arbeitnehmer
- 2. Die Bereichsausnahme des Art. 45 Abs. 4 AEUV
- 3. Angehörige von Wanderarbeitnehmern
- 4. Grenzüberschreitender Sachverhalt
- 5. Übergangsregeln für Staatsangehörige der Beitrittsstaaten
- 6. Freizügigkeitsregeln für Großbritannien nach dem Brexit
- 7. Freizügigkeitsrechte für Angehöriger anderer Staaten
- 48–50 III. Recht auf Teilnahme am Arbeitsmarkt (Art. 45 Abs. 3 AEUV) 48–50
- 1. Gewährleistungen
- 2. Ordre-Public-Vorbehalt
- 50–61 IV. Diskriminierungsverbot (Art. 45 Abs. 2 AEUV) 50–61
- 1. Grundgedanke und Sinn des Diskriminierungsverbotes
- 2. Arten von Diskriminierung
- 3. Adressaten des Diskriminierungsverbotes
- 4. Rechtfertigungsmöglichkeiten
- 61–70 V. Beschränkungsverbot 61–70
- 1. Grundlagen
- 2. Adressaten des Beschränkungsverbots
- 3. Rechtfertigungsmöglichkeiten
- 70–71 VI. Anerkennung von Ausbildungen und sonstigen Qualifikationen 70–71
- 71–73 VII. Arbeitsrechtliche Auswirkungen sozialrechtlicher Koordinierung (Art. 48 AEUV) 71–73
- 73–82 VIII. Prüfungsschema 73–82
- 82–169 § 3. Diskriminierungsschutz 82–169
- 82–84 I. Einleitung 82–84
- 84–91 II. Entwicklung 84–91
- 1. Europäische Entwicklung
- 2. Die Umsetzung der RL 2000/78/EG, RL 2000/43/EG und RL 2002/73/EG
- 3. Nationale Entwicklung
- 91–106 III. Die verschiedenen Formen der unzulässigen Benachteiligung 91–106
- 1. Allgemeines – Begriff der Benachteiligung
- 2. Unmittelbare Benachteiligung
- 3. Mittelbare Benachteiligung
- 4. Belästigung
- 5. Anweisung zur Benachteiligung als Benachteiligung
- 106–132 IV. Die verpönten Diskriminierungsmerkmale 106–132
- 1. Geschlechterdiskriminierung
- 2. Rasse und Ethnie
- 3. Behinderung
- 4. Religion und Weltanschauung
- 5. Sexuelle Identität
- 6. Alter
- 7. Weitere ungeschriebene Gründe?
- 132–158 V. Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung 132–158
- 1. Allgemeines
- 2. Rechtfertigung einer unmittelbaren Benachteiligung
- 3. Rechtfertigung einer mittelbaren Benachteiligung
- 4. Sonderfall: Diskriminierung durch Diskriminierungsschutz – Affirmative action nach Art. 5 RL 2000/43/EG, Art. 7 RL 2000/78/EG und Art. 3 RL 2006/54/EG
- 158–161 VI. Rechtsfolge einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung 158–161
- 1. Auskunftsanspruch
- 2. Entschädigung und Schadensersatz nach § 15 AGG
- 3. Ausnahme: Scheinbewerber
- 161–163 VII. Geltendmachung einer Ungleichbehandlung 161–163
- 163–164 VIII. Übererfüllung und Umsetzungsdefizite des AGG 163–164
- 164–169 IX. Parallele Entwicklung: Das US-amerikanische Recht 164–169
- 169–215 § 4. Atypische Arbeitsverhältnisse: Teilzeit, Befristung, Leiharbeit 169–215
- 169–171 I. Einordnung 169–171
- 171–183 II. Teilzeitbeschäftigung (RL 97/81/EG) 171–183
- 1. Entstehungsgeschichte
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Diskriminierungsverbot – Pro-rata-temporis-Grundsatz
- 4. Verlängerung und Verkürzung der Arbeitszeit
- 183–193 III. Befristete Beschäftigung (RL 1999/70/EG) 183–193
- 1. Entstehungsgeschichte und Regelungsgehalt
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Das deutsche TzBfG im Lichte der Richtlinie
- 193–215 IV. Leiharbeit (RL 2008/104/EG) 193–215
- 1. Entstehungsgeschichte und Ausgangslage des europäischen Rechts
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Gleichbehandlungsgrundsatz – Diskriminierungsverbot
- 4. Informationspflichten bzgl. freier Stellen beim Entleiher
- 5. Kollektivrechtliche Vorgaben
- 6. Rechtsfolgen bei Verstoß
- 215–259 § 5. Betriebsübergang 215–259
- 215–217 I. Ziele und Entwicklung 215–217
- 1. Ziele
- 2. Entwicklung
- 217–235 II. Vorliegen eines Betriebsübergangs 217–235
- 1. Betriebs- und Unternehmensbegriff
- 2. Identitätswahrung
- 3. Übergang auf neuen Betriebsinhaber
- 4. Rechtsgeschäft oder Verschmelzung
- 5. Betriebsübergang in der Insolvenz
- 235–256 III. Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs 235–256
- 1. Individualrechtliche Ebene
- 2. Kollektivrechtliche Ebene
- 3. Weiterhaftung des Veräußerers
- 4. Besonderheiten im Insolvenzverfahren
- 256–259 IV. Sonderfall: Grenzüberschreitender Betriebsübergang 256–259
- 259–282 § 6. Schutz bei Massenentlassungen 259–282
- 259–264 I. Massenentlassung als Regelungsgegenstand des Arbeitsrechts 259–264
- 1. Parallele Entwicklung in Deutschland und Europa
- 2. Verknüpfung der Bereiche
- 264–272 II. Inhalte der Richtlinie 264–272
- 1. Begriff des Arbeitnehmers – Berechnung der Zahlenwerte für Massenentlassung
- 2. Begriff des Betriebs
- 3. Begriff der Entlassung
- 272–282 III. Defizite des deutschen Rechts bei der Umsetzung der europäischen Richtlinie 272–282
- 1. Personeller und sachlicher Anwendungsbereich
- 2. Sanktionen bei Verstößen gegen die Unterrichtungspflicht
- 282–324 § 7. Arbeitszeit und Urlaub 282–324
- 282–285 I. Allgemeines 282–285
- 285–292 II. Reichweite der Richtlinie 285–292
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Abweichungen und Ausnahmen von Richtlinie
- 292–303 III. Tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten 292–303
- 1. Definition der Arbeitszeit
- 2. Wöchentliche Höchstarbeitszeit
- 3. Ruhezeit
- 4. Ruhepause
- 5. Arbeitszeiterfassung
- 303–319 IV. Jahresmindesturlaub 303–319
- 1. Urlaubsanspruch (Art. 7 Abs. 1 RL 2003/88/EG)
- 2. Subsidiär Abgeltungsanspruch (Art. 7 Abs. 2 RL 2003/88/EG)
- 319–324 V. Nacht- und Schichtarbeit 319–324
- 324–337 § 8. Nachweis von Arbeitsbedingungen 324–337
- 324–325 I. Historie der Arbeitsbedingungenrichtlinie 324–325
- 325–326 II. Anwendungsbereich (Art. 1 AbRL) 325–326
- 326–333 III. Regelungsinhalt 326–333
- 1. Nachweispflichten (Art. 4 AbRL)
- 2. Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen
- 3. Horizontale Bestimmungen
- 333–337 IV. Umsetzung in das nationale Recht 333–337
- 337–363 § 9. Arbeitnehmerentsendung 337–363
- 337–342 I. Einleitung 337–342
- 1. Sachverhalt der Arbeitnehmerentsendung
- 2. Gewährleistung durch Grundfreiheiten, insbesondere Art. 56 AEUV
- 3. Aufenthalts- und sozialrechtliche Konsequenzen
- 4. Grundprinzipien
- 342–347 II. Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelungen 342–347
- 1. Arbeitnehmerentsenderichtlinie 96/71/EG
- 2. Parallele Entwicklung in Deutschland
- 3. Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG
- 347–353 III. Regeln für alle Arten von Entsendungen 347–353
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Sachliche Reichweite
- 3. Ausnahmen
- 4. Klagemöglichkeit
- 353–363 IV. Besonderheiten des deutschen Rechts 353–363
- 1. Tarifnormen als international zwingende Normen
- 2. Reine Inlandssachverhalte
- 3. Garantiehaftung
- 4. Verfahrensvorschriften und Sanktionen
- 363–393 § 10. Beschäftigtendatenschutz 363–393
- 363–374 I. Einleitung 363–374
- 1. Der Beschäftigtendatenschutz in der Entwicklung
- 2. Unions- und verfassungskonforme Auslegung des Datenschutzrechts
- 3. Mitgliedstaatliche Spielräume
- 374–393 II. Inhalte der DS-GVO 374–393
- 1. Klärung der Begrifflichkeiten
- 2. Die Verarbeitungsgrundsätze: Art. 5 DS-GVO
- 3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) iVm Art. 6 DS-GVO
- 4. Rechtsfolgen einer rechtswidrigen Datenverarbeitung
- 393–407 § 11. Whistleblowing 393–407
- 393–394 I. Einleitung 393–394
- 394–395 II. Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelungen 394–395
- 395–398 III. Meldewege nach dem HinSchG und der HinSch-RL 395–398
- 1. Interne Meldung
- 2. Externe Meldung
- 3. Offenlegung
- 398–407 IV. Individualrechtlicher Schutz von Hinweisgebern 398–407
- 1. „Hinreichender Grund“ zur Annahme eines Verstoßes
- 2. Repressalienverbot
- 3. Beweislastumkehr
- 4. Vertraulichkeitsgebot
- 407–448 § 12. Kollektives Arbeitsrecht 407–448
- 407–409 I. Überblick über Regelungsmaterien 407–409
- 409–416 II. Europäisches Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht 409–416
- 1. Kompetenzen der Union im Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht
- 2. Gewährleistungsgehalt des Art. 28 GRCh
- 416–421 III. Europäische Betriebsräte 416–421
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Inhaltliche Ausgestaltung
- 3. Rechtsvergleichung
- 421–427 IV. Mitbestimmung in der Societas Europaea (SE) 421–427
- 1. Entwicklung und Bedeutung der SE
- 2. Die mitbestimmungsrechtliche Grundstruktur der SE vor dem Hintergrund divergierenden einzelstaatlichen Mitbestimmungsrechts
- 3. Das Instrument der Verhandlungslösung
- 427–431 V. Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Fusionen 427–431
- 1. Sachlicher Geltungsbereich
- 2. Mitbestimmungsregeln
- 3. Besonderes Verhandlungsgremium
- 431–445 VI. Unterrichtung und Konsultation der Arbeitnehmer gemäß RL 2002/14/EG 431–445
- 1. Entwicklung
- 2. Entstehungsgeschichte
- 3. Ziele der Richtlinie
- 4. Anwendungsbereich
- 5. Anhörungs- und Unterrichtungsrechte im Einzelnen
- 6. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen
- 445–448 VII. Exkurs: Mitbestimmungsrechte in den verschiedenen europäischen Staaten 445–448
- 448–479 § 13. Internationales Arbeitsrecht 448–479
- 448–449 I. Internationalisierung des Arbeitsmarkts 448–449
- 449–470 II. Arbeitsvertragsstatut bei grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen 449–470
- 1. Grundtypen der arbeitsvertraglichen Gestaltung
- 2. Bestimmung des Arbeitsvertragsstatuts
- 470–473 III. Gerichtsstand bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 470–473
- 473–479 IV. Kollektives Arbeitsrecht 473–479
- 1. Betriebsverfassungsrecht
- 2. Tarifvertragsrecht
- 479–490 Sachregister 479–490