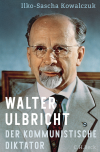Walter Ulbricht
Der kommunistische Diktator
Zusammenfassung
Walther Ulbricht prägte die deutsche und europäische Geschichte im 20. Jahrhundert wie nur wenige andere. Der erste Band von Ilko-Sascha Kowalczuks monumentaler Biographie ist auf ein fulminantes öffentliches Echo gestoßen. Nun folgt der zweite Band, der zeigt, wie der deutsche Kommunist zum kommunistischen Diktator wurde. Als er 1945 aus der sowjetischen Emigration nach Deutschland zurückkam, war Ulbricht bereits der für Moskau wichtigste Funktionär der deutschen Kommunisten. Er betrieb unter Anleitung Stalins die Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED und gründete die DDR. Er schlug den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 nieder und ließ die Mauer bauen, die für immer mit seinem Namen verbunden bleiben wird. Ilko-Sascha Kowalczuk hat dieses exemplarische Leben im Zeitalter der Extreme so gründlich erforscht wie noch keiner vor ihm. Seine beeindruckende Studie wird auf lange Zeit ein Standardwerk bleiben: zur Geschichte der DDR, des deutschen Kommunismus und des 20 . Jahrhunderts. Ab Frühling 1945 konnte Walter Ulbricht seinen langgehegten Traum verfolgen: ein kommunistisches Deutschland zu schaffen. Als Stalins wichtigster Mann in der sowjetisch besetzten Zone wurde er zum eigentlichen Staatsgründer der DDR, der allerdings erst 1960 auch formell zum obersten Funktionär aufstieg. Immer wieder konnte er seine Macht behaupten, so beim Aufstand vom 17. Juni 1953 , der gegen seine Herrschaft gerichtet war. Als sie 1960/61 erneut in Gefahr geriet, errichtete er die Mauer. Anschließend erfand sich Ulbricht neu und versuchte als «Landesvater» die DDR im begrenzten Rahmen zu verändern. Er scheiterte an seinen konservativen Gegenspielern in der SED-Spitze. Der Sturz Ulbrichts 1970/71 war allerdings nicht nur dieser mächtigen, von Moskau unterstützten Gruppe geschuldet – denn Ulbricht war inzwischen krank und alt. Kowalczuks Biographie zeichnet nicht nur all diese politischen Entwicklungen präzise und quellennah nach, sie zeigt auch, wie Ulbricht abseits des Protokolls lebte, wer die wichtigsten Menschen in seinem Umfeld waren und warum die Geschichte der DDR und des Kommunismus ohne Kenntnis der Biographie Ulbrichts nicht zu verstehen ist.
Schlagworte
- 2–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–14
- 15–16 Vorbemerkung 15–16
- 17–19 Die Grundtorheit der Epoche. Einleitung 17–19
- 20–22 Diktator neuen Typs 20–22
- 23–165 1. Von der KPD zur SED (1945 /46) 23–165
- Die Potsdamer Konferenz
- Hiroshima und Nagasaki
- Wahrnehmungen sowjetischer Soldaten
- Vergewaltigungen
- Erster «Ausflug» nach Berlin
- Radikale Entnazifizierung?
- Aufbau der Verwaltung
- Umzug nach Lichtenberg am 8. Mai
- Was demokratisch aussehen sollte
- Machtbewusstsein
- Personalpolitik
- Die erste KPD-Funktionärsversammlung und die neue Partei
- Gegen eine Einheitspartei
- Partei der Werktätigen
- Zwischenstopp: Nachwirkungen des Nationalsozialismus
- Arbeit am KPD-Aufruf in Moskau
- Der KPD-Aufruf vom 11. Juni 1945
- Trostlosigkeiten und Vertreibungen
- Die KPDSpitze
- Das Toleranz-Paradoxon
- SPD-Zentralausschuss und Kurt Schumacher
- CDU und LDP
- Kümmerpartei
- Gesprächsaufnahme
- Erneut in Moskau
- Kein Stacheldraht in Berlin?
- Erste Funktionärskonferenz: Die Grundsatzrede
- Die Verwaltung als Kern des staatlichen Neuaufbaus
- Hermann Brill, Andreas Hermes u. a
- Justiz im Aufbau
- Die neuen Schulen
- Arbeitslosigkeit
- «Demokratie» als Kampfform
- Bodenreform
- Der Kampf gegen unabhängige Christdemokraten
- Demontagen
- Blockpolitik
- Transmissionsriemen
- Sowjetische Uniform?
- FDGB-Gründungsaufruf
- «Diktatur der Mehrheit»
- Gewerkschaft als Teil der Volksfront
- «Direkte Demokratie»
- Im Feindesland auf einer Insel
- Gewerkschaften als Unternehmer?
- FDGB-Gründung
- Staatskapitalismus?
- Dem Morgenrot entgegen: Jugendorganisation
- Manfred Klein
- Die neue KPD als Vorbild für den neuen Staat
- Geheimapparate und Überprüfungspraxis
- Umzug nach Pankow und Berlin-Mitte
- Reisen in die Zone
- «Banditen in Rotarmistenuniform»
- Neue Mitglieder für die neue KPD
- Die verfeindeten Geschwister: KPD und SPD
- Schnelles Ziel: Einheitspartei
- Kritik an Ulbricht
- Rückschlag freie Wahlen und freie Fahrt zur Einheitspartei
- Das neue Jahr: Erwartungen
- Neue Probleme auf dem Weg zur Einheit
- Erneut in Moskau
- Die Bildung der SED
- Die Legende: «Gibt es einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus? »
- Proteste der SPD-Basis
- Der Druck nimmt zu
- Gegen Stacheldraht in Berlin und für die Diktatur
- Urabstimmung
- Vereinigungsparteitag
- Die Parteispitze
- Zwangsvereinigung?
- 166–246 2. Von der SBZ zur DDR (1946–1949) 166–246
- «Sozialismus»
- Wirtschaftsprobleme
- «Rotlackierte Nazis»: Der richtige Sozialismus …
- Zuständigkeiten und Parteiapparat
- Volksentscheid in Sachsen
- Wahlfragen
- Einschätzungen durch die Sowjets
- Grundrechte
- «Frauenpolitik »
- Wahldebakel
- Für die Einheit in Bayern
- «Wir müssen überall Vertrauensleute haben.» Terror und geheimpolizeiliche Strukturen
- Verfassungsfragen
- Offenbarungen: Treffen mit Stalin
- Verwaltungsakademie: Kader für den neuen Staat
- Konferenz der Ministerpräsidenten in München
- Zentralisierung der Wirtschaft
- Leninismus als offizielle Ideologie: Der zweite SED-Parteitag im September 1947
- Die letzte Etappe auf dem Weg zur DDR-Gründung
- Diktatur des Proletariats
- Immer wieder diese Vergangenheit …
- Sowjetisierung
- Erich Gniffke
- Stalin: «Zickzack»
- Inszenierte Hochzeit?
- Erste SED-Parteikonferenz
- Bürokratisierung und Überwachung
- Mitläufer und Feinde gesucht
- Wahlen: Kampf gegen die SED
- Schlüsselposition im neuen Staat: Regierungsbildung
- Speziallager
- Gründung der DDR
- 247–315 3. Stalins Gebiet (1949–1953) 247–315
- Dauerbedrohung und Dauermobilisierung
- Privates bleibt nicht privat: Frauen, Kinder, Familie
- Görlitzer Vertrag
- Die führende Rolle
- Huldigungen Stalins
- Staatssicherheit
- Vorbereitung des III. SED-Parteitages
- III. SED-Parteitag
- Von Stalin lernen … Noel Field und Paul Merker
- «Wahlen»
- Parteisäuberung
- «Deutsche an einen Tisch»
- Thomas Mann an Ulbricht
- Erste Anzeichen von Personenkult
- Die Stalin-Note
- Vorbereitung einer neuen Offensive
- Umsetzung ohne Geschrei
- Orientierungen für den forcierten Kurs
- Die 2. SED-Parteikonferenz
- Terror gegen die Gesellschaft
- Neue Säuberungswelle: Merker und Dahlem
- Arbeitsproduktivität und Normen
- Der Schock
- 316–488 4. Die Krisen im Sozialismus (1953–1961) 316–488
- Verkündigungen: Stimme und Macht
- Ulbrichtstadt?
- Auf die Krise mit Terror reagieren
- Der «Neue Kurs»
- Ulbricht trägt die Hauptverantwortung
- «Das» Kommuniqué
- Selbstkritisches von Ulbricht
- Volksaufstand
- Der Aufstand: Ulbrichts Rettung und das Ende des Personenkults
- Zuflucht in Karlshorst
- «Faschistischer Putschversuch»
- Raus aus der Defensive
- Verhärtete Fronten im Politbüro
- Entscheidung in Moskau
- Max Fechner
- Abrechnung mit «Herrnstadt-Zaisser»
- Der bedeutendste Sieg der Karriere
- Der Kern der Partei
- Die innere Staatsgründung
- Kampf um die Zukunft: Jugend
- Der Führer ist tot, es lebe die Partei: Tauwetter
- Der IV. SED-Parteitag
- Deutschland im internationalen Ränkespiel
- Die organisierte Verantwortungslosigkeit: Wirtschaft und Bürokratismus
- Das Jahr 1956
- Der XX. Parteitag der KPdSU
- Die 3. SED-Parteikonferenz
- Zukunft: Keine Aufarbeitung der Vergangenheit
- Das «persönliche Regime»
- «Frauenpolitik»
- Ulbricht in China
- Die ungarische Revolution: Der Feind als Revisionist
- Die reformsozialistische Opposition
- Die 30. ZK-Tagung
- «Ulbricht muss weg!»
- Rückenwind aus Moskau
- «Spiegel»-Interview
- Abrechnung
- «Schirdewan-Wollweber-Fraktion»: Die Unterwerfung der Partei
- Der Machiavellist
- Der V. SEDParteitag
- Zukunftsplanungen
- «Sozialistische Menschengemeinschaft »
- «Weltall-Erde-Mensch»
- Schlagabtausch mit Kurt Mothes
- «Babelsberger Konferenz»
- «Kulturrevolution »
- «Sozialistischer Realismus» und Formalismus
- Bertolt Brecht
- Johannes R. Becher
- «Bitterfelder Weg»
- Die Zukunft in der Gegenwart: Der neue Mensch
- Architektur und Stadtplanung
- Abrisspolitik
- «Waltershausen»
- Stars und Henselmann
- Franziska Linkerhand: Träume und Enttäuschungen
- 489–678 5. Der neue Traum vom Sozialismus (1960–1968) 489–678
- «Ganz Berlin»
- «Unsere Welt von morgen»
- Flora und Jolanthe
- Blitzkriegspläne
- Krisenbewältigungsstrategie
- Krisen als Stabilitätsanker
- «Störfreimachung»
- Warschauer-Pakt-Treffen: Die ersten Steine werden vermauert
- Die berühmtesten Sätze Ulbrichts
- Three Essentials
- Der Beschluss zum Mauerbau
- «Sperrwand eines Konzentrations lagers»
- «Antifaschistischer Schutzwall»
- Von Politbürokraten zu Technokraten
- Staatsrat
- Eingaben: Bittgesuche statt Verwaltungsgerichtsbarkeit
- Das Netzwerk
- Erste Mauerwirkungen: Besuche und Wahlen
- Dankbarkeit, Obrigkeit und kommunistischer Mensch
- «Es ist jetzt beendet»: Entstalinisierung
- Geschichte als Legitimationsinstanz
- Probleme mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus
- «Ist es, weil ich Jude bin?»
- «Zwangsläufigkeiten» und Ulbrichts Veröffentlichungen
- Thälmann-Kult
- «Nackt unter Wölfen »
- «Unsere Geschichtsforscher befassen sich zu sehr mit Fragen der Vergangenheit»
- «Zur Geschichte der neuesten Zeit»
- Immer wieder 1918
- Zentralisierung von Quellen und Forschungen
- Historiker im dritten Beruf: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
- Zukunft Kybernetik
- Wissenschaftlich-technische Revolution und Produktivkraft Wissenschaft
- Zukunftspolitik und Jugend
- Neue Kader braucht das Land
- «Freiheitsdebatte» und Rechtspflege
- Staatsbürgergesetz und «Grundgesetz» der DDR
- «Weil er ein guter Mensch ist»: Heiland, Diktator, Landesvater, Führerkult
- Demütigungen alter Kontrahenten auf dem Zenit der Macht
- «Die Leuten spucken vorn rauf …»: Dauerserie
- Witze und Gerüchte
- Attentate?
- Abschottungen
- Staatsjagd und Sport
- Groß Dölln
- «Verräter» und «Renegaten»
- Neue bundesdeutsche Blicke auf den Osten und Ulbricht I
- Gesundheit
- Der Hauptmann von Lychen: Kuriositäten, Satire und Karikaturen
- Ulbricht im Kloster: Kunstschinken und anderes
- Patenonkel
- Vater und Tochter
- «I thought I had married a carpenter»
- First Lady
- Privatbibliothek
- Modern sind bei uns nur die Resolutionen: Die DDR mit allen Mitteln retten
- Abbruch des Siebenjahrplans
- Eher Sisyphos denn Herkules: Versuch, die Wirtschaft zu reformieren
- Die «goldenen» sechziger Jahre
- «Wir haben keine Zeit mehr»: Konflikte und der Fall Havemann
- «Wir befreien uns von einigen politischen Häftlingen.» Opfer der eigenen Propaganda und Abschied von Chruschtschow
- Die Krise spitzt sich zu: Konflikte im Vorfeld des 11. SED-Plenums
- Erich Apel
- Exempel: Wolf Biermann
- Die 11. Tagung des ZK der SED
- «Realer Sozialismus» und «10. Industriestaat» in der Welt
- Den Sozialismus vollenden
- Der letzte Parteitag als Chef: Reaktionen von Bahro, Biermann und Havemann
- «Die DDR ist keine Zone mehr»: Neue bundesdeutsche Blicke auf den Osten und Ulbricht II
- Stamokap und Konvergenztheorie
- Erste außenpolitische Knospen
- «Prag ist das Stalingrad für Ulbricht»: Der «Prager Frühling»
- 679–736 6. Die Ablösung als Parteichef (1969–1973) 679–736
- «Überholen, ohne einzuholen»
- Konflikte um die Deutschlandpolitik
- Die Frage der Nation
- Kritik an Honecker und Breschnews Absage an Ulbrichts Entmachtung
- Scherbengericht und Beginn der Entmachtung
- «Rücktritt»: Ende der Ulbricht-Ära
- Demütigungen: Ulbricht fällt
- Reaktionen und ungeahnte Wertschätzungen
- Gesundheitliche Probleme
- Feindschaft zu Honecker
- Showdown: Ulbricht kämpft im Politbüro
- Neue Demütigung
- Stasi hört mit
- Die Hymne der DDR
- Ulbricht schaltet ein letztes Mal Breschnew ein
- Verlust der Hoheit über die eigene Vergangenheit
- Keine Memoiren
- Letzte Amtshandlungen
- Der 80. Geburtstag
- Letzte Demütigung: Herbert Wehner in Ost-Berlin
- Letzte Besucherinnen und Besucher
- Der Tod
- Kurze Staatstrauer
- Ulbrichts Tod in der Welt
- Ulbrichts Akten
- Unperson?
- Ulbricht bei Mittenzwei
- Ulbricht in der Geschichtspolitik nach 1990
- Ulbricht reloaded: Hacks, Wagenknecht oder Krenz erfinden ihn neu
- Ulbricht in der Historiographie
- Neue Quellen
- Lotte Ulbricht und Beate Matteoli
- Hätte Walter Ulbricht «1989» erleben können?
- 737–744 Persönliches 737–744
- 745–746 Editionshinweise 745–746
- 747–922 Anmerkungen 747–922
- 923–930 Abkürzungsverzeichnis 923–930
- 931–934 Abbildungsnachweis 931–934
- 935–956 Personen- und Ortsregister 935–956
- 957–988 Bildteil 957–988
- 989–989 Zum Buch 989–989