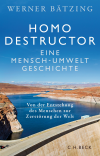Homo destructor
Eine Mensch-Umwelt-Geschichte
Zusammenfassung
Angesichts der Größe der heutigen Umweltzerstörungen stellt sich die Frage: Ist der Mensch ein homo destructor, der seine Umwelt immer und überall zerstört? Das Opus magnum des bekannten Geographen und Apenforschers Werner Bätzing gibt darauf eine Antwort in Form einer breit angelegten, bis zu Entstehung des Homo sapiens zurückreichenden Geschichte unserer Beziehung zur Natur. Um die drohende Zerstörung der vom Menschen geprägten Welt zu verhindern, so Bätzings These, ist es nötig, dass wir einen Schritt zurückgehen und die Erfahrungen der vormodernen Gesellschaft im Umgang mit Natur und Umwelt wieder stärker berücksichtigen. Um zu überleben, hat der Mensch bereits sehr früh in die vorgefundene Natur eingegriffen und sie verändert. Aber er hat sich stets darum bemüht, diese Veränderungen so zu gestalten, dass seine eigenen Lebensgrundlagen den nachfolgenden Generationen erhalten blieben. Erst mit den modernen Naturwissenschaften, mit Aufklärung, Industrieller Revolution und Marktwirtschaft setzt sich ein Denken und Handeln durch, das Natur und Umwelt kurzfristig vernutzt, ohne an ihre Erhaltung und an die Auswirkungen für die Zukunft zu denken. Mittlerweile wird deutlich, dass ein solches Denken und Handeln die gesamte Umwelt immer mehr zerstört und letztlich zur Selbstzerstörung des Menschen führt.
- 2–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–18
- 19–44 1. Eine vernetzte Gesamtperspektive Zielsetzung und Grundlagen der Mensch-Umwelt-Geschichte 19–44
- 1.1 Aufgabe und Zielsetzung
- Geschichte als Infragestellung des heutigen Umweltbezugs
- Weder Addition von Einzelergebnissen noch Ableitung aus einem Prinzip
- Sammelband oder Monographie?
- Empirische und theoretische Voraussetzungen dieses Buches
- Zu den normativen Grundlagen dieser Darstellung
- 1.2 Geschichte des Faches Umweltgeschichte
- Phase 1: Umweltgeschichte bis 1970
- Phase 2: Umweltgeschichte von 1970 bis 2010
- Phase 3: Umweltgeschichte nach 2010
- Die aktuellen Schwächen des Fachs Umweltgeschichte
- 1.3 Denkfiguren der Mensch-Natur-Beziehung
- Der Mensch dominiert die Natur
- Die Natur dominiert den Menschen
- Der Mensch wird von der Natur nur teilweise dominiert
- Der Ansatz dieses Buches
- Philosophische Anthropologie
- Zweite Natur
- 1.4 Leitideen der Mensch-Umwelt-Geschichte
- Umweltprobleme als humanes Dauerproblem
- Fortschrittsgeschichte
- Verfallsgeschichte
- Paradies und Sündenfall
- Entwicklungen vom Anfang her verstehen, nicht vom Ende
- 1.5 Zur Gliederung dieses Buches
- Wenige große Wendepunkte
- Gliederung der Geschichte in Epochen auf der Basis der Wendepunkte
- Epochenuntergliederungen
- Kein Eurozentrismus
- Zur ganzheitlichen oder holistischen Perspektive
- 45–82 2. Die Entstehung des Menschen im Rahmen der Evolution Zur kulturellen Selbstbegrenzung eines unbegrenzten Wesens 45–82
- 2.1 Der Kontext der biologischen Entwicklung des Menschen
- Die Familie der Menschenaffen
- Drei unterschiedlich alte Teile des menschlichen Körpers
- Keine lineare Entwicklung
- 2.2 Der aufrechte Gang der Vormenschen – der erste Schritt zum Menschen
- Neuer Lebensraum durch aufrechten Gang
- Aufrechter Gang und freie Hände
- Sozialleben der Vormenschen
- Kulturen bei Menschenaffen und Vormenschen
- 2.3 Gehirnwachstum und Herausbildung der Gattung Homo
- «Nussknackermenschen» und Frühmenschen
- Biologische und kulturelle Entwicklung der Gattung Homo
- Der Homo sapiens
- 2.4 Die spezifischen Eigenschaften des Homo sapiens
- Vier biologische Merkmale
- Großes Gehirn
- Werkzeugherstellung
- Feuerbeherrschung
- Sprachvermögen
- Sozialverhalten
- Der Mensch als Produkt der Evolution
- 2.5 Die Besonderheit der menschlichen Entwicklung
- Die Sicht des Menschen in Paläoontologie, Paläoanthropologie, Paläogenetik
- Die Sicht der Philosophischen Anthropologie: Der Mensch als Generalist
- Lebensraumanpassung und kulturelles Lernen
- Frauen und Männer im Rahmen der menschlichen Entwicklung
- Vier Veränderungen im menschlichen Naturverhältnis
- Das menschliche Gehirn 78 · Das Fehlen einer festen Mitte
- 83–114 3. Jäger-und-Sammler-Gesellschaften Natur als natürliche Ordnung 83–114
- 3.1 Jäger und Sammler als «Fremde»
- Die europäische Wahrnehmung von Jägern und Sammlern
- Wichtige wissenschaftliche Fächer zum Verständnis der Jäger und Sammler
- Zeitliche Gliederung und räumliche Entwicklung
- Heutige und jungpaläolithische Jäger und Sammler
- Drei exemplarische Jägerund-Sammler-Gesellschaften
- 3.2 Wirtschaftliche Aktivitäten
- Sammeln und Jagen
- Geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen
- Ernährungsweisen
- Wanderungen
- Ursprüngliche Überflussgesellschaft
- 3.3 Lebensformen
- Gruppen und Großgruppen
- Gabentausch
- Zwischenraum zwischen Natur und Mensch und Herrschaftslosigkeit
- Konflikte und Aggressionen
- 3.4 Naturbezug: Ehrfurcht vor der beseelten Landschaft
- Natur und Landschaft als beseelt
- Mittlerpersonen zwischen Geisterwelt und Menschenwelt
- Ehrfurcht vor der Ordnung der Natur
- Die «Traumzeit»
- Umweltzerstörungen durch Jäger und Sammler?
- Die Idee der natürlichen Ordnung als kulturelle Selbstbegrenzung
- 3.5 Spezialisierte Jäger und Sammler
- Verbesserte Sammel- und Jagdstrategien
- Veränderte Lebensräume
- Beginn von Hierarchien und Herrschaft
- Ausrottung von großen Säugetieren durch den Menschen?
- Das außerordentliche Naturwissen der Jäger und Sammler
- 115–156 4. Egalitäre Bauerngesellschaften Natur als Kulturlandschaft 115–156
- 4.1 Entstehung und Ursache der Neolithischen Transformation
- Domestizierung von Pflanzen und Tieren
- Stark weiblich geprägte Domestizierung
- Entstehung von Reichtum und Eigentum
- Steigerung des Flächenertrags
- Bewertung der Neolithischen Transformation
- Ursachen für die Entstehung der Landwirtschaft
- Überfluss und Muße
- Die Revolution der Symbole
- Das Heiligtum von Göbekli Tepe
- Entstehung der Landwirtschaft und kulturelle Entwicklung
- 4.2 Landwirtschaftsregionen der Erde
- Regionen der Entstehung der Landwirtschaft
- Räumliche Ausbreitung der Landwirtschaft über die Erde
- Vier Nutzungsgrenzen der Landwirtschaft
- Landwirtschaftsregionen der Erde als Beharrungsregionen
- 4.3 Neue Siedlungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen
- Solarenergie als Ursache für dezentrale Struktur
- Viele kleine Siedlungen statt weniger großer
- Räumliche Gliederung der Kulturlandschaft
- Räumliche Fluktuationen
- Raumstruktur in Form von Zellen
- 4.4 Ökologische Eigenschaften der Kulturlandschaft
- Umwandlung von Natur- in Kulturlandschaften
- Kleinräumigkeit und Vielfalt der Kulturlandschaften
- Notwendigkeit der ökologischen Reproduktion
- Fünf Herausforderungen für die ökologische Reproduktion
- Erfahrungswissen für die ökologische Reproduktion
- Kulturlandschaften als zweite Natur
- 4.5 Bäuerliche Lebensformen
- Die Gruppe als Zentrum
- Kulturelle Werte von Bauerngesellschaften
- Zentrale Merkmale von Bauerngesellschaften
- 4.6 Naturbezug: Landwirtschaft als religiöse Tätigkeit
- Landwirtschaftliche Nutzung als religiöse Tätigkeit
- Fruchtbarkeit als Zentrum bäuerlichen Denkens und Handelns
- Neues zyklisches Zeitverständnis
- Naturzerstörungen durch Bauerngesellschaften
- Größere Möglichkeiten der Selbstzerstörung und kulturelle Selbstbegrenzung
- 157–200 5. Stadtstaaten und Großreiche Stadt als Distanzierung von Natur 157–200
- 5.1 Neue Entwicklungen – Vom immer größeren Dorf zur Stadt?
- Der Bruch durch die Urbane Transformation
- Weiterentwicklungen in der Landwirtschaft
- Handwerk und Güteraustausch
- Der Tempel als religiöses Zentrum einer Agrarregion
- Der Tempel als multifunktionales Regionszentrum
- 5.2 Die ersten Städte, ihre Eigenschaften und ihr Umlandbezug
- Die Entstehung des erblichen Königtums als Beginn der Stadt
- Regionen der Stadtentstehung und Charakteristika von Städten
- Die Blüte des spezialisierten Handwerks durch die Entstehung der Stadt
- Metallverarbeitung und Bronzeherstellung
- Die Blüte des Handels durch die Entstehung der Stadt
- Spezialistentum und Herrschaft als männliche Tätigkeitsbereiche
- Die Entstehung des Krieges
- Stadt und Land – zwei unterschiedliche Welten
- 5.3 Glanz und Niedergang von Stadtstaaten und Großreichen
- Die Entstehung von Großreichen
- Neue Entwicklungen in Großstädten
- Schrift und Zahl
- Rechtswesen
- Wissenschaft
- Koordination der Teilbereiche durch den Gottkönig
- Der schnelle Zusammenbruch von Stadtstaaten und Großreichen
- 5.4 Naturbezug: Fundamentale Unterschiede zwischen Stadt und Land
- Der neue städtische Umweltbezug
- Städtische Kultur als Distanz zur Natur
- Unterschiedliche Naturvorstellungen in Stadt und Land
- Bilanz der Umweltsituation
- Urbane Transformation als Fortschritt?
- 201–216 6. Hirtennomadismus und «Achsenzeit» Die Welt als Gesamtzusammenhang 201–216
- 6.1 Hirtennomadismus und Reitervölker
- Die räumliche Verbreitung des Hirtennomadismus auf der Erde
- Hirtennomadismus als Wirtschaftsform
- Lebensformen und Naturbezug der Hirtennomaden
- Großviehnomadismus und Reitervölker
- 6.2 Die Achsenzeit und die neue Sicht auf die Welt
- Charakteristika der Achsenzeit
- Die neue Weltsicht der Achsenzeit
- Der neue Naturbezug der Achsenzeit
- 217–264 7. Der dreifache Beginn der modernen Entwicklung Vernunft als Distanz zur konkreten Welt 217–264
- 7.1 Warum ein dreifacher Beginn der modernen Entwicklung?
- Die drei Anfänge der modernen Entwicklung
- Europäischer Sonderweg
- Wissenschaftliche Disziplinen zum Verständnis dieser Entwicklung
- 7.2 Der erste Beginn in der griechischen Antike: Grundlegung
- Polis-Struktur
- Das Neue der griechischen Entwicklung
- Buchstabenschrift
- Geld
- Demokratie
- Philosophie und Logik
- Mathematik und Geometrie
- Abstrakte Abstrakta
- Orientierung am «richtigen Maß»
- 7.3 Der zweite Beginn im europäischen Mittelalter: Modifizierung
- Mittelalterliche Revolution
- Dezentralität und Kommunalismus
- Theologie und Philosophie – zwei gegensätzliche Wahrheitsansprüche
- Geldwirtschaft
- Modifikation der griechischen Abstraktionen durch das christliche Abendland
- 7.4 Der dritte Beginn in Renaissance und Aufklärung: Aufbruch
- Wiedergeburt der griechischen Abstrakta
- Naturwissenschaften
- Protestantische Ethik
- Römisches Recht
- Philosophie
- Mathematik
- Rationaler Staat
- Geld
- Soziale Disziplinierung
- Liberalismus und Demokratie
- Neun Bereiche der abstrakten Abstrakta
- 265–304 8. Industriegesellschaften Natur als Material und schöne Landschaft 265–304
- 8.1 Die doppelte Revolution in Wirtschaft und Politik
- Wirtschaftliche Revolution
- Gesellschaftliche Revolution
- Merkmale der neuen Welt
- Verselbständigung der Wirtschaft
- 8.2 Grundprinzipien des industriellen Wirtschaftens
- Beginn und Entwicklung des industriellen Wirtschaftens
- Fordismus oder Zweite Industrielle Revolution
- Ursachen für diesen Erfolg: Nutzung der fossilen Energieressourcen der Erde
- Ersetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen
- Niedrige Stückkosten durch Massenproduktion
- Selbstverstärkung durch Steigerung des materiellen Wohlstands
- Permanente Innovationen
- Der anonyme Markt als «kaltes Herz»
- Wirtschaftskrisen und Wachstumszwang
- Wirtschaftsaktivitäten außerhalb der Industrie
- 8.3 Neue Raumstrukturen: Das Ende der Fläche
- Aufblühen der Industriestädte und Industriegebiete und Massenverkehr
- Entwertung der ländlichen Räume
- Drei Typen ländlicher Entwicklung
- Das Ende der flächenhaften Nutzung
- 8.4 Industriegesellschaften als Gesellschaften der Gegensätze
- Der demographische Übergang
- Industriegesellschaften als städtische Gesellschaften mit ausgeprägten Schichten
- Ländliche Räume in Industriegesellschaften: Vormoderne Welten
- Extreme Gegensätze als «negative Einheiten»
- 8.5 Naturbezug: Sowohl Vernutzung als auch Bewunderung
- Vernutzung der Natur als Material am Werktag
- Umweltveränderungen im ländlichen Raum
- Die Bewunderung der Natur als «schöne Landschaft» am Sonntag
- Tourismus und Naturschutz
- Kompensation der werktäglichen Naturvernutzung am Sonntag
- Gesellschaften auf «tönernen Füßen»
- 305–364 9. Dienstleistungsgesellschaften Natur als Relikt in einer entgrenzten Welt 305–364
- 9.1 Die Transformation von Industrie- zu Dienstleistungsgesellschaften
- Definition der Dienstleistungsgesellschaft und damit verbundener Hoffnungen
- Definition von Dienstleistungen
- Neun Triebkräfte des Wachstums der Dienstleistungen
- 9.2 Die Entgrenzung des kapitalistischen Wirtschaftens
- II. Wirtschaftssektor
- I. Wirtschaftssektor
- III. Wirtschaftssektor
- Gesamtwirtschaftlicher Wandel durch Verkehr, Außenpolitik, wirtschaftspolitische Veränderungen und Globalisierung
- Beginn einer neuen Wirtschaftsepoche?
- Gibt es eine Zukunft für das kapitalistische Wirtschaften?
- 9.3 Die Konsumgesellschaft und das unendliche Wachstum der Bedürfnisse
- Der demographische Übergang
- Das Ende der Naturbewunderung
- Lebensstilgruppen statt sozialer Schichten
- Veränderungen der persönlichen Verhaltensweisen
- Vier neue Verhaltensweisen durch Kaufhandlungen
- Neuer Selbst- und Weltbezug durch Geld
- Gleichberechtigung der Geschlechter
- Fehlende kulturelle Selbstbegrenzung der Konsumgesellschaft
- 9.4 Sterile Lebenswelten: Raumentwicklung in Zeiten der Globalisierung
- Global Cities als «brutale Orte»
- Die Fragmentierung der Städte
- Suburbia und Postsuburbia
- Die Entwertung der ländlichen Räume
- Räumliche Veränderungen in der Dritten Welt
- Die «Zwischenstadt»
- Räumlich zersplitterte Lebenswelten
- Sterile Lebenswelten als Ergebnis abstrakter Logik
- 9.5 Naturbezug: Umweltzerstörungen als globales Phänomen
- Problematische Veränderungen aller Ökosysteme der Erde
- Neuartige Umweltprobleme: Kunststoffe, Nano- und Gentechniken
- Virtuelle Welten als Verschärfung der Umweltprobleme
- Umweltprobleme als diffuse und ubiquitäre Phänomene
- Umweltschutz als Sisyphos-Aufgabe
- Menschliche Umweltzerstörungen im Rahmen des Ökosystems Erde
- Zur Zukunft der modernen Welt
- 365–390 10. Der Beitrag der Mensch-Umwelt-Geschichte zur aktuellen Umweltkrise 365–390
- 10.1 Zentrale Erkenntnisse aus der Geschichte
- Umweltprobleme nicht von Wirtschaft und Leben trennen
- Zwei Epochen fast ohne Umweltzerstörungen
- Größere Möglichkeiten größere Gefährdungen
- Kulturelle Selbstbegrenzung als Schlüsselerkenntnis
- Verantwortung für menschlich veränderte Natur
- Beginn der globalen Umweltzerstörung erst nach 1950
- 10.2 Lösung der Umweltkrise via Transformation, Revolution oder gar nicht?
- Allmähliche Transformationen
- Plötzliche Revolutionen
- Teilzusammenbrüche der menschlichen Welt als Eröffnung von Freiräumen
- 10.3 Leitideen für einen neuen Umgang mit Natur und Umwelt
- Keine Patentrezepte
- Weder Technokratie noch Ökoromantik
- Keine neue Aufklärung
- Rückkehr zur vormodernen Welt?
- Darwin – Marx – Freud
- Aktivität statt Anpassung
- Der Einzelfall und nicht das Prinzip als Grundlage
- Das «richtige Maß» als Leitidee der Selbstbegrenzung
- Reproduktion der menschlichen veränderten Natur
- 10.4 Perspektiven für eine menschliche Welt ohne Umweltzerstörungen
- Wirtschaft als Versorgung des Menschen mit lebensnotwendigen Gütern
- Energie als wertvolle und teure Ressource
- Gesellschaft mit kultureller Selbstbegrenzung
- Individuum als Teil der Gesellschaft
- Raum als multifunktionaler Beziehungsraum
- Staaten ohne Herrschaftsansprüche
- Ausblick: Der Mensch als Homo destructor?
- 391–436 Anmerkungen 391–436
- 437–454 Literaturverzeichnis 437–454
- 455–463 Sachregister 455–463
- 464–464 Zum Buch 464–464
- 464–464 Über den Autor 464–464