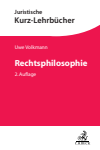Rechtsphilosophie
Zusammenfassung
Das Studienbuch gibt einen zusammenhängenden Überblick über das Grundlagenfach der Rechtsphilosophie. Dafür werden zunächst in einem ersten Teil die ideellen Fundamente der heutigen Rechtsordnung vorgestellt, so wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt und nach und nach in bestimmten obersten Prinzipien und Leitbegriffen Gestalt angenommen haben (Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit, Rechts- und Sozialstaatlichkeit etc.). Dieser Teil lässt sich dementsprechend auch als eine allgemeine Geschichte der Staatsphilosophie oder der politischen Philosophie lesen. In einem zweiten, systematischen Teil geht es sodann um den spezifischen Sinn des Rechts für unsere Zeit. Dieser wird seinerseits in vier größeren Zusammenhängen entfaltet, die ihn von je unterschiedlicher Seite her beleuchten:
-
Recht und Gewalt
-
Recht und Moral
-
Recht und Gerechtigkeit
-
Recht und Gesellschaft
Schlagworte
- I–IX Titelei/Inhaltsverzeichnis I–IX
- 1–5 Einführung: Zum Anliegen einer Rechtsphilosophie und zur Anlage dieses Buches 1–5
- 8–141 § 1. Der Rahmen des Rechts 8–141
- 8–43 A. Gemeinschaftliche Konzeptionen 8–43
- I. Antike Varianten
- 1. Ideenlehre: Platon
- 2. Entelechie: Aristoteles
- 3. Weltvernunft: Die Stoa und Cicero
- II. Theologisch-christliche Varianten
- 1. Gottesstaat: Augustinus
- 2. Glaube und Vernunft: Thomas von Aquin
- 3. Protestantismus: Martin Luther
- III. Frühneuzeitliche Varianten: Natur- und Vernunftrecht
- 43–123 B. Liberale Konzeptionen 43–123
- I. Kontraktualismus: Gesellschaftsvertrag als Begründungsmodell
- 1. Sicherheit: Thomas Hobbes
- 2. Liberale Grundrechte: John Locke
- 3. Demokratie: Jean-Jacques Rousseau
- 4. Kritik des Kontraktualismus: David Hume
- II. Klassischer Utilitarismus
- III. Transzendentalphilosophie: Immanuel Kant
- IV. Philosophie des Geistes: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- V. Neuere Diskussionsverläufe
- 1. Minimalstaatlich-libertäre Konzeptionen
- 2. Sozialegalitäre Varianten: John Rawls
- 3. Neue Gemeinschaftlichkeit: Kommunitarismus
- 4. Kommunikative Vernunft: Jürgen Habermas
- 123–133 C. Kritische Konzeptionen 123–133
- I. Muster der Ideologiekritik
- II. Poststrukturalistische Varianten
- 1. Genealogie der Macht: Michel Foucault
- 2. Dekonstruktion: Jacques Derrida
- 133–141 D. Schluss: Grundzüge gerechter politischer Ordnung heute 133–141
- I. Weitgehend konsentierte Bausteine
- II. Verkörperung in einer Verfassung
- III. Was bleibt vom Gemeinschaftsmodell?
- 144–255 § 2. Der Sinn des Rechts 144–255
- 144–153 A. Recht und Gewalt 144–153
- I. These: Recht als Zivilisierung der Gewalt
- II. Gegenthese: Recht als Gewalt
- III. Schluss: Der Ort der Gewalt im Recht
- 153–190 B. Recht und Moral 153–190
- I. Vorab:Was ist Moral und wozu ist sie gut?
- II. These: Recht als besonders gefasster Ausschnitt der Moral
- 1. Modell 1: Das klassische Naturrecht
- 2. Modell 2: Verschränkung von Recht und Moral nach Ronald Dworkin
- III. Gegenthese: Autonomie des Rechts
- 1. Modell 1: Recht als System aufeinander verweisender Zwangsnormen(Hans Kelsen)
- 2. Modell 2: Recht als soziale Praxis einer politischen Gemeinschaft (H. L. A. Hart)
- 3. Modell 3: Rechtsnormen als inhaltsunabhängige Gründe (Joseph Raz
- IV. Schluss: Der Ort der Moral im Recht
- 1. Der moralische Wert von Recht an sich
- 2. Der moralische Anspruch des Rechts
- 3. Der moralische Überbau des Rechts
- 4. Moral in der Praxis des Rechts
- 190–233 C. Recht und Gerechtigkeit 190–233
- I. Vorab: Annäherungen an Gerechtigkeit
- II. These: Recht als Konkretisierung von Gerechtigkeit
- 1. Modell 1: Die Grundformenlehre des Aristoteles
- 2. Modell 2: Formale Gerechtigkeit
- 3. Modell 3: Die Menschenrechtskonzeption der Gerechtigkeit
- III. Gegenthese: Die Unmöglichkeit der Gerechtigkeit
- 1. Modell 1: Amoralisches Recht
- 2. Modell 2: Instrumentelles Recht
- 3. Modell 3: Effizientes Recht (Ökonomische Rechtstheorie)
- IV. Schluss: Der Ort der Gerechtigkeit im Recht
- 1. Gerechtigkeit als beständige Rückfrage an das Recht
- 2. Gerechtigkeit als notwendige Utopie des Rechts
- 3. Gerechtigkeit als Einheitssymbol der Rechtsordnung
- 4. Gerechtigkeit in der Praxis des Rechts
- 233–255 D. Recht und Gesellschaft 233–255
- I. These: Recht als Steuerungsinstrument für das Gemeinwohl
- 1. Modell 1: Recht als Summe verschiedenster Normen
- 2. Modell 2: Recht als Form gesellschaftlicher Planung
- II. Gegenthese: Normativer Reduktionismus
- 1. Modell 1: Reduktionismus der Ziele
- 2. Modell 2: Reduktionismus der Mittel
- III. Schluss: Zur Bedeutung des Rechts für die Gesellschaft
- 1. Recht als Medium der Organisation von Gesellschaft
- 2. Recht als Medium der Selbstbeschreibung einer Gesellschaft
- 3. Auflösung des Rechtsbegriffs?
- 255–263 Personenglossar 255–263
- 263–277 Literaturverzeichnis 263–277
- 277–280 Sachregister 277–280