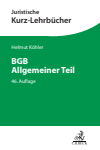BGB Allgemeiner Teil
Ein Studienbuch
Zusammenfassung
Das Standardwerk zum Allgemeinen Teil des BGB ist klar und einprägsam geschrieben und konzentriert sich auf die prüfungsrelevanten Themen. Prägnante Merksätze und viele Fallbeispiele machen den Band zur perfekten Lernhilfe. Am Ende des Buches weist eine Einführung in die zivilrechtliche Klausurtechnik den richtigen Weg zur Lösung anspruchsvoller Fälle.
Der Band behandelt:
-
Einführung in das Privatrecht, Rechtsanwendung und Gesetzesauslegung
-
Rechtsgeschäft, Willenserklärung, Vertrag
-
Zustimmung, Bedingung, Befristung
-
Allgemeine Geschäftsbedingungen
-
Anspruch, Einwendung, Einrede
-
Rechtssubjekte und Rechtsobjekte
Für die Neuauflage wurde das Werk auf den aktuellen Rechtsstand gebracht. Berücksichtigt wurden ua die Auswirkungen des MoPeG, G. zur Vereinheitlichung des StiftungsR, G. über digitale Produkte (§§ 327 - 327u BGB).
- I–XXIV Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXIV
- 1–33 1. Kapitel. Einführung in das Privatrecht 1–33
- 1–5 § 1. Recht und Rechtsquellen 1–5
- I. Das Recht
- 1. Die Struktur des Rechts
- 2. Die Aufgabe des Rechts
- II. Die Rechtsquellen
- 1. Rechtsprinzip und Rechtssatz
- 2. Gesetztes Recht und Gewohnheitsrecht
- 3. Richterrecht und Verkehrssitte
- 5–9 § 2. Privatrecht und öffentliches Recht 5–9
- I. Die Abgrenzung und ihre Bedeutung
- II. Die Einteilung des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- 1. Die Gebiete des Privatrechts
- 2. Die Gebiete des öffentlichen Rechts
- III. Das Zusammenwirken von Privatrecht und öffentlichem Recht
- 9–25 § 3. Das bürgerliche Recht 9–25
- I. Das Bürgerliche Gesetzbuch als Grundlage des bürgerlichen Rechts
- 1. Die Entstehung des BGB
- 2. Die geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen des BGB
- 3. Aufbau und Inhalt des BGB
- 4. Sprache und Regelungstechnik des BGB
- 5. Inhaltliche Einteilung der Normen des BGB
- II. Die Fortentwicklung des bürgerlichen Rechts
- 1. Das Kaiserreich
- 2. Die Weimarer Republik
- 3. Die nationalsozialistische Herrschaft
- 4. Die Besatzungszeit
- 5. Die Entwicklung in der ehemaligen DDR
- 6. Die Entwicklung in der Bundesrepublik
- 7. Der Einfluss des Unionsrechts auf das Bürgerliche Recht
- III. Der Geltungsbereich des Bürgerlichen Gesetzbuchs
- 1. Der sachliche Geltungsbereich
- 2. Der zeitliche Geltungsbereich
- 3. Der räumliche Geltungsbereich
- 25–33 § 4. Anwendung, Auslegung und Fortbildung des Privatrechts 25–33
- I. Die Rechtsanwendung im Allgemeinen
- 1. Ermittlung eines für den Lebenssachverhalt in Betracht kommenden Rechtssatzes
- 2. Prüfung, ob der Lebenssachverhalt den Tatbestand der Rechtsnorm erfüllt (Subsumtion)
- 3. Feststellung der sich daraus ergebenden Rechtsfolge
- II. Die Rechtsanwendung im Prozess
- 1. Die Stellung des Richters
- 2. Die Aufgabe des Richters im Prozess
- III. Die Gesetzesauslegung
- 1. Die Notwendigkeit der Gesetzesauslegung
- 2. Das Ziel der Gesetzesauslegung
- 3. Die Methoden der Gesetzesauslegung
- 4. Die Berücksichtigung übergeordneter Rechtsnormen bei der Auslegung
- IV. Die Rechtsfortbildung
- 1. Ausfüllung von Gesetzeslücken
- 2. Gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung
- 33–251 2. Kapitel. Die Rechtsgeschäftslehre 33–251
- 33–48 § 5. Grundlagen und Grundbegriffe der Rechtsgeschäftslehre 33–48
- I. Der Grundsatz der Privatautonomie
- 1. Die Bedeutung der Privatautonomie
- 2. Die Schranken der Privatautonomie
- II. Die Lehre vom Rechtsgeschäft und von der Vertrauenshaftung
- III. Die Grundbegriffe der Rechtsgeschäftslehre
- 1. Begriff und Bedeutung des Rechtsgeschäfts
- 2. Tatbestand und Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts
- 3. Geschäftsähnliche Handlung und Realakt
- IV. Die Einteilung der Rechtsgeschäfte
- 1. Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte
- 2. Rechtsgeschäfte unter Lebenden und von Todes wegen
- 3. Vermögensrechtliche und personenrechtliche Rechtsgeschäfte
- 4. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte
- 5. Treuhandgeschäfte
- 6. Verbraucherverträge
- 48–65 § 6. Die Willenserklärung 48–65
- I. Begriff und Arten der Willenserklärung
- 1. Der Begriff der Willenserklärung
- 2. Die Arten der Willenserklärung
- II. Das Wirksamwerden der Willenserklärung
- 1. Grundsatz
- 2. Empfangsbedürftige und nichtempfangsbedürftige Willenserklärungen
- 3. Die Abgabe der Willenserklärung
- 4. Der Zugang der Willenserklärung
- 65–102 § 7. Die Willensmängel 65–102
- I. Überblick
- II. Fehlen des Handlungswillens, des Erklärungsbewusstseins und des Geschäftswillens
- 1. Fehlen des Handlungswillens
- 2. Fehlen des Erklärungsbewusstseins
- 3. Fehlen des Geschäftswillens
- III. Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft und nichternstliche Erklärung
- 1. Der geheime Vorbehalt (§ 116 BGB)
- 2. Das Scheingeschäft (§ 117 BGB)
- 3. Die nichternstliche Erklärung (§ 118 BGB)
- IV. Der Irrtum
- 1. Allgemeines
- 2. Die einzelnen Irrtumstatbestände
- 3. Abgrenzungsfragen
- 4. Einschränkungen der Anfechtbarkeit
- 5. Die Anfechtung und ihre Folgen
- V. Die arglistige Täuschung und widerrechtliche Drohung
- 1. Allgemeines
- 2. Die arglistige Täuschung
- 3. Die widerrechtliche Drohung
- 4. Rechtsfolgen der Willensbeeinflussung durch arglistige Täuschung und widerrechtliche Drohung
- VI. Allgemeine Regelungen zur Anfechtung
- 1. Begriff der Anfechtbarkeit und der Anfechtung
- 2. Voraussetzungen der Anfechtung
- 3. Anfechtungsrecht, Anfechtungserklärung, Anfechtungsgegner
- 4. Die Wirkungen der Anfechtung
- 5. Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts (§ 144 BGB)
- 102–129 § 8. Der Vertrag 102–129
- I. Allgemeines
- 1. Funktion, Begriff und Arten des Vertrages
- 2. Das Zustandekommen des Vertrages
- 3. Vertragsverhandlungen und Vertragsverhältnis
- II. Das Angebot
- 1. Die Voraussetzungen des Angebots
- 2. Rechtsfolgen des Angebots
- III. Die Annahme
- 1. Begriff und Bedeutung der Annahme
- 2. Erklärung der Annahme
- 3. Annahme durch „sozialtypisches Verhalten“
- 4. „Auftragsbestätigung“ und „kaufmännisches Bestätigungsschreiben“
- IV. Sonderregelungen für den Widerruf einer Vertragserklärung
- 1. Die verbraucherschützenden Widerrufsrechte
- 2. Widerrufserklärung, Widerrufsfrist und Widerrufsbelehrung
- 3. Rechtsnatur und Rechtsfolgen des Widerrufs
- V. Der Einigungsmangel (Dissens)
- 1. Die Einigung als Wesensmerkmal des Vertrages
- 2. Der offene Dissens
- 3. Der versteckte Dissens
- VI. Vertragsfreiheit und Kontrahierungszwang
- VII. Vorvertrag und Optionsvertrag
- 1. Der Vorvertrag
- 2. Der Optionsvertrag
- 3. Exkurs: Die Festofferte
- VIII. Der Vertragsschluss im Internet
- 1. Einführung
- 2. Das Zustandekommen des Vertrages im Internet
- 3. Wirksamkeit von Willenserklärungen
- 129–138 § 9. Die Auslegung des Rechtsgeschäfts 129–138
- I. Begriff und Bedeutung der Rechtsgeschäftsauslegung
- II. Auslegungsgegenstand und Auslegungsmittel
- III. Auslegungsziele
- 1. Die möglichen Auslegungsziele und die Bedeutung der Interessenlage
- 2. Die Auslegung von Testamenten
- 3. Die Auslegung von empfangsbedürftigen Willenserklärungen
- 4. Die Auslegung von Erklärungen an die Allgemeinheit
- IV. Einzelne allgemeine Auslegungsgrundsätze
- 1. Das Verbot der Buchstabenauslegung
- 2. Das Gebot der Berücksichtigung von Treu und Glauben und der Verkehrssitte (§ 157 BGB)
- 3. Der Vorrang des übereinstimmend Gewollten
- 4. Die Auslegung formbedürftiger Erklärungen
- V. Die ergänzende Vertragsauslegung
- 1. Vorrang der Vertragsergänzung durch dispositives Recht
- 2. Anwendungsbereich und Funktion der ergänzenden Vertragsauslegung
- 3. Ergänzende Vertragsauslegung und Grundsätze über die Geschäftsgrundlage
- 138–154 § 10. Die Geschäftsfähigkeit 138–154
- I. Geschäftsfähigkeit, Geschäftsunfähigkeit, beschränkte Geschäftsfähigkeit und Betreuung
- 1. Die Geschäftsfähigkeit
- 2. Die Geschäftsunfähigkeit
- 3. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit
- 4. Die Betreuung
- II. Die Rechtsfolgen der Geschäftsunfähigkeit
- III. Die Rechtsfolgen der beschränkten Geschäftsfähigkeit
- 1. Die Abgrenzung von zustimmungsfreien und zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften
- 2. Die Einwilligung
- 3. Die Rechtsfolgen fehlender Einwilligung
- 4. Die Handels- und Arbeitsmündigkeit
- 5. Die datenschutzrechtliche Einwilligung durch Minderjährige
- 154–190 § 11. Die Vertretung 154–190
- I. Allgemeines
- 1. Begriff und Funktion der Vertretung
- 2. Voraussetzungen und Folgen der Vertretung
- 3. Zulässigkeit der Vertretung
- 4. Anwendungsbereich der Vertretung
- 5. Abgrenzung
- II. Das Handeln in fremdem Namen
- 1. Abgabe einer eigenen Willenserklärung (Abgrenzung zum Boten)
- 2. Auftreten in fremdem Namen (Offenkundigkeitsprinzip)
- 3. Das „verdeckte Geschäft für den, den es angeht“
- 4. Die „mittelbare Stellvertretung“
- 5. Das „Handeln unter fremdem Namen“
- III. Die Vollmacht
- 1. Begriff und Erteilung der Vollmacht
- 2. Vollmacht und Innenverhältnis
- 3. Form der Vollmacht und Vertretergeschäft
- 4. Vollmacht und Willensmängel
- 5. Erlöschen der Vollmacht
- IV. Die Vollmacht kraft Rechtsscheins, insbesondere die Duldungs- und Anscheinsvollmacht
- 1. Gesetzlich geregelte Fälle der Rechtsscheinvollmacht
- 2. Duldungs- und Anscheinsvollmacht
- 3. Weitere Voraussetzungen der Rechtsscheinvollmacht
- V. Das Vertretergeschäft
- 1. Auslegung
- 2. Willensmängel
- 3. Kennen und Kennenmüssen von Umständen
- 4. Erweiterte Wissenszurechnung
- VI. Umfang und Grenzen der Vertretungsmacht
- 1. Der Umfang der Vertretungsmacht
- 2. Einzel- und Gesamtvertretung
- 3. Der Missbrauch der Vertretungsmacht und die Kollusion
- 4. Das Insichgeschäft
- VII. Handeln ohne Vertretungsmacht
- 1. Die Folgen für das Vertretergeschäft
- 2. Die Haftung des Vertreters (§ 179 BGB)
- 3. Das Verhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem
- 4. Das Verhältnis zwischen Vertretenem und Drittem
- 190–200 § 12. Die Form des Rechtsgeschäfts 190–200
- I. Die Formfreiheit als Grundsatz
- II. Gesetzliche und gewillkürte Form
- III. Die Formzwecke
- IV. Die Arten der Form
- 1. Die schriftliche Form (§§ 126, 127 BGB)
- 2. Die elektronische Form (§§ 126a, 127 Abs. 1, 3 BGB)
- 3. Die Textform (§§ 126b, 127 Abs. 1 BGB)
- 4. Die öffentliche Beglaubigung (§ 129 BGB)
- 5. Die notarielle Beurkundung (§§ 127a, 128 BGB)
- V. Die Nichteinhaltung gesetzlicher Formvorschriften
- 1. Nichtigkeit als Folge des Formverstoßes
- 2. Heilung des Formmangels
- 3. Unbeachtlichkeit der Formverletzung aus Billigkeitsgründen?
- VI. Nichteinhaltung der gewillkürten Form
- 200–217 § 13. Der Inhalt des Rechtsgeschäfts 200–217
- I. Allgemeines
- 1. Einschränkungen der rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmacht
- 2. Einschränkungen der inhaltlichen Gestaltungsfreiheit
- II. Der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB)
- 1. Allgemeines
- 2. Vorliegen eines Verbotsgesetzes
- 3. Rechtsfolgen
- 4. Die Gesetzesumgehung
- III. Der Verstoß gegen die guten Sitten (§ 138 BGB)
- 1. Der Begriff der „guten Sitten“
- 2. Die Feststellung der Sittenwidrigkeit
- 3. Fallgruppen
- 4. Die Rechtsfolgen der Sittenwidrigkeit
- IV. Das Wuchergeschäft (§ 138 Abs. 2 BGB)
- 1. Der Tatbestand des Wuchergeschäfts
- 2. Die Rechtsfolgen
- 217–229 § 14. Zustimmung, Bedingung und Befristung 217–229
- I. Die Zustimmung
- 1. Begriff und Bedeutung der Zustimmung
- 2. Einzelheiten zur Zustimmung
- 3. Die Verfügung eines Nichtberechtigten
- 4. Die „Ermächtigung“
- II. Die Bedingung
- 1. Begriff und Bedeutung der Bedingung
- 2. Die Zulässigkeit der Bedingung
- 3. Die Wirksamkeit der Bedingung
- 4. Die Wirkungen der Bedingung
- III. Die Befristung
- IV. Exkurs: Die Berechnung von Fristen und Terminen
- 229–237 § 15. Das unwirksame Rechtsgeschäft 229–237
- I. Die Nichtigkeit
- 1. Begriff und Bedeutung der Nichtigkeit
- 2. Die Teilnichtigkeit (§ 139 BGB)
- 3. Die Umdeutung (§ 140 BGB)
- 4. Die Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts (§ 141 BGB)
- II. Die schwebende Unwirksamkeit
- III. Die relative Unwirksamkeit
- IV. Nichtigkeit und Gestaltungsrechte
- 237–251 § 16. Die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 237–251
- I. Allgemeines
- II. Der Begriff der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“
- 1. Die gesetzliche Definition (§ 305 Abs. 1 S. 1 BGB)
- 2. Abgrenzung zur Individualabrede (§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB)
- III. Sonderregelung für Verbraucherverträge
- 1. Begriff des „Verbrauchervertrags“
- 2. Kontrolle von „Drittbedingungen“ (§ 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB)
- 3. Kontrolle von „Einmalbedingungen“ (§ 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB)
- 4. Erweiterte Inhaltskontrolle (§ 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB)
- IV. Die Einbeziehung von AGB in den Vertrag
- 1. Die Einbeziehungsvereinbarung
- 2. Exkurs: Kollidierende AGB
- V. Überraschende Klauseln
- VI. Die Auslegung von AGB
- 1. Der Grundsatz der objektiven Auslegung
- 2. Der Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB)
- 3. Die Unklarheitenregel (§ 305c Abs. 2 BGB)
- VII. Die Inhaltskontrolle von AGB und das Umgehungsverbot
- 1. Die Inhaltskontrolle von AGB
- 2. Das Umgehungsverbot
- VIII. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von AGB
- 251–276 3. Kapitel. Das subjektive Recht 251–276
- 251–261 § 17. Rechtsverhältnis und subjektives Recht 251–261
- I. Das Rechtsverhältnis
- 1. Begriff
- 2. Inhalt
- 3. Entstehen, Änderung und Ende
- II. Das subjektive Recht
- 1. Begriff und Bedeutung
- 2. Arten
- 3. Erwerb und Verlust
- 4. Die Rechtsausübung
- 5. Grenzen der Rechtsausübung
- III. Pflichten und Obliegenheiten
- 1. Pflichten
- 2. Obliegenheiten
- 261–269 § 18. Anspruch, Einwendung und Einrede 261–269
- I. Anspruch
- 1. Begriff und Bedeutung des Anspruchs
- 2. Arten des Anspruchs
- 3. Anspruchsgrundlage
- 4. Allgemeine Regeln
- 5. Mehrheit von Ansprüchen und Anspruchsgrundlagen
- II. Einwendungen und Einreden
- 1. Einwendungen
- 2. Einreden
- 3. Berücksichtigung von Einwendung und Einrede im Prozess
- III. Die Einrede der Verjährung
- 1. Begriff und Zweck der Verjährung
- 2. Anwendungsbereich der Verjährung
- 3. Verjährungsfristen
- 4. Beginn der Verjährung
- 5. Verjährungshindernisse
- 6. Wirkungen der Verjährung
- 7. Regelung der Verjährung durch Rechtsgeschäft
- 269–276 § 19. Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz 269–276
- I. Der staatliche Rechtsschutz
- 1. Erkenntnisverfahren
- 2. Vollstreckungsverfahren
- 3. Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
- II. Selbstverteidigung (Notwehr, Notstand) und Selbsthilfe
- 1. Überblick
- 2. Notwehr
- 3. Notstand
- 4. Selbsthilfe (§§ 229-231 BGB)
- 276–301 4. Kapitel. Die Rechtssubjekte 276–301
- 276–283 § 20. Die natürlichen Personen 276–283
- I. Der Mensch als Rechtssubjekt
- II. Die Rechtsfähigkeit des Menschen
- 1. Begriff und Bedeutung der Rechtsfähigkeit
- 2. Beginn der Rechtsfähigkeit
- 3. Ende der Rechtsfähigkeit
- 4. Beweisfragen und Todeserklärung
- 5. Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit
- 6. Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit
- III. Der Wohnsitz
- 1. Begriff und Bedeutung
- 2. Gewählter und gesetzlicher Wohnsitz
- IV. Name und Namensschutz
- 1. Begriff und Arten des Namens
- 2. Das Namensrecht
- 3. Der Schutz des Namens
- 4. Die Ausdehnung des Namensschutzes
- V. Der allgemeine Persönlichkeitsschutz
- 283–301 § 21. Juristische Personen 283–301
- I. Allgemeines
- 1. Begriff und Bedeutung
- 2. Arten und Entstehung der juristischen Person
- 3. Die Relativierung der juristischen Person
- II. Der rechtsfähige Verein
- 1. Entstehung
- 2. Mitgliedschaft
- 3. Organisation und Willensbildung
- 4. Vertretung und Haftung
- 5. Haftung von Vorstandsmitgliedern
- 6. Erlöschen, Auflösung und Verlust der Rechtsfähigkeit des Vereins
- III. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit
- 1. Rechtsentwicklung
- 2. Teilnahme am Rechtsverkehr
- 3. Rechtsverfolgung gegen und durch den Verein
- 4. Haftung
- IV. Die Stiftung
- 1. Begriff und Bedeutung
- 2. Entstehen, Verfassung und Erlöschen der Stiftung
- 301–315 5. Kapitel. Die Rechtsobjekte 301–315
- 301–305 § 22. Rechtsobjekt, Vermögen und Unternehmen 301–305
- I. Die Rechtsobjekte
- 1. Begriff und Bedeutung
- 2. Abgrenzung
- II. Das Vermögen
- 1. Begriff
- 2. Bedeutung
- III. Das Unternehmen
- 1. Begriff
- 2. Bedeutung
- 305–314 § 23. Sache, Bestandteil, Zubehör und Nutzungen 305–314
- I. Die Sachen
- 1. Begriff und Abgrenzung
- 2. Arten
- II. Einzelsache und Sachgesamtheit
- III. Die Bestandteile
- 1. Begriff
- 2. Arten
- 3. Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung
- IV. Das Zubehör
- 1. Begriff
- 2. Rechtliche Bedeutung
- V. Nutzungen, Früchte und Lasten
- 1. Begriffe
- 2. Bedeutung
- 314–315 § 24. Digitale Produkte 314–315
- I. Begriff und Beispiele
- II. Vertragsrechtliche Regelungen
- 315–323 Anhang. Technik der Fallbearbeitung 315–323
- 315–317 I. Vorbereitung der Niederschrift 315–317
- 317–320 II. Aufbau und Gestaltung der Niederschrift 317–320
- 320–323 III. Muster eines Falles mit Lösung 320–323
- 323–328 Sachverzeichnis 323–328