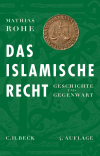Das islamische Recht
Geschichte und Gegenwart
Zusammenfassung
Das islamische Recht ist im Westen durch spektakuläre Todesurteile und drakonische Körperstrafen in Verruf geraten, ansonsten aber weitgehend unbekannt. Was ist die Scharia? Was ist eine Fatwa? Kann es im Islam eine Gleichberechtigung der Geschlechter geben? Diese und andere Fragen behandelt Mathias Rohe in der ersten umfassenden Darstellung des islamischen Rechts seit Jahrzehnten.
Erstmals beschreibt in diesem Buch ein islamwissenschaftlich geschulter Jurist Entstehung, Entwicklung und gegenwärtige Ausformung des islamischen Rechts. Mathias Rohe erläutert die wichtigsten islamischem Rechtsquellen und Rechtsfindungsmethoden und schildert die Regelungsbereiche des klassischen islamischen Rechts: Ehe- und Familienrecht, Erbrecht, Vertrags- und Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Eigentumsrecht, Strafrecht, Staats- und Verwaltungsrecht, Fremden- und Völkerrecht. Dabei kommen auch grundlegende Unterschiede zwischen Sunniten, Schiiten und anderen Richtungen zur Sprache. Sein besonderes Augenmerk gilt den Regelungen für Muslime in einer nichtislamischen Umgebung, vor allem in Deutschland. Ein Ausblick auf Perspektiven des islamischen Rechts in einer globalisierten Welt beschließt das bewährte Standardwerk.
- II–XV Titelei/Inhaltsverzeichnis II–XV
- XVI–XVII Vorwort XVI–XVII
- XVIII–XX Vorwort zur vierten Auflage und Dank XVIII–XX
- 1–18 Einführung. Islam, «Scharia» und Recht 1–18
- I. Zu diesem Buch
- II. «Scharia» und Recht
- 19–164 Erster Teil. Die Geschichte des islamischen Rechts 19–164
- I. Die Entstehung des islamischen Staates und seiner Rechtsordnung
- 1. Anfänge
- 2. Die Trennung zwischen Sunniten und Schiiten
- 3. Die Herausbildung von Rechtsschulen und Rechtsinstitutionen
- 4. Gerichte und Rechtsgelehrte im Staatsgefüge
- 5. Die Beweisführung vor Gericht
- 6. Weitere Verwaltungsinstanzen
- II. Die Entwicklung einer islamrechtlichen Dogmatik – Die Lehre von den Rechtsquellen und den Methoden der Rechtsfindung (uṣūl al-fiqh)
- 1. Einführung
- 2. Der Koran
- 3. Die Sunna des Propheten
- 4. Der Konsens der Rechtsgelehrten (Idschma)
- 5. Der Analogieschluss und weitere Schlussverfahren (qίyās)
- 6. Das «Für-besser-Halten» (istiḥsān)
- 7. Die Berücksichtigung allgemeinen Nutzens (istiḥsāḥ, al-maṣāliḥ al-mursala)
- 8. Die Auffassungen der (einzelnen) Prophetengenossen (maḏhab al-ṣaḥābῑ)
- 9. Gewohnheitsrecht (Ꜥurf) und Brauch (Ꜥāda)
- 10. Das «Versperren der Mittel» (sadd al-ḏarāˀἱꜤ)
- 11. «Fortbestand» ( istiṣḥāb) und «Normen derer vor uns» ( šarꜤ man qablanā)
- III. Urteile und Gutachten
- IV. Die Regelungsbereiche des klassischen islamischen Rechts im Überblick
- 1. Einführung; Theorie und Praxis
- 2. Personenstands-, Ehe- und Familienrecht
- a) Einführung; Grundlagen
- b) Eherecht
- aa) Einführung
- bb) Die Voraussetzungen der Eheschließung
- cc) Die Form der Eheschließung; Beteiligte
- dd) Die Brautgabe (mahr, ṣadāq); Eheverträge
- ee) Die Folgen des Fehlens einzelner Wirksamkeitsvoraussetzungen
- ff) Rechte und Pflichten der Ehegatten
- gg) Die Beendigung der Ehe
- hh) Kindschaftsrecht
- ii) Unterhaltsrecht
- 3. Erbrecht
- a) Grundlagen
- b) Das Geschlechterverhältnis
- c) Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten
- d) Interreligiöse Fragen
- 4. Vertrags- und Wirtschaftsrecht
- a) Grundlagen
- b) Grundzüge des Vertragsrechts; Gestaltungsfreiheit und ihre Grenzen
- c) Vertragstypen und Mechanik des Vertragsschlusses
- d) Zustandekommen und Bindungswirkung von Verträgen
- e) Inhaltskontrolle und Umgehungsgeschäfte (ḥiyal)
- aa) Das Verbot von (Wucher-)Zinsen (ribā)
- bb) Das Verbot von Spekulationsgeschäften (ġarar)
- cc) Das Verbot des Hortens (iḥtikār)
- dd) Sonstige Verbote
- ee) Rechtskniffe (ḥiyal) als Methode zur Deckung wirtschaftlicher Bedürfnisse
- 5. Gesellschaftsrecht
- 6. Eigentumsrecht
- 7. Strafrecht und Deliktsrecht
- a) Einführung
- b) Die koranischen Delikte (ḥudūd)
- aa) Einführung
- bb) Gewaltsamer Straßenraub
- cc) Unzucht
- dd) Falsche Bezichtigung der Unzucht
- ee) Alkoholkonsum
- ff) Das Beispiel Diebstahl
- gg) Apostasie
- hh) Die Rechtspraxis
- c) Das nicht-koranische Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht (taꜤzīr)
- d) Das Talionsrecht (qiṣāṣ)
- 8. Staats- und Verwaltungsrecht
- a) Einführung
- b) Grundfragen des Staatsrechts
- c) Verwaltungsrecht
- 9. Fremden- und Völkerrecht
- a) Einführung
- b) Rahmenbedingungen und Rechtsquellen
- c) Rechtsbeziehungen zu nicht von Muslimen beherrschten Gebieten und Rechtsverhältnisse der dort befindlichen Muslime
- d) Rechtsverhältnisse nicht-muslimischer Personen und Gemeinschaften auf muslimisch beherrschtem Territorium
- aa) Personen mit Daueraufenthalt
- bb) Personen mit vorübergehendem Aufenthalt
- e) Muslime in nicht-muslimischen Herrschaftsgebieten
- 10. Abgabenrecht und fromme Stiftungen (auqāf)
- 165–276 Zweiter Teil. Modernes islamisches Recht 165–276
- I. Weiterentwicklung und Umsturz seit dem 13./19. Jahrhundert
- 1. Einführung
- 2. Rahmenbedingungen, Motive und Wege von Reformen
- II. Methoden der Weiterentwicklung und Anwendungsbeispiele
- 1. Formalisierung von Recht und Rechtsanwendung nach staatlichen Vorgaben
- a) Kodifikation
- b) Schaffung von Institutionen/Gerichtsorganisation
- c) Weiterbildung materiellen Rechts durch Form- und Verfahrensvorschriften
- 2. Inhaltliche Definitionen und Festlegungen im Rahmen der Verwaltungskompetenz (siyāsa)
- 3. Schweigen des Gesetzgebers im Rahmen der Kodifikation und Schweigen des Rechtsanwenders
- 4. Reform auf der Grundlage neuer oder wiedererschlossener Quellenfindungs- und Interpretationsmethoden
- a) Auswahl (taḫaiyur) und Verschmelzung (talfīq) von Lehrmeinungen
- b) Weiterbildung materiellen Rechts durch neues juristisches Raisonnement (fatḥ bāb al-iğtihād)
- c) Neuinterpretation des Rechts unter Berücksichtigung seiner Genese (asbāb al-nuzūl und historisch-kritische Auslegung) und Ratio (maṣlaḥa)
- 5. Weiterentwicklung «von unten» und gegenläufige Tendenzen
- 6. «Revolutionäre» Veränderungen
- III. Kernbereiche modernen islamischen Rechts
- 1. Personenstands-, Familien- und Erbrecht
- a) Einführung
- b) Personalrechtssystem
- c) Heiratsmindestalter
- d) Informelle Ehen und Verlöbnis
- e) Freiwilligkeit der Eheschließung
- f) Formvorschriften und ihre Bedeutung
- g) Präzisierung ehelicher Rechte und Pflichten
- h) Polygamie
- i) Exemplarisch: Reform der Ehescheidung
- aa) Einseitiges Scheidungsrecht des Ehemannes
- bb) Gesetzliche Scheidungsrechte der Ehefrau
- j) Eheverträge
- k) Vermögens- und Personensorgerecht
- l) Unterhaltsrecht
- m) Abstammung
- n) Erbrecht
- 2. Vertrags- und Wirtschaftsrecht; Deliktsrecht
- a) Einführung
- b) Spezifisch islamrechtliche Fragen des Vertrags- und Wirtschaftsrechts
- c) Religiöse Aspekte des Wirtschaftens
- 3. Staats- und Verwaltungsrecht
- a) Einführung
- b) Staatsorganisation und Rechtsstaatlichkeit
- c) Frauen in Staats- und Verwaltungsämtern
- d) Die Stellung religiöser Minderheiten
- e) Internationale Rechtsbeziehungen
- 4. Strafrecht
- a) Grundlegendes
- b) Exemplarisch: Die Haltung zur Apostasie
- c) «Ehrschutzdelikte»
- 277–402 Dritter Teil. Wege des islamischen Rechts in der Diaspora 277–402
- I. Einführung
- II. Das Beispiel Indien: ein ehemals muslimisch beherrschtes Territorium
- 1. Einführung
- 2. Rechtliche Rahmenbedingungen
- a) Einführung
- b) Bereiche der Anwendung islamischer Normen
- c) Inhalte indisch-muslimischer Rechts- und Reformdebatten
- aa) Einführung
- bb) Eherecht
- cc) Unterhaltsrecht
- dd) Erbrecht
- ee) Recht der frommen Stiftungen
- ff) Wirtschaftsrecht
- gg) Schlichtungsinstanzen und Scharia-Gerichte
- hh) Optionales vereinheitlichtes Recht
- 3. Ergebnis
- III. Das Beispiel Kanada: ein klassisches Einwanderungsland
- 1. Einführung
- 2. Der rechtliche Rahmen für die Anwendung islamrechtlicher Normen in Kanada
- a) Einführung
- b) Internationale Privatrechtsfälle
- c) Dispositives Sachrecht
- d) Schiedswesen
- aa) Einführung
- bb) Allgemeine Diskussion über Vorzüge und Nachteile außergerichtlicher religiöser Streitschlichtung
- cc) Spezifische rechtlich-inhaltliche Fragestellungen
- IV. Das Beispiel Deutschland (mit Ausblick auf andere europäische Staaten)
- 1. Einführung
- 2. Anwendung islam-religiöser Normen in Deutschland und Europa
- a) Öffentliches Recht
- b) Strafrecht
- c) Bürgerliches Recht
- 3. Anwendung islamrechtlicher Normen
- a) Internationales Privatrecht
- aa) Einführung
- bb) Maßstäbe für die Begrenzung islamrechtlicher Vorschriften durch den ordre public: Das Beispiel der Ehescheidung
- cc) Heiratsmindestalter und Ehevormundschaft
- dd) «Handschuhehe»
- ee) Vorschriften/Vereinbarungen über die Brautgabe
- ff) Interreligiöse Ehehindernisse
- gg) Ehe auf Zeit
- hh) Polygamie
- ii) Unterhalt
- jj) Vormundschaft/Sorgerecht
- kk) Adoption Minderjähriger
- ll) Erbrecht
- mm) Schlussbetrachtung
- b) Dispositives Sachrecht im Bereich des Zivil- und Wirtschaftsrechts
- c) Internationaler Wirtschaftsverkehr
- d) Inkorporation islamrechtlicher Normen in die staatliche Rechtsordnung
- e) Informelle/außergerichtliche Anwendung
- 4. Grundhaltungen von Muslimen zur geltenden Rechtsordnung
- 403–414 Vierter Teil. Perspektiven des islamischen Rechts in einer globalisierten Welt 403–414
- I. Zwischen Säkularisierung, Reislamisierung und Teilreform
- II. Schluss: Auf der Suche nach neuen Zugängen
- 415–636 Anhang 415–636
- Der Aufbau deskitāb al-mabsūţ fī l-furū des hanafitischen Juristen al-Saraḫsī (gest. 483/1090)
- Hinweise zu Umschrift und Aussprache
- Abkürzungen
- Anmerkungen
- Literatur
- Glossar
- Personenregister
- Sachregister