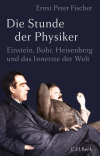Die Stunde der Physiker
Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt
Zusammenfassung
In den 1920er Jahren schlug die Stunde der Physiker: Ernst Peter Fischer, Autor des Bestsellers «Die andere Bildung», erzählt so anekdotenreich wie wissenschaftlich anschaulich und versiert vom großen Jahrzehnt der Physik zwischen 1922 und 1932, von seinen genialen Protagonisten und den ungeheuren Folgen, die die völlig neue und auf den ersten Blick verrückte Theorie der Atome und der Materie mit sich bringen sollte.
In den 1920er Jahren schlug die Stunde der Physiker: Sie machten sich auf den Weg zu den Atomen im Innersten der Welt. Dabei sahen sie sich gezwungen, das gewohnte Weltbild vollkommen aufzugeben. Zu den Pionieren der neuen Physik gehörten die Freunde Max Planck und Albert Einstein, die in den 1920er Jahren in Berlin lebten. Zu ihnen gesellten sich weitere Ausnahme-Physiker: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac. Insbesondere Heisenberg agierte als ungeheuer kreativer Kopf, dem unentwegt verrückte physikalische Ideen in den Sinn kamen, die in vielen Fällen von Pauli gnadenlos zerfetzt wurden. Die schließlich ausgearbeitete Form der Wissenschaft feiert seitdem unter der Bezeichnung «Quantenmechanik» Triumphe. Ihr Clou sind nicht nur die elektronischen Geräte mit ihren grandiosen kommunikativen Möglichkeiten, die wir heute so selbstverständlich nutzen. Ihr Clou ist auch ein völlig verändertes Bild von der Welt hinter den Dingen: Es gibt nur Bewegung, im Wirklichen genauso wie im Wissen und Denken. Und überall hält die Energie mit ihren Wandlungsmöglichkeiten das Geschehen in Gang.
- 2–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–8
- 9–18 Zur Vorsicht 9–18
- 19–32 Gruppenbild mit Dame 19–32
- 35–216 Zehn Schritte durch die Zeit 35–216
- 35–58 1. Weltstars in Berlin (1900–1919) 35–58
- 59–80 2. Frühling in Kopenhagen (1912–1920) 59–80
- 81–102 3. Zwei Wunderknaben in München (1920/21) 81–102
- 103–114 4. Festspiele mit Folgen (1922–1924) 103–114
- 115–132 5. Zweideutigkeiten (1923/24) 115–132
- 133–154 6. Zur Schönheit in der Nacht (1925) 133–154
- 155–170 7. Ferien in Arosa (1926/27) 155–170
- 171–186 8. Das Ringen im Norden (1927/28) 171–186
- 187–208 9. Zwei seltsame Herren (1928/29) 187–208
- 209–216 10. Faust in Kopenhagen (1932) 209–216
- 217–228 Nachleben 1: Die schlimmen Jahre: Der Verlust der Unschuld und der Sprache 217–228
- 229–238 Nachleben 2: Die Verschränkung und ein Kinderspiel 229–238
- 239–246 Nachleben 3: Molekularbiologie im Informationszeitalter 239–246
- 247–258 Epilog: Der beleidigte gesunde Menschenverstand 247–258
- 261–288 Anhang 261–288
- 261–268 Literatur 261–268
- 269–274 Kurzbiographien 269–274
- 275–278 Glossar 275–278
- 279–280 Chronik 279–280
- 281–282 Danksagung 281–282
- 283–284 Bildnachweis 283–284
- 285–288 Personenregister 285–288
- 289–289 Zum Buch 289–289