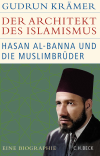Der Architekt des Islamismus
Hasan al-Banna und die Muslimbrüder
Zusammenfassung
Der Gründer der Muslimbruderschaft Hasan al-Banna (1906 - 1949) zählt zu den bedeutendsten Vordenkern und Aktivisten des Islamismus. In seinem Kampf gegen Kolonialismus, christliche Mission und Verwestlichung verknüpfte er nicht nur islamische Tradtitionen mit europäischen Ideen der Selbsthilfe und Selbstermächtigung. Er übersetzte die Idee einer islamischen Reform und Erneuerung in organisiertes, praktisches Handeln. In ihrer glänzend geschriebenen Biographie führt Gudrun Krämer eine islamische Moderne vor Augen, die bislang weithin verkannt wurde.
Die Muslimbrüder gehören seit ihrer Gründung im Jahr 1928 zu den einflussreichsten islamischen Bewegungen der Gegenwart, auf die sich islamische Aktivisten von der palästinensischen Hamas bis zur türkischen AKP beziehen. Auf der Grundlage vielfältiger, bislang kaum ausgeschöpfter arabischer Quellen zeigt Gudrun Krämer, wie Hasan al-Banna aus einem sufisch inspirierten Bildungs- und Wohltätigkeitsverein eine Massenorganisation mit Hunderttausenden von Anhängern schuf, die unter Berufung auf die Religion Politik machte. Neben einem eigenen Zweig der Muslimschwestern entstand im Schatten des Zweiten Weltkriegs auch ein Geheimapparat. Ende 1948 wurde die Muslimbruderschaft verboten, wenig später fiel al-Banna einem Attentat zum Opfer. Noch heute dient er nicht-jihadistischen Islamisten als Referenz. Gudrun Krämer erhellt die ideengeschichtlichen Grundlagen, das soziale Umfeld und den politischen Kontext der Bewegung, porträtiert Mitstreiter und Gegner und erschließt anhand der Biographie Hasan al-Bannas eindrucksvoll ein Schlüsselkapitel in der Geschichte des modernen Islam.
- 1–6 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–6
- 7–10 Vorwort 7–10
- 11–70 1. Bildung und Frömmigkeit im ländlichen Raum 11–70
- Ahmad al-Banna as-Saʿati: Der gelehrte Uhrmacher
- Kulturelle Renaissance und religiöse Reform
- Korrektur und Mahnung
- Patriotismus
- Das Lehrerseminar in Damanhur
- Die Begegnung mit dem Sufismus
- 71–120 2. Die Zeit der Orientierung 71–120
- Brüche und Übergänge
- Das Dar al-ʿUlum
- Der Turbanstreit
- Das islamische Milieu
- Die Wiederentdeckung der islamischen Klassiker
- Ahmad as-Saʿati und der Musnad des Ahmad b. Hanbal
- Islamische Vereinigungen
- «Männer machen Nationen, Mütter machen Männer»
- Die Zeitschrift al-Fath und der Verein Muslimischer Junger Männer
- 121–154 3. Baupläne: Die Muslimbrüder in Ismailiyya 121–154
- Sondierungen
- Die Gründung der Muslimbruderschaft
- Erste Erfolge
- Erste Zweifel
- 155–200 4. Grundmauern: Die Muslimbrüder in Kairo 155–200
- Neue Räume, neue Formen
- Heirat und Familie
- Die Achse der Bewegung
- Medien der Daʿwa
- Der Kampf gegen die Unmoral
- Der Kampf gegen die christliche Mission
- Der Kampf gegen den Zionismus
- 201–242 5. Ausbau: Sport, Scouts und Studenten 201–242
- Körperkultur und Pfadfindertum
- Jawwala und Kataʾib
- Rekrutierung und soziale Basis
- Schulen und Hochschulen
- Mitglieder und Zweigstellen
- 243–296 6. Design: Der Islam der Muslimbrüder 243–296
- Der Volksschullehrer als Lehrer des Volkes
- Wahrheit, Wandel, Einheit
- Salafis und Sufis
- Salafis und Wahhabis
- Erwachen, Macht und Ohnmacht
- Glaube, Wissen, Handeln
- Die Islamisierung von Staat und Gesellschaft
- 297–330 7. Umbauten: Die Phase der Gestaltung 297–330
- Die Politik der Muslimbrüder
- Palast und politische Parteien
- Die Erste Fitna und die Shabab Muhammad
- Dienstagsansprachen und al-Manar
- Der Zweite Weltkrieg
- 331–376 8. Ein Haus mit vielen Wohnungen 331–376
- Expansion
- Die Muslimschwestern
- Der Spezialapparat
- Einhegung
- Führungskrise
- 377–406 9. Einsturzgefahr: Das Ende einer Epoche 377–406
- Nationale Frage und Palästinakonflikt
- Eskalation
- Auflösung
- 407–480 Anmerkungen 407–480
- 481–500 Literatur 481–500
- 501–502 Bildnachweis 501–502
- 503–528 Register 503–528