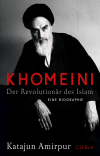Khomeini
Der Revolutionär des Islams
Zusammenfassung
Kein anderer Revolutionär hat die islamische Welt so sehr verändert wie Ruhollah Musawi Khomeini (1902 – 1989). Katajun Amirpur entdeckt in dieser ersten umfassenden Khomeini-Biographie in deutscher Sprache einen im Westen weitgehend unbekannten Gelehrten, Dichter und Mystiker und erklärt, wie es dem charismatischen Asketen gelang, den schiitischen Islam zu politisieren und den übermächtigen Westen in Angst und Schrecken zu versetzen.
Khomeini gibt bis heute Rätsel auf: Der modebewusste Ayatollah besang in eleganten Gedichten den Wein und die Liebe, verband Mystik mit klassischer Gelehrsamkeit und nahm im Pariser Exil Liberale und Linke für sich ein. War er wirklich so vielschichtig? War vieles Verstellung? Oder nahm er innerlich keinen Anteil? Auf die Frage eines Journalisten, was er nach fünfzehn Jahren im Exil bei der Rückkehr nach Iran empfinde, antwortete er schlicht: «Nichts!» Ähnlich emotionslos verheizte er die Jugend an der Front und ließ politische Gegner hinrichten. Katajun Amirpur erzählt anschaulich und im Kontext der iranischen Geschichte das Leben Khomeinis von der Kindheit in einer Provinzstadt bis zum Tod in Teheran. Sie beschreibt seine frühe Prägung durch den schiitischen Islam, stellt seine wichtigsten Lehrer, Weggefährten und Werke vor und erklärt, wie er eine traditionell unpolitische Glaubenswelt in wenigen Jahren umpolte. Noch über dreißig Jahre nach seinem Tod ist Khomeini in Iran übermächtig: Selbst Oppositionelle reklamieren sein wahres Erbe für sich, wie Katajun Amirpur am Ende ihres fesselnden Buches zeigt.
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–12 Einleitung 9–12
- 13–30 1. Kindheit und Jugend (1902–1918) 13–30
- Neischabur – Kintur – Khomein: Die Familie
- Idschtihad: Das Instrument zur Rechtsfindung
- Der Vater: Gelehrter und Anwalt der kleinen Leute
- Verfassung: Geheimnis von Macht und Fortschritt?
- Unter den Fittichen starker Frauen
- 31–50 2. Im Bann des Schiismus: Erste Sozialisation (1918–1922) 31–50
- Streit um die Nachfolge: Die Entstehung der Schia
- Die Passionsspiele: Buße für die Tragödie von Kerbela
- Pflichtfach schiitische Dogmatik
- Vom Mudschtahid zum Groß-Ayatollah
- 51–74 3. Lehrjahre und Lehrtätigkeit in Qom (1922–1963) 51–74
- Vorbild Haeri Yazdi
- Ein Blick in die Vergangenheit
- Die houze: Lehrstätten und Orte gelebter Frömmigkeit
- Frühe Lehrtätigkeit und erster politischer Traktat
- Quietistische Tradition gegen politische Einmischung
- 75–94 4. Konkurrierende schiitische Systeme 75–94
- Machtprobe zwischen Herrscher und Geistlichkeit
- Khomeinis Bruch mit Borudscherdi
- Zurück zum Koran: Die Entwicklung eines modernen Islams
- Vokabular iranischer Sozialkritik: Al-e Ahmads Gharbzadegi
- 95–110 5. Die Herrschaft des Rechtsgelehrten 95–110
- Ist dem Rechtsgelehrten Gehorsam zu leisten?
- Befürworter des Konstitutionalismus
- Anpassung an die Moderne, aber ohne Demokratie
- 111–130 6. Khomeini und der Schah (1961–1964) 111–130
- Das Nachfolgeproblem des Klerus und die Tricks des Schahs
- Khomeini betritt die politische Bühne
- Die Weiße Revolution und die Zuspitzung des Konflikts
- Der Juni-Aufstand von 1963
- 131–154 7. Exil in der Türkei und im Irak (1964–1978) 131–154
- Abschiebung in die Türkei
- Irak: Aufenthalt mit Fingerspitzengefühl
- Die Rückkehr zu den eigenen kulturellen Wurzeln
- Ali Schariati: Imamitische Führung statt demokratischer Regierung
- 155–172 8. Khomeinis Vorlesungen über den islamischen Staat 155–172
- Eine antiimperialistische Kampfschrift?
- Der Koran als Richtschnur
- Die «Herrschaft des Rechtsgelehrten»
- Der geistige Antipode: Abolqasem Choi
- 173–200 9. Ein Herrscher ist angezählt (1971–1979) 173–200
- Die 2500-Jahr-Feier der persischen Monarchie
- Geldverschwendung, Korruption, Inflation: Die letzten Jahre des Schahs
- Khomeini und die Volksmudschahedin
- Verzweifelte Aktionen eines Despoten
- In Wartestellung in Paris
- 201–228 10. Die neue Verfassung: Ein demokratischer Meilenstein? 201–228
- Rückkehr nach Iran und Abkehr von der Demokratie
- «Denn die Basis des Islams ist Gehorsam, nicht Freiheit»
- Schariatmadari: Demokratie mit islamischer Ausrichtung
- Der Umgang mit den religiösen Minderheiten
- 229–252 11. Die Ära Khomeini (1979–1989) 229–252
- Der Kampf um die Macht und die Konsolidierung des Regimes
- Vom Wunschnachfolger zur Persona non grata: Montazeri
- Literarische Abrechnung
- Ein Triumvirat entscheidet
- 253–272 12. Die «Herrschaft des Rechtsgelehrten» nach Khomeinis Tod 253–272
- Ein Staatsbegräbnis außer Kontrolle
- Absolute Führungsbefugnis hat nur Gott
- Mesbah Yazdi: «Der faqih ist der Repräsentant des unfehlbaren Imams»
- 273–294 13. Khomeinis Frauenbild im Wandel 273–294
- Männer in den öffentlichen, Frauen in den privaten Raum?
- Die Ehe ist eine religiöse Pflicht
- «Fatima ist Fatima»
- Der Hidschab als Symbol des revolutionären Islams
- 295–306 14. Khomeini und der Westen: Philosophische Ablehnung und pragmatische Kooperation 295–306
- Ökonomische Ausbeutung und kulturelle Invasion
- «Wer immer uns mit Respekt behandelt, ist unser Freund»
- 307–316 15. Die andere Seite des Revolutionärs: Philosophie, Poesie und Mystik 307–316
- Die mystische Einheit mit Gott
- Khomeinis Bildersprache
- 317–324 Epilog: Khomeinis Enkel 317–324
- 325–353 Anhang 325–353
- Zeittafel
- Glossar
- Literatur
- Bildnachweis
- Personenregister