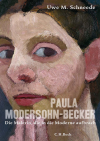Paula Modersohn-Becker
Die Malerin, die in die Moderne aufbrach
Zusammenfassung
PAULA MODERSOHN-BECKER - VORREITERIN DER MODERNE
Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) war eine der großen, singulären Künstlerinnen der Moderne. Mutig ging sie, allein auf sich gestellt, als Frau ihren Weg – lernte Paris und seine Kunst kennen und wurde mit ihren intensiven und ausdrucksstarken Bildern zu einer Wegbereiterin der deutschen Avantgarde.
Entschlossen, allen Widerständen zum Trotz und voller Leidenschaft verfolgte Paula Becker Ende des 19. Jahrhunderts ihr Ziel, Malerin zu werden. Inspiration fand sie zunächst in der Künstlerkolonie Worpswede, wo sie ihren späteren Mann Otto Modersohn kennenlernte. Ihr künstlerischer Dreh- und Angelpunkt aber war Paris, die damalige Weltstadt der Kunst. In mehreren anregenden Aufenthalten lernte sie dort die aktuelle französische Malerei kennen. Uwe M. Schneede, einer der besten Kenner von Paula Modersohn-Beckers Werk, zeigt in seiner umfassenden Monographie, wie die Künstlerin diese wichtigen Eindrücke in eine eigene Bildsprache umsetzte. Als sie 1907 im Alter von nur 31 Jahren starb, hatte sie mit ihrem bedeutenden Œuvre die kurze Epoche zwischen dem Alten und dem Neuen, dem 19. und dem 20. Jahrhundert, künstlerisch wesentlich geprägt und den deutschen Avantgarden den Weg geebnet. Heute steht sie paradigmatisch für die erste Generation von selbständigen, mutigen Malerinnen der Moderne.
Paula Modersohn-Becker: Eine der bedeutendsten deutschen Malerinnen und Wegbereiterin der Moderne
Deutschlands «weiblicher Picasso»
Große Paula-Modersohn-Becker-Retrospektive in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt (8. 10. 2021 – 6. 2. 2022)
Uwe M. Schneede ist einer der besten Paula Modersohn-Becker-Kenner
- 2–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–12
- 13–36 Im Schutz der Künstlerprovinz 1896–1899 13–36
- «Eine Leidenschaft, die alles andere ausschließt»
- Ausstellungsgenüsse
- Worpswede, «Wunderland»
- Erste Werke
- Auf Distanz zum Umfeld
- 37–52 Paris 1900 Die symbolische Reise ins neue Jahrhundert 37–52
- Erkundungen
- Die ganze Welt der Kunst
- Die Deutschen: «etwas spießbürgerlich»
- Zwischen zwei Künstlergenerationen
- 53–90 Die Fremdheit des Vertrauten 1901–1905 53–90
- «Ich erkenne keine Norm an»
- Spärlichkeit als Motiv
- Kinder: «als ob ihnen das Leben noch nicht aufgegangen sei»
- Pariser Lehren 1903
- In Worpswede: die Anderen
- Erneut Paris, 1905
- «Diesmal die aller, allermodernsten»
- «Farbiges Leuchten im Schatten»
- Direkt und doch entrückt
- Der verfälschende Firnis
- 91–124 In der Welt der Kunst. «Ich glaube, es wird» 1906 91–124
- «Zwischen meinem alten und meinem neuen Leben»
- In Paris: Erste Anerkennung
- Archetypische Substanz
- Balance und Irritation
- Austreibung des Abbilds
- Picasso: Parallelentwicklung im Schlüsseljahr 1906
- Das Pariser Atelier als Ausstellungsprovisorium
- 125–162 Die Selbstbildnisse: Ich als eine Andere 1897–1907 125–162
- Vielschichtigste Bildgattung
- Das «tolerante Spiegelbild»
- Kleine Persönlichkeitsverschiebungen
- Das große symbolische Selbstbild
- Ikonisierung
- Rituelle Stärke
- Alter Ego
- 163–192 Die Hauptwerke aus dem Pariser Atelier: Eine Welt für sich 1906/07 163–192
- Frei und abhängig
- Eigene Bildhoheit
- Kinder als Inbilder
- Bildwelten parallel zur Wirklichkeit
- Die Kunst der Welt im Atelier
- Ideen für künftige Bilder?
- 193–206 «Das Mächtige der Farbe» Die letzten Werke 1907 193–206
- Rückzug
- Neue Lebhaftigkeit
- Nochmals die Welt der Anderen
- 207–208 Schluss 207–208
- 209–240 Anhang 209–240
- Lebensdaten
- Anmerkungen
- Literatur (Auswahl)
- Abbildungsverzeichnis
- Bildnachweis
- Über die Künstlerin und den Autor
- 241–241 Zum Buch 241–241