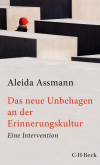Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur
Eine Intervention
Zusammenfassung
Im Ausland gilt die deutsche Erinnerungskultur als Erfolgsgeschichte und Vorbild. Im Inland dagegen ist sie schon immer Gegenstand von Unbehagen und Kritik gewesen. Da sie selbstkritisch ist, gehören solche Gegenstimmen unbedingt dazu – sie verhindern Fixierungen und halten die Erinnerungskultur lebendig. Inzwischen hat sich das Spektrum der Kritik allerdings noch einmal deutlich erweitert. Vom rechten politischen Rand aus werden die Grundlagen unserer Erinnerungskultur mittlerweile radikal in Frage gestellt.
Aleida Assmann geht in ihrem Buch, das nun in aktualisierter Neuauflage vorliegt, auf die kritischen Stimmen der jüngsten Zeit ein. Sie zeigt, was kontrovers ist, wo es Veränderungsbedarf gibt und welche Grundsätze in Zeiten eines neuen Nationalismus unbedingt zu verteidigen sind. Damit zeigt sie zugleich, dass unsere Erinnerungskultur ein nationales Projekt ist, das auf historische Veränderungen und immer neue Herausforderungen reagiert.
- 2–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–8
- 9–16 EINLEITUNG 9–16
- 16–107 VERGESSEN, BESCHWEIGEN, ERINNERN 16–107
- 16–33 1. Probleme mit der Gedächtnisforschung 16–33
- Individuelles und kollektives Gedächtnis
- Geschichte und Gedächtnis
- Kulturelles Gedächtnis
- Identitätsbezug
- Bedeutungen des Begriffs ‹Erinnerungskultur›
- 33–59 2. Arbeit am deutschen Familiengedächtnis – eine unendliche Geschichte? 33–59
- Das Schweigen brechen – der ZDF-Dreiteiler ‹Unsere Mütter, unsere Väter›
- Die Latenz des Schweigens – Hermann Lübbes Thesen zur deutschen Nachkriegsgeschichte
- Schlussstrich und Trennungsstrich
- Externalisierung und Internalisierung
- Das Crescendo der Holocaust-Erinnerung
- 59–107 3. Probleme mit der deutschen Erinnerungskultur 59–107
- Weltmeister im Erinnern?
- Deutungsmacht und gefühlte Opfer – Erinnerungskultur als Generationenkonflikt
- Der Holocaust als negativer Gründungsmythos
- Fertig erinnert?
- Ritualisierung
- Political Correctness
- Moralisierung und Historisierung
- 107–142 PRAXISFELDER DER DEUTSCHEN ERINNERUNGSKULTUR 107–142
- 107–123 4. Die Erinnerung an zwei deutsche Diktaturen 107–123
- Die Erinnerung an die DDR – ein deutscher Sonderweg?
- Die Rede von den beiden deutschen Diktaturen
- Vergangenheitsbewahrung und Vergangenheitsbewältigung
- Die Erinnerung an die Opfer der DDR
- Die Europäisierung der DDR-Erinnerung
- 123–142 5. Erinnern in der Migrationsgesellschaft 123–142
- Negative Erinnerung als Bürgerrecht?
- Das ethnische Paradox und die Pluralisierung des nationalen Gedächtnisses
- Der Schock des 4. November 2011
- Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- Empathie zwischen Differenz und Ähnlichkeit
- 142–204 TRANSNATIONALE PERSPEKTIVEN 142–204
- 142–180 6. Opferkonkurrenzen 142–180
- Exklusive und inklusive Opferdiskurse
- Europas gespaltenes Gedächtnis
- Politik der Reue
- Historische Wunden
- Verknüpfte Erinnerungen (multidirectional memories)
- 180–204 7. Vier Modelle für den Umgang mit traumatischer Vergangenheit 180–204
- Erinnern oder vergessen?
- Dialogisches Vergessen
- Erinnern, um niemals zu vergessen
- Erinnern, um zu überwinden
- Dialogisches Erinnern
- 204–233 NEUE ENTWICKLUNGEN 204–233
- 204–216 8. Jüdisches Unbehagen: Gedächtnistheater 204–216
- Opferidentifizierte und opferzentrierte Erinnerung
- Das Integrationsparadigma
- Die Nation als Feindbild
- 216–225 9. Unbehagen von rechts: Die Wiederaufrüstung der Nation 216–225
- Angriffe auf die deutsche Erinnerungskultur: Höcke und Gauland
- 225–233 10. Aktuelle Fragen zum Konzept der Erinnerungskultur 225–233
- 233–241 SCHLUSS: PRÄMISSEN DER NEUEN ERINNERUNGSKULTUR 233–241
- 241–261 ANHANG 241–261
- Anmerkungen
- 261–265 Personenregister 261–265