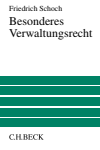Besonderes Verwaltungsrecht
Zusammenfassung
Das große Lehrbuch enthält eine systematisch ausgerichtete und gut lesbare Darstellung der wesentlichen, in Ausbildung und Rechtspraxis zentralen Materien des Besonderen Verwaltungsrechts. Es verfolgt die konsequente Zielrichtung, eine gezielte Orientierung, klar geschriebene und zugleich fundierte Übersicht über die komplexen und vielgestaltigen Rechtsprobleme der Verwaltung zu geben. Dabei wird auch die vielfältige Wechselwirkung zum Allgemeinen Verwaltungsrecht und zum Europarecht immer wieder beachtet. Zudem verfolgt das Werk das Ziel einer klaren, verständlichen Systembildung.
Inhalt:
Einleitung
Polizei- und Ordnungsrecht
Kommunalrecht
Baurecht
Umweltschutzrecht
Öffentliches Wirtschaftsrecht
Straßen- und Wegerecht
- III–LII Titelei/Inhaltsverzeichnis III–LII
- 1–11 Einleitung. Besonderes Verwaltungsrecht und Allgemeines Verwaltungsrecht: Zusammenwirken und Lerneffekte (Schmidt-Aßmann) 1–11
- I. Praktische Aufgaben der Orientierung und Entlastung
- II. Speziell für das Studium: Veranschaulichung, Wiederholung, Vertiefung
- 1. Handlungsformen
- 2. Verwaltungsverfahrensrecht
- 3. Ermessenslehren
- 4. Subjektive öffentliche Rechte
- 5. Staatshaftungsrecht
- 6. Verwaltungsorganisationsrecht
- III. Aufgaben der Systembildung und der Reform des Verwaltungsrechts
- 11–301 Kapitel 1. Polizei- und Ordnungsrecht (Schoch) 11–301
- 11–68 A. Grundlagen des Polizei- und Ordnungsrechts 11–68
- I. Begriff und Gegenstand
- 1. Polizei- und Ordnungsrecht als Gefahrenabwehrrecht
- 2. Wandlungen des Polizeibegriffs und der Gefahrenabwehraufgabe
- 3. Abgrenzungen im Recht der Inneren Sicherheit
- II. Gefahrenabwehr als staatliche Aufgabe
- 1. Gewährleistung der Inneren Sicherheit
- 2. Balance zwischen Freiheit und Sicherheit
- III. Gefahrenabwehrrecht im Bundesstaat
- 1. Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
- 2. Informationsaustausch zwischen Nachrichtendiensten und Polizei
- IV. Gefahrenabwehr durch Private
- 1. Privates Sicherheitsgewerbe
- 2. Befugnisse privater Sicherheitsdienste
- 3. Kooperation zwischen Polizei und Privatrechtssubjekten
- 4. Eigensicherungspflichten Privater
- V. Europäisierung und Internationalisierung der Gefahrenabwehr
- 1. EU-Recht: Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
- 2. Internationalisierung der Gefahrenabwehr
- 68–245 B. Materielles Polizei- und Ordnungsrecht 68–245
- I. Rechtsstaatliche Anforderungen an die Gefahrenabwehr
- 1. Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes
- 2. Rechtliche Bindungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen
- II. System der Befugnisnormen
- 1. Spezialermächtigungen und Subsidiarität des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts
- 2. Standardbefugnisse und Generalklausel
- 3. Generalklausel als Eingriffsermächtigung
- III. Gefahrenabwehr nach der Generalklausel
- 1. Eingriffsvoraussetzungen (Tatbestand)
- 2. Handlungsbefugnisse (Rechtsfolge)
- 3. Verantwortlichkeit im Polizei- und Ordnungsrecht
- 4. Polizeilicher und ordnungsbehördlicher Notstand
- IV. Standardmaßnahmen nach allgemeinem Polizei- und Ordnungsrecht
- 1. Funktion und Einordnung von Standardmaßnahmen
- 2. Klassische Standardmaßnahmen
- 3. Informationelle Standardmaßnahmen
- V. Gefahrenabwehrverordnungen
- 1. Abgrenzung zu Satzungen
- 2. Spezialermächtigungen für Gefahrenabwehrverordnungen
- 3. Gefahrenabwehrverordnungen nach der Generalklausel
- 4. Durchsetzung der Verordnung
- 245–259 C. Formelles Polizei- und Ordnungsrecht 245–259
- I. Organisationsstrukturen
- 1. Landesrecht
- 2. Bundesrecht
- II. Zuständigkeitsordnung
- 1. Bundesrecht
- 2. Landesrecht
- III. Handlungsformen zur Gefahrenabwehr
- 1. Verwaltungsakt
- 2. Verwaltungsrealakt
- 3. Behördliche Wissenserklärungen
- 4. Gefahrenabwehrverordnungen
- IV. Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
- 1. Rechtslage
- 2. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit
- 259–276 D. Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen 259–276
- I. Verwaltungszwang im Polizei- und Ordnungsrecht
- 1. Inhalt und Funktion des Verwaltungszwangs
- 2. Die einzelnen Zwangsmittel
- II. Verwaltungszwang im gestreckten Verfahren
- 1. Zuständigkeit
- 2. Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen
- 3. Durchführung des Zwangsverfahrens
- III. Unmittelbare Ausführung und Sofortvollzug
- 1. Funktion und Bedeutung
- 2. Abgrenzung von unmittelbarer Ausführung und Sofortvollzug
- 3. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für Sofortmaßnahmen
- IV. Abschleppen von Fahrzeugen als Sofortmaßnahme
- 1. Zuordnung der Abschleppmaßnahme zum gestreckten Verfahren
- 2. Fiktionen und Friktionen der h. M.
- 3. Abschleppmaßnahmen als unmittelbare Ausführung bzw. Sofortvollzug
- 276–290 E. Kostenersatz im Gefahrenabwehrrecht 276–290
- I. Gesetzliches Konzept zur Kostentragung
- 1. Entstehungsprinzip
- 2. Kostenabwälzung
- II. Kostentragung durch Verantwortliche
- 1. Sicherstellung und Verwahrung von Sachen
- 2. Ersatzvornahme
- 3. Unmittelbarer Zwang
- 4. Unmittelbare Ausführung und Sofortvollzug
- 5. Kostentragung bei Anscheinsgefahr und Gefahrverdacht
- III. Kostentragung durch Veranlasser
- 1. Grundlage: Gebührenrecht
- 2. Anwendungsbereiche in der Praxis
- 3. Insbesondere: Gebührenerhebung aus Anlass kommerzieller Großveranstaltungen
- IV. Kostenerhebung
- 1. Leistungsbescheid
- 2. Kostenschuldner
- 3. Rechtmäßigkeit der Maßnahme
- 290–301 F. Entschädigung und Schadenersatz 290–301
- I. Entschädigung bei rechtmäßigen Maßnahmen
- 1. Anspruchsberechtigte
- 2. Rechtsfolge des Anspruchs: Entschädigung
- 3. Durchsetzung des Entschädigungsanspruchs
- 4. Regress beim Verantwortlichen
- II. Schadensausgleich bei rechtswidrigen Maßnahmen
- 1. Unrechtshaftung nach Polizei- und Ordnungsrecht
- 2. Ansprüche nach Staatshaftungsrecht
- 3. Entschädigung wegen rechtswidriger Freiheitsentziehung
- III. Ersatzansprüche bei Anscheinsgefahr und Gefahrverdacht
- 301–427 Kapitel 2. Kommunalrecht (Röhl) 301–427
- 301–311 A. Grundlagen 301–311
- I. Gesetzliche Grundlagen
- 1. Kommunalrecht i. e. S.
- 2. Rechtsgrundlagen kommunaler Tätigkeit
- 3. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen
- 4. Internationalrechtliche Rahmenbedingungen
- 5. Die Bedeutung des Rechts der Europäischen Union
- II. Der systematische Standort des Kommunalrechts
- 1. Organisation und Infrastruktur
- 2. Vielfalt der Agenden
- 3. Kommunalrecht als Sonde
- III. Grundbegriffe: Gemeinde, Einwohner, Bürger
- 1. Gemeinde
- 2. Einwohner und Bürger
- 3. Rechte und Pflichten der Einwohner und Bürger
- IV. Die Idee bürgerschaftlicher Selbstverwaltung
- V. Entwicklung der Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland
- VI. Aktuelle Herausforderungen
- 1. Bevölkerungsdynamik
- 2. Kommunale Finanzen
- 3. Veränderte Kommunikationsstrukturen
- VII. Fallbearbeitung im Kommunalrecht
- 311–329 B. Die Verfassungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG 311–329
- I. Vorbemerkung: Die verfassungsrechtliche Stellung der Gemeinden
- 1. Gemeinden: Ein besonderer Teil des Staates
- 2. Die demokratische Verfassungsstruktur in der Gemeinde, Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG
- 3. Die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung
- II. Garantie der kommunalen Ebene, Art. 28 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 GG
- III. Schutz der individuellen Gemeinde in ihrem Bestand
- IV. Schutz der eigenverantwortlichen Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
- 1. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
- 2. Zuweisung durch den Gesetzgeber
- 3. Grenzen des Aufgabenfindungsrechts
- 4. Eigenverantwortlichkeit
- 5. Insbesondere: So genannte Gemeindehoheiten
- 6. Der Gesetzesvorbehalt und seine Grenzen
- V. Die Selbstverwaltungsgarantie als subjektives Recht
- 1. Kommunale Verfassungsbeschwerde
- 2. Die Bedeutung der Selbstverwaltungsgarantie für das einfache Recht
- 329–333 C. Weitere Gewährleistungen gemeindlicher Selbstverwaltung und kommunaler Rechtspositionen 329–333
- I. Gewährleistungen auf europäischer Ebene
- 1. Unionsrechtliche Gewährleistung der Selbstverwaltung
- 2. Die Berufung auf Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten
- II. Gewährleistungen im Grundgesetz
- 1. Partielle Finanzgarantien
- 2. Grundrechte
- III. Selbstverwaltungsgarantien der Landesverfassungen
- 333–351 D. Die Gemeinden im Gefüge öffentlicher Aufgabenerfüllung – Aufgabensystematik, Staatsaufsicht und Aufgabenträger 333–351
- I. Kommunale Aufgabensystematik
- 1. Aufgabenkategorien und Staatseinfluss
- 2. Das systematische Verständnis des Staatseinflusses bei den „Staatsaufgaben“/Pflichtaufgaben nach Weisung
- II. Rechtsaufsicht
- 1. Aufsichtsmittel
- 2. Rahmenbedingungen und Rechtsschutz
- III. Fachaufsicht
- 1. Wesen und Regelungen
- 2. Rechtsschutz gegen fachaufsichtliche Maßnahmen
- IV. Mittel präventiver Aufsicht
- 1. Zweck und Typik
- 2. Spezielle Genehmigungsvorbehalte
- V. Formen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung im gemeindlichen Raum
- 1. Staatliche Behörden
- 2. Weitere Modi der Aufgabenwahrnehmung
- 3. Privatisierung
- VI. Aufgabenbestand und Gemeindestatus: kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden
- 1. Das Bild der Einheitsgemeinde
- 2. Kreisangehörige Gemeinden
- 3. Kreisfreie Städte
- 4. Privilegierte kreisangehörige Gemeinden
- VII. Aufgaben der Kommunen (Auswahl)
- 1. Polizei- und Ordnungsrecht
- 2. Baurecht
- 3. Straßen- und Wegerecht
- 4. Öffentliches Wirtschaftsrecht
- 5. Umwelt- und Klimaschutzrecht
- 6. Bildung und Soziales (Beispiele)
- 351–370 E. Gemeindeverfassungsrecht 351–370
- I. Kommunalwahlen
- 1. Grundsätze
- 2. Rechtsschutz bei Kommunalwahlen
- II. Überblick: Die Gemeindeorgane
- III. Der Gemeinderat
- 1. Zusammensetzung und Mitgliederstatus
- 2. Interne Organisation und Verfahren des Rates
- 3. Aufgaben des Gemeinderates
- IV. Der Bürgermeister
- 1. Status
- 2. Aufgaben
- V. Besonderheiten kollegialer Leitungsgremien
- VI. Kommunalverfassungsstreit
- 1. Grundfragen und Entwicklung
- 2. Einzelheiten
- VII. Formen plebiszitärer Beteiligung
- 1. Schlichte Mitwirkungsmöglichkeiten
- 2. Mitentscheidungsmöglichkeiten
- VIII. Gemeindeinterne Gliederungen: Bezirke, Ortschaften
- 370–376 F. Die Gemeindeverwaltung 370–376
- I. Grundlagen
- II. Die allgemeine Gemeindeverwaltung
- III. Wirtschaftliche Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform
- 1. Überblick
- 2. Eigenbetrieb, Kommunalunternehmen
- IV. Privatrechtliche Organisationsformen als Teil des kommunalen Organisationsrechts
- 1. Rechtsformen
- 2. Erhalt der Gemeinwohlbindungen – „Einwirkungspflicht“
- V. Vertragliche Verwaltungsstrukturen in der Kommune
- 376–384 G. Kommunalspezifische Handlungsformen: Rechtsetzung der Gemeinden und kommunale Verträge 376–384
- I. Gemeindliche Satzungen
- 1. Regelungstypus
- 2. Ermächtigungsgrundlage für kommunale Satzungen und Gesetzesvorbehalt
- 3. Formelle Vorgaben
- 4. Materielle Anforderungen an Satzungen, insbesondere Vorrang des Gesetzes
- 5. Rechtsschutz gegen Satzungen
- II. Weitere gemeindliche Rechtsetzungsakte
- 1. Rechtsverordnungen
- 2. Inneradministrative Rechtssätze
- III. Kommunale Verträge
- 1. Wirksames Zustandekommen
- 2. Grenzen der Wirksamkeit
- 384–395 H. Die Leistungen der Gemeinden für ihre Einwohner 384–395
- I. Das Recht kommunaler Leistungserbringung
- 1. Grundfragen
- 2. Modi kommunaler Leistungserbringung
- II. Insbesondere: Öffentliche Einrichtungen
- 1. Begriff
- 2. Widmung
- 3. Nutzungsrechte
- 4. Benutzungsverhältnis
- 5. Rechtsformen und Zugang
- III. Einrichtungen mit Anschluss- und Benutzungszwang
- 1. Tatbestand
- 2. Grundrechtsfragen
- 395–405 I. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden 395–405
- I. Grundlagen
- 1. Kommunale Wirtschaft zwischen Daseinsvorsorge und Gewinnerzielung
- 2. Schutzzweck des kommunalen Wirtschaftsrechts
- 3. Systematische Überlegungen
- II. Kommunalrechtliche Schranken gemeindlicher Wirtschaftstätigkeit
- 1. Anwendbarkeit
- 2. Kommunalrechtliche Schrankentrias
- 3. Durchsetzung der kommunalrechtlichen Schranken
- 4. Das Recht nichtwirtschaftlicher Unternehmen
- III. Allgemeines Wirtschaftsrecht
- IV. Unionsrechtlicher Rahmen
- 1. Der allgemeine Rahmen
- 2. Bereichsspezifische Vorgaben
- 405–414 J. Finanzen und Haushalt 405–414
- I. Das Gemeindefinanzsystem
- 1. Überblick über die Einnahmen
- 2. Steuereinnahmen
- 3. Gebühren und Beiträge, privatrechtliche Entgelte
- 4. Finanzzuweisungen, insbesondere der kommunale Finanzausgleich
- 5. Kredite und Entschuldung
- 6. Reformbedarf
- II. Kommunales Abgabenrecht
- 1. Steuern
- 2. Gebühren und Beiträge, privatrechtliche Entgelte
- III. Haushaltsrecht
- 1. Neues Steuerungsmodell und kommunales Haushaltsrecht
- 2. Haushaltssatzung, Haushaltsplan
- 3. Haushaltsvollzug
- 414–420 K. Das Recht der Landkreise (Kreise) 414–420
- I. Grundgesetzliche Rechtsstellung
- 1. Garantie der Kreisebene
- 2. Garantie der Selbstverwaltung
- II. Aufgaben der Kreise
- 1. Kreisaufgaben und staatliche Steuerung
- 2. Aufgabenverteilung zwischen Kreis und kreisangehörigen Gemeinden
- III. Organe des Kreises
- 1. Kreistag
- 2. Landrat
- 3. Kreisausschuss
- IV. Staatliche Verwaltung im Kreis
- 420–427 L. Sonstige Gemeindeverbände, Zweckverbände 420–427
- I. Gesamtgemeinden
- II. Höhere Gemeindeverbände
- III. Interkommunale Zusammenarbeit, Zweckverbände
- 1. Formen interkommunaler Zusammenarbeit
- 2. Insbesondere Zweckverbandsbildungen
- 3. Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
- 427–627 Kapitel 3. Baurecht (Kersten) 427–627
- 427–428 A. Einleitung 427–428
- 428–445 B. Grundlagen 428–445
- I. Privates und öffentliches Baurecht
- 1. Privates Baurecht
- 2. Öffentliches Baurecht
- II. Verfassungsrecht
- 1. Eigentum
- 2. Selbstverwaltung
- 3. Daseinsvorsorge
- 4. Umweltschutz
- 445–464 C. Planung 445–464
- I. Begriff und Funktion
- II. Gesamtplanung
- 1. Begriff und Funktion
- 2. Mehrebenensystem
- 3. Örtliche Gesamtplanung
- 4. Überörtliche Gesamtplanung
- III. Fachplanung
- 1. Begriff und Funktion
- 2. Sektoren
- 3. Planfeststellung
- IV. Planungssystem
- 1. Öffentliches und privates Baurecht
- 2. Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- 3. Bauplanungs- und Raumordnungsrecht
- 4. Bauplanungs- und Fachplanungsrecht
- 464–540 D. Bauleitplanung 464–540
- I. Planungsvorgaben
- 1. Planerforderlichkeit
- 2. Planungsziele
- 3. Planungsleitsätze
- 4. Planungsabstimmung
- II. Planungsverfahren
- 1. Aufstellungsbeschluss
- 2. Abwägungsmaterial
- 3. Partizipation
- 4. Planbeschluss
- 5. Inkraftsetzung
- 6. Monitoring
- 7. Besondere Planungsverfahren
- III. Planabwägung
- 1. Begriff
- 2. Funktion
- 3. Regelung
- 4. Dogmatik
- 4. Gewichtung
- 5. Grundsätze
- 6. Zeitpunkt
- IV. Plantypen
- 1. Flächennutzungsplan
- 2. Bebauungsplan
- V. Planerhalt
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Planungsfehler
- 3. Frist
- 4. Ergänzendes Verfahren
- VI. Planbestand
- 1. Planänderung, Planergänzung und Planaufhebung
- 2. Funktionslosigkeit und Planlosigkeit
- VII. Public-Private-Partnership
- 1. Städtebaulicher Vertrag
- 2. Vorhaben- und Erschließungsplanung
- VIII. Planumsetzung
- 1. Plansicherung
- 2. Planverwirklichung
- IX. Planungsrechtsschutz
- 1. Bauleitpläne
- 2. Städtebauliche Verträge
- 540–587 E. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 540–587
- I. Bauplanungsrechtliche Vorhaben
- II. Qualifiziert beplanter Innenbereich
- 1. Bereichsbegriff
- 2. Regelungssystematik
- 3. Regelbebauung
- 4. Ausnahmebebauung
- 5. Dispensbebauung
- 6. Zulässigkeit während der Planaufstellung
- 7. Drittschutz
- III. Unbeplanter Innenbereich
- 1. Bereichsbegriff
- 2. Regelungssystematik
- 3. Generalklausel
- 4. Spezialregelung
- 5. Drittschutz
- IV. Außenbereich
- 1. Bereichsbegriff
- 2. Regelungssystematik
- 3. Privilegierte Vorhaben
- 4. Nichtprivilegierte Vorhaben
- 5. Öffentliche Belange
- 6. Teilprivilegierte Vorhaben
- 7. Satzungsprivilegierte Vorhaben
- 8. Drittschutz
- V. Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde
- VI. Bestandsschutz
- 587–627 F. Bauordnungsrecht 587–627
- I. Funktion und Dimensionen
- II. Grundbegriffe
- 1. Bauliche Anlagen
- 2. Sonderbauten
- III. Akteure
- 1. Baubeteiligte
- 2. Nachbar
- 3. Behörden
- IV. Bebauung
- 1. Abstandsflächen
- 2. Werbeanlagen
- 3. Stellplätze
- V. Präventive Bauaufsicht
- 1. Genehmigungserfordernis
- 2. Genehmigungsverfahren
- 3. Genehmigungsprüfung
- 4. Genehmigungsfristen
- 5. Baugenehmigung
- 6. Genehmigungstypen
- VI. Repressive Bauaufsicht
- 1. Generalklausel
- 2. Baueinstellung
- 3. Nutzungsuntersagung
- 4. Beseitigungsverfügung
- 5. Maßnahmenrichtung
- VII. Rechtsschutz
- 1. Rechtsschutz des Bauherrn
- 2. Rechtsschutz des Nachbarn
- 627–759 Kapitel 4. Öffentliches Wirtschaftsrecht (Huber/Unger) 627–759
- 627–633 A. Grundlagen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts 627–633
- I. Allgemeines
- II. Ökonomische Grundlagen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts
- 1. Allgemeines
- 2. Merkantilismus
- 3. Liberalismus
- 4. Sozialstaat und soziale Marktwirtschaft
- 5. Ablösung der sozialen Marktwirtschaft durch einen globalisierten, digitalisierten und datenbasierten Kapitalismus?
- III. Historische Grundlagen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts
- 633–660 B. Verfassungsrechtliche Maßgaben und Anforderungen 633–660
- I. Wirtschaftsverfassung
- 1. Begriff der Wirtschaftsverfassung
- 2. Streit um die Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes
- II. Gesetzgebung und Regierung im Öffentlichen Wirtschaftsrecht
- 1. Bundesstaatliche Kompetenzverteilung und Öffentliches Wirtschaftsrecht
- 2. Rechtsstaatliche Anforderungen
- 3. Der soziale Rechtsstaat als Verfassungsauftrag
- III. Grundrechtsschutz wirtschaftlicher Tätigkeit
- 1. Allgemeines
- 2. Allgemeine Wirtschafts- und Unternehmensfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
- 3. Allgemeiner Gleichheitssatz
- 4. Koalitionsfreiheit
- 5. Berufsfreiheit
- 6. Eigentumsgarantie
- IV. Sozialisierung und Verstaatlichung
- 660–672 C. Unionsrechtliche Maßgaben und Anforderungen 660–672
- I. Allgemeines
- II. Grundlagen und Wirkungsbedingungen der unionalen Rechtsordnung
- 1. Nationaler Rechtsanwendungsbefehl als Grundlage der Mitgliedschaft Deutschlands
- 2. Anwendungsvorrang des Unionsrechts und seine Grenzen
- 3. Die unionale Rechtsordnung als wechselseitige Auffang- und Kooperationsordnung
- III. Grundzüge des Unionsrechts, allgemeine Rechtsgrundsätze
- 1. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
- 2. Grundrechte
- 3. Rechtsangleichung
- 4. Staatshaftung
- IV. Binnenmarkt und Grundfreiheiten
- 1. Grundfreiheiten
- 2. Unionales Wettbewerbsrecht
- 672–687 D. Wirtschafts- und Währungspolitik 672–687
- I. Begriffe
- II. Wirtschaftspolitik
- 1. Konjunkturpolitik und Globalsteuerung
- 2. Fiskalpolitik
- 3. Außenhandelspolitik
- 4. Wirtschaftsstatistik
- III. Währungsunion und Währungspolitik
- 1. Eintrittsvoraussetzungen
- 2. Organisation und Aufgaben des ESZB
- 3. Ausrichtung des ESZB auf die Preisstabilität
- 4. Die Währungsunion in der Krise – Von der Stabilitäts- zur Stabilisierungsunion
- 687–732 E. Wirtschaftsverwaltungsrecht 687–732
- I. Wirtschaftsverwaltung und Wirtschaftsverwaltungsrecht
- 1. Wirtschaftsverwaltung und Wettbewerbsverwaltung
- 2. Gewerberecht als Recht der Wirtschaftsverwaltung
- II. Organisation der Wirtschaftsverwaltung
- 1. Unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung
- 2. Einbindung Privater in die Wirtschaftsverwaltung
- 3. Die Selbstverwaltung der Wirtschaft
- III. Allgemeines Gewerberecht
- 1. Rechtsgrundlagen des allgemeinen Gewerberechts
- 2. Regelungszweck und Regelungsstrategie
- 3. Anwendungsbereich: Ausübung eines Gewerbes
- 4. Gewerbetyp 1: Das stehende Gewerbe
- 5. Gewerbetyp 2: Das Reisegewerbe
- 6. Gewerbetyp 3: Das Marktgewerbe
- IV. Besonderes Gewerberecht
- 1. Handwerksrecht
- 2. Gaststättenrecht
- 732–759 F. Wettbewerbsverwaltungsrecht 732–759
- I. Wettbewerbsverwaltung und Wettbewerbsverwaltungsrecht
- II. Wettbewerbssicherung: Der Staat als Marktteilnehmer
- 1. Der Staat auf der Angebotsseite: Recht der öffentlichen Unternehmen
- 2. Der Staat auf der Nachfrageseite: Vergaberecht
- III. Wettbewerbslenkung: Subventions- und Beihilfenrecht
- 1. Gegenstand, Regelungszweck und Regelungsstrategie
- 2. Materielles Subventions- und Beihilfenrecht
- 3. Subventions- und Beihilfeverfahrensrecht
- 4. Rechtsschutz im Subventions- und Beihilfenrecht
- a) Konstellation 1: Verweigerung einer Subvention
- b) Konstellation 2: Rückforderung einer Subvention
- c) Konstellation 3: Subventionierung eines Konkurrenten
- IV. Wettbewerbsermöglichung: Netzregulierungsrecht
- 1. Gegenstand, Regelungszweck und Regelungsstrategie
- 2. Exemplarisch: Regulierung im Telekommunikationssektor
- 759–875 Kapitel 5. Umweltschutzrecht (Eifert) 759–875
- 759–766 A. Entstehung und Entwicklung des Umweltschutzrechts 759–766
- 766–775 B. Umweltschutzrecht als Rechtsgebiet 766–775
- I. Umweltrecht als zielzentriertes Rechtsgebiet
- II. Umweltrecht als Mehrebenensystem
- 1. Bedeutung der Ebenen
- 2. Kompetenzverteilung zwischen den Ebenen
- 775–785 C. Prinzipien des Umweltrechts 775–785
- I. Bedeutung der Prinzipien
- II. Verursacherprinzip
- III. Schutz-, Vorbeuge- und Vorsorgeprinzip
- 1. Ziele und Ansätze
- 2. Vorgaben und Abgrenzungen in Unionsrecht und nationalem Recht
- 3. Vorsorge als Legitimation und Auftrag einer Umweltgesetzgebung
- 4. Umsetzung und Ausgestaltung im Verwaltungsrecht
- IV. Nachhaltigkeitsprinzip
- V. Integrationsprinzip
- VI. Weitere Prinzipien
- 785–822 D. Instrumente und Charakteristika des Umweltrechts 785–822
- I. Instrumentelle Perspektive im Umweltrecht
- II. Hoheitliche Regulierung
- 1. Normkonkretisierung durch untergesetzliche und private Regelsetzung
- 2. Differenzierte Eröffnungskontrollen, insbesondere Genehmigungen
- 3. Hohe Bedeutung und umfangreiche Ausgestaltung der Verfahren
- 4. Koordination der Einzelmaßnahmen durch staatliche Planung
- 5. Räumliche Pflichtenregime durch Schutzgebiete
- 6. Überwachung
- III. Regulierte Selbstregulierung
- 1. Nutzung von Organisation
- 2. Ausgestaltung des ökonomischen Marktes
- 3. Einrichtung eines ökonomischen Marktes
- 4. Effektivierung politischer Öffentlichkeit: Umweltinformationen
- 5. Schatten des Rechts: Selbstverpflichtungen der Wirtschaft
- IV. Instrumentenmix als Strategie
- V. Rechtsschutz
- 1. Grundkonstellationen
- 2. Allgemeiner Rahmen des Rechtsschutzes
- 3. Klageart
- 4. Subjektive Rechte und Klagebefugnis
- 5. Klagemöglichkeiten von Umweltverbänden
- 6. Verfahrensrechte
- 7. Kontrolldichte
- 822–828 E. Das Recht des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege 822–828
- I. Allgemeines
- II. Landschaftsplanung
- III. Eingriffe in Natur und Landschaft
- 1. Allgemeiner Bestandsschutz
- 2. Besonderer Biotopschutz
- IV. Schutzgebiete
- V. Artenschutz
- 828–832 F. Bodenschutzrecht 828–832
- I. Allgemeines
- II. Grundsätze und Grundpflichten des Bodenschutzes
- III. Ergänzende Vorschriften für Altlasten
- IV. Wertausgleich
- 832–842 G. Wasserrecht 832–842
- I. Allgemeines
- II. Die allgemeine wasserwirtschaftsrechtliche Benutzungsordnung
- 1. Verwaltungs- und verfassungsrechtliche Grundsätze
- 2. Die Rechtsinstitute der Erlaubnis und der Bewilligung
- 3. Erlaubnis- oder bewilligungspflichtige Benutzungen
- 4. Die allgemeinen Voraussetzungen der Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung
- 5. Nebenbestimmungen, nachträgliche Beschränkungen und Widerruf einer Erlaubnis oder Bewilligung
- 6. Gewässeraufsicht und repressives Einschreiten der Wasserbehörden
- III. Maßnahmen- und Bewirtschaftungspläne
- IV. Festsetzung von Wasserschutzgebieten
- V. Unterhaltung und Ausbau oberirdischer Gewässer
- 842–865 H. Immissionsschutzrecht 842–865
- I. Allgemeines
- II. Genehmigungsbedürftige Anlagen
- 1. Kreis der genehmigungsbedürftigen Anlagen
- 2. Genehmigungsvoraussetzungen
- 3. Genehmigungsverfahren
- 4. Inhalt und Wirkung der Anlagengenehmigung
- 5. Vorbescheid und Teilgenehmigung
- 6. Nachträgliche Anordnungen
- 7. Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von Anlagen, Widerruf der Anlagengenehmigung
- 8. Anlagenbezogene Überwachung
- III. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
- IV. Der produktbezogene Immissionsschutz
- V. Der verkehrsbezogene Immissionsschutz
- 1. Grundlagen des Immissionsschutzes bei Straßen, Schienenwegen und Flughäfen
- 2. Sonderregelung des Fluglärmschutzgesetzes
- VI. Der allgemeine handlungsbezogene Immissionsschutz
- VII. Der gebietsbezogene Immissionsschutz
- VIII. Treibhausgasemissionshandel
- 1. Allgemeines
- 2. TEHG 2011, Marktinfrastruktur und Zuteilung
- 865–875 I. Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht 865–875
- I. Allgemeines
- II. Abfallbegriff
- III. Grundsätze und Handlungspflichten im Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht
- IV. Produktverantwortung
- V. Abfallwirtschaftspläne
- VI. Abfallentsorgungsanlagen
- VIII. Überwachung
- 875–929 Kapitel 6. Straßenrecht (Axer) 875–929
- 875–885 A. Straßenrecht als Rechtsgebiet 875–885
- I. Kompetenzordnung und Rechtsquellen des Straßenrechts
- 1. Gesetzgebungskompetenz und Rechtsquellen
- 2. Verwaltungszuständigkeit
- II. Straßen- und Straßenverkehrsrecht
- 1. Berührungspunkte
- 2. Abgrenzung
- 3. Vorbehalt des Straßenrechts und Vorrang des Straßenverkehrsrechts
- 885–891 B. Straßenrecht als Recht der öffentlichen Sachen 885–891
- I. Das Recht der öffentlichen Sachen
- 1. Öffentliches Eigentum
- 2. Theorie des modifizierten Privateigentums
- II. Abschied vom Recht der öffentlichen Sachen? – Der Hamburger Stadtsiegelfall
- III. Straßenrecht als kodifiziertes Recht der öffentlichen Sachen
- 891–903 C. Die Widmung als Kreationsakt der öffentlichen Straße 891–903
- I. Straße und Einteilung der Straßen
- 1. Straße
- 2. Einstufung und Umstufung
- II. Planung, Bau und Indienststellung von Straßen
- III. Die Widmung
- 1. Voraussetzungen
- 2. Inhalt und Rechtsfolgen
- 3. Widmung in anderen Verfahren
- 4. Widmung kraft unvordenklicher Verjährung?
- 5. Rechtsschutz
- IV. Einziehung und Teileinziehung
- 903–906 D. Straßenbaulast, Straßenverkehrssicherungspflicht, Straßenreinigung 903–906
- I. Straßenbaulast
- II. Straßenverkehrssicherungs- und Straßenverkehrsregelungspflicht
- III. Straßenreinigung, Räum- und Streupflicht, Beleuchtungspflicht
- 906–927 E. Die Nutzung öffentlicher Straßen 906–927
- I. Gemeingebrauch
- 1. Verkehr
- 2. Kommunikativer Verkehr
- 3. Gewerbliche Werbung und Gewerbeausübung
- 4. Anspruch auf Gemeingebrauch und Unentgeltlichkeit?
- II. Sondernutzung
- 1. Verfahren und Vorrang spezieller Erlaubnisse
- 2. Ermessen
- 3. Sondernutzungssatzung
- 4. Sondernutzungsgebühren
- III. Anliegergebrauch
- 1. Anliegerrechte und Anliegergebrauch
- 2. Anliegergebrauch
- 3. Rechtsschutz des Anliegers
- IV. Sonstige Benutzungen, privatrechtliche Gestattung
- 927–929 F. Öffentliche Straße, öffentlicher Raum, öffentliche Einrichtung 927–929
- 929–956 Sachverzeichnis 929–956