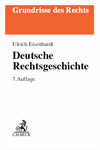Deutsche Rechtsgeschichte
Zusammenfassung
Das Buch vermittelt dem Studenten den Stoff der Vorlesung Deutsche Rechtsgeschichte, die vom Mittelalter bis zur Deutschen Wiedervereinigung nachgezeichnet wird.
Die Ergebnisse der umfangreichen rechtshistorischen Forschungen der Nachkriegszeit sind berücksichtigt. Neben den verfassungshistorischen werden auch die privatrechts- und strafrechtsgeschichtlichen Entwicklungslinien beschrieben.
Schwerpunkte der Darstellung bilden:
Recht und Rechtsbildung im Mittelalter,
Folgewirkungen der Rezeption des römischen und kanonischen Rechts,
Bemühungen um Reformen des Rechts in der Zeit der Aufklärung,
Veränderungen der Rechts- und Gesellschaftsordnungen im 19. Jahrhundert,
Pervertierung des Rechts in der nationalsozialistischen Zeit sowie
Rechtsentwicklung in beiden deutschen Staaten und die Einheit Deutschlands.
- I–XXXI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXXI
- 1–5 Einleitung 1–5
- 5–246 1. Abschnitt. Rechtsvielfalt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 5–246
- 5–72 1. Kapitel. Staatliche Strukturen – Der Weg zum Föderalismus 5–72
- § 1. Das Mittelalter
- I. Der Beginn des deutschen Reiches
- II. Ordnung, Verfassung und Staat im Mittelalter
- III. Das König- und Kaisertum
- IV. Lehnrecht und Lehnsverfassung
- V. Reich und Territorialstaaten
- VI. Die ständische Gliederung des Volkes
- VII. Staat und Kirche im Mittelalter
- VIII. Die Verfassung in den Territorien und Städten
- § 2. Die Neuzeit
- I. Das deutsche Reich und die Territorialstaaten
- II. Die theoretische Grundlegung der Reichsverfassung
- III. Der Kaiser und die Regierung des Reiches
- IV. Der Reichstag
- V. Die oberste Gerichtsbarkeit im Reich. Reichskammergericht und Reichshofrat
- VI. Die ständische Ordnung in der Zeit nach 1500
- VII. Die Religionsverfassung
- VIII. Die Reichsreform am Ende des 15. und am Beginn des 16. Jahrhunderts
- IX. Verfassung und Verwaltung der Territorialstaaten und Reichsstädte
- 72–221 2. Kapitel. Wandlungen des Rechts – Tendenzen zu einer (frühen) Europäisierung 72–221
- 72–85 § 3. Recht und Rechtsbildung im Mittelalter 72–85
- I. Rechtsquellen und Rechtskreise
- II. Die mittelalterliche Anschauung von Recht
- III. Reichsrecht, Landrecht und Stadtrecht
- 85–124 § 4. Die Entstehung einer europäischen Rechtswissenschaft. Die Rezeption des römischen und kanonischen Rechts und die Folgen 85–124
- I. Die Anfänge einer Rechtswissenschaft in Deutschland
- II. Das römische Recht
- III. Die Wiederentdeckung des römischen Rechts in Oberitalien
- IV. Das kanonische Recht
- V. Die Rezeption und ihre Auswirkungen
- VI. Der Einfluss des kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur
- VII. Der griechische Beitrag zur Europäischen Rechtsentwicklung
- VIII. Rechtsschrifttum und praktische Rezeption vor dem Usus modernus
- IX. Der juristische Humanismus
- X. Entstehung und Bedeutung des Usus modernus
- X. Das Nebeneinander verschiedener Rechtsmassen
- XI. Würdigung
- 124–133 § 5. Die Anfänge einer Gesetzgebung 124–133
- I. Gesetz und Gesetzgebung
- II. Gesetzgebungsgewalt und Gesetzgebungsakt
- III. Die theoretische Grundlegung der Gesetzgebung
- IV. Die Reichsgesetzgebung
- V. Die Gesetzgebung in den Territorialstaaten
- VI. Die Gesetzgebung in den Städten
- 133–145 § 6. Naturrechtslehre und Aufklärung. Eine europäische Bewegung 133–145
- I. Einführung
- II. Die Grundlagen des Naturrechts
- III. Aufklärung, Naturrechtslehre und Vernunftrecht
- IV. Der Einfluss der Naturrechtslehre und der Aufklärung auf die Rechtswissenschaft
- 145–164 § 7. Gesetzgebung und Kodifikation in Europa im Zeitalter der Aufklärung 145–164
- I. Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation
- II. Die bayerischen Kodifikationen
- III. Die Kodifikationen in Österreich
- IV. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 (ALR)
- V. Die Rechtsentwicklung in Frankreich
- 164–169 § 8. Die Entwicklung von Staats- und Völkerrecht 164–169
- I. Das Staatsrecht
- II. Das Völkerrecht
- 169–197 § 9. Wandlungen des Privatrechts bis zum Ende des alten Reiches (1806) 169–197
- I. Das mittelalterliche Privatrecht
- II. Das mittelalterliche Zivilverfahrensrecht
- III. Die Entwicklung des Privatrechts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
- IV. Der Zivilprozess
- 197–221 § 10. Straf- und Strafprozessrecht bis 1806 197–221
- I. Das mittelalterliche Strafrecht
- II. Wandlungen des Strafrechts in der Neuzeit (bis 1806)
- III. Der Strafprozess
- 221–246 3. Kapitel. Die Rechtspflege 221–246
- § 11. Die Rechtspflege im mittelalterlichen Deutschland
- I. Die Gerichtsverfassung im Reich, in den Territorialstaaten und Städten
- II. Die Ausbildung von Rechtsmitteln und Instanzen
- § 12. Gerichtsverfassung und Verfahren in der Neuzeit (bis 1806)
- I. Die Gerichtsverfassung des Reiches
- II. Die Gerichtsverfassung in den Territorien und Städten
- III. Richter und Gesetz im 18. Jahrhundert
- 246–346 Zweiter Abschnitt. Bemühungen um ein einheitliches Recht – Die Entwicklung von der Auflösung des alten Reiches (1806) bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 246–346
- 246–311 4. Kapitel. Vom Staatenbund zum nationalen Bundesstaat 246–311
- § 13. Die Auflösung des Reiches und der Rheinbund
- I. Die Auflösung des alten Reiches
- II. Deutschland zur Zeit des Rheinbundes
- § 14. Der Deutsche Bund
- I. Die Gründung des Deutschen Bundes
- II. Die Verfassung des Deutschen Bundes
- III. Gesellschaftliche Wandlungen am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- IV. Ein Beispiel für Reformen und gesellschaftlichen Wandel: Die Stein-Hardenbergschen Reformen
- V. Die politischen Strömungen im Deutschen Bund und ihre Auswirkungen
- VI. Die Verfassungen der deutschen Einzelstaaten
- VII. Die Verankerung von Grundrechten in den Verfassungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- VIII. Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit
- IX. Verwaltungsstrukturen, Verwaltungsrecht und Administrativjustiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- § 15. Die Reichsverfassung von 1848/49 und ihr Scheitern
- I. Bildung und Arbeit von Siebzehnerausschuss und deutscher Nationalversammlung
- II. Der Inhalt der Verfassung
- III. Das Scheitern der Reichsverfassung
- § 16. Die Gründung des Deutschen Reiches 1871
- I. Die Entwicklung bis zur Reichsgründung
- II. Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871
- 311–346 5. Kapitel. Versuche der Rechtsvereinheitlichung und das Kodifikationsproblem 311–346
- § 17. Die Rechtszersplitterung im 19. Jahrhundert
- I. Überblick
- II. Die Fortgeltung des französischen Rechts in Teilen Deutschlands
- § 18. Die Entwicklung des Privatrechts im 19. Jahrhundert
- I. Der Streit um die Kodifikation
- II. Die historische Rechtsschule – Romanisten und Germanisten
- III. Industrielle Revolution und Privatrecht
- IV. Versuche der Rechtsvereinheitlichung vor 1871
- § 19. Die Entwicklung des Straf- und Strafprozessrechts im 19. Jahrhundert (bis 1870)
- I. Die Strafrechtswissenschaft
- II. Die Strafrechtsgesetzgebung
- III. Der reformierte Strafprozess
- 346–367 Dritter Abschnitt. Die Herstelllung der Rechtseinheit im Deutschen Reich von 1871 346–367
- 6. Kapitel. Die Chance zur Verwirklichung der Rechtseinheit
- § 20. Die Vereinheitlichungsbestrebungen und die Schaffung des BGB
- I. Die Gesetzgebungskompetenz des Reiches
- II. Die Reichsjustizgesetze
- III. Das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch
- IV. Arbeitsverfassung und Arbeitsrecht
- V. Das Reichsgericht als Garant einer einheitlichen Rechtsprechung
- VI. Die Verfassungsgerichtsbarkeit
- VII. Das deutsche Kolonialrecht
- 367–425 Vierter Abschnitt. Der Weg zur erneuten Rechtszersplitterung. Veränderungen und Pervertierung des Rechts in der Zeit zwischen 1918 und 1945 367–425
- 367–391 7. Kapitel. Die Weimarer Republik und ihr frühes Ende 367–391
- § 21. Die Entstehung der Weimarer Republik und die Reichsverfassung
- I. Die Entstehung
- II. Die Weimarer Reichsverfassung (WRV)
- III. Der Zusammenbruch des Weimarer Verfassungsstaats
- § 22. Die Entwicklung der Rechtsgebiete und der Rechtspflege
- I. Das Privatrecht
- II. Sozialstaat und neues Arbeitsrecht
- III. Das öffentliche Recht
- IV. Das Strafrecht
- V. Die Rechtspflege
- 391–425 8. Kapitel. Recht und Justiz unter der Herrschaft des Nationalsozialismus (1933 bis 1945) 391–425
- § 23. Die nationalsozialistische Machtergreifung
- I. Überblick
- II. Die Folgen der Reichstagswahlen 1933. Hitler wird Reichskanzler
- III. Die Ausnutzung des Ermächtigungsgesetzes
- § 24. Die Zerstörung eines Rechtsstaats
- I. „Recht ist, was dem Volke nützt“
- II. Die Pervertierung des Rechts
- III. Rasse und Recht
- IV. Die Verfassungswirklichkeit: Führerkult und Führerstaat
- § 25. Strafrecht und Privatrecht in der Zeit zwischen 1933 und 1945
- I. Das Strafrecht
- II. Das Privatrecht
- § 26. Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus
- I. Die Einflussnahme der Nationalsozialisten auf die Justiz
- II. Die Rechtsprechung im national-sozialistischen Sinne
- III. Die Justiz als Handlangerin des Systems?
- 425–519 Fünfter Abschnitt. Die Spaltung Deutschlands, die Wiedervereinigung und das erneute Streben nach Rechtseinheit 425–519
- 425–446 9. Kapitel. Die Herrschaft der Besatzungsmächte und die Anfänge einer neuen Selbständigkeit 425–446
- § 27. Verwaltung und Rechtspflege im Nachkriegsdeutschland
- I. Maßnahmen der Alliierten nach der Kapitulation
- II. Die Reorganisation der staatlichen Verwaltung und der Justiz in Deutschland
- § 28. Drei Besatzungszonen werden ein Staat. Die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland
- I. Die Ausbildung von Ländern in den Besatzungszonen
- II. Die Verfassungsentwicklung in den Westzonen bis zum Zusammentreten des Parlamentarischen Rates
- III. Die Staatsgründung
- 446–460 10. Kapitel. Das Bemühen um Gerechtigkeit. Nürnberger Prozesse und Entnazifizierung 446–460
- § 29. Die Nürnberger Prozesse
- I. Überblick
- II. Die Rechtsgrundlagen des Hauptkriegsverbrecherverfahrens
- III. Die Angeklagten
- IV. Das Urteil
- V. Die Nachfolgeprozesse
- § 30. Die Entnazifizierung
- I. Die Vorgaben der Alliierten für die Entnazifizierung
- II. Die Durchführung der Entnazifizierungsmaßnahmen
- III. Der Umgang der Justiz mit der eigenen Vergangenheit im Westen Deutschlands
- IV. Die Bewertung der Entnazifizierung
- 460–482 11. Kapitel. Die Verwirklichung des Rechtsstaats im Westen 460–482
- § 31. Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaatsprinzip. Das Grundgesetz und seine Auswirkungen
- I. Die Entstehung des Grundgesetzes
- II. Die Grundrechte
- III. Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaatsprinzip und Wirtschaftsordnung
- IV. Die Machtfülle der dritten Gewalt. Das Bundesverfassungsgericht
- V. Der Gleichheitssatz und die Gleichberechtigung von Mann und Frau
- VI. Das öffentliche Recht und der Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit
- VII. Das Privatrecht in der neuen Wirtschaftsordnung
- VIII. Das Arbeits- und Sozialrecht
- IX. Strafrecht und Strafprozessrecht
- § 31a. Die internationale Einbindung Deutschlands. Die europäische Union
- I. Überblick
- II. Von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union
- III. Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft
- 482–509 12. Kapitel. Das Recht unter der Herrschaft des Sozialismus 482–509
- § 32. Die Entstehung der DDR und ihre Herrschaftsstrukturen
- I. Die Ausbildung von Herrschaftsstrukturen unter der sowjetischen Besatzungsmacht
- II. Die Staatsgründung
- III. Die Herrschaftsstrukturen des SED-Regimes
- IV. Das Nebeneinander von Bundesrepublik und DDR
- § 33. Die Rechtsordnung der DDR
- I. Der Rechtsbegriff in der sozialistischen Gesellschaft
- II. Verfassung und Staatsrecht
- III. Der Verwaltungsrechtsschutz
- IV. Das Privatrecht
- V. Das Strafrecht und das Strafprozessrecht
- VI. Aufgabe und Praxis der Gerichte
- VII. Die Rechtsanwälte
- VIII. Die Rechtswissenschaft
- IX. War die DDR ein Unrechtsstaat?
- 509–519 13. Kapitel. Die Wiedergewinnung der Rechtseinheit 509–519
- § 34. Wiedervereinigung und neue Rechtsvereinheitlichung
- I. Der Weg zur Wiedervereinigung
- II. Die Schwierigkeiten der Rechtsvereinheitlichung
- III. Die Rechtspflege in den neuen Ländern
- § 35. Probleme der Rechtsangleichung
- I. Das bürgerliche Recht
- II. Das Arbeitsrecht
- III. Übernahme fremden Rechts?
- IV. Die Aufarbeitung des sogenannten DDR-Unrechts
- 519–525 Personenverzeichnis 519–525
- 525–538 Sachverzeichnis 525–538