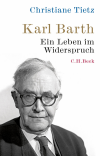Karl Barth
Ein Leben im Widerspruch
Zusammenfassung
«Ein grauenerregendes Schauspiel für alle nicht Schwindelfreien»: So beschrieb der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts seine Theologie. Christiane Tietz erzählt in dieser ersten deutschsprachigen Biographie seit Jahrzehnten Karl Barths faszinierendes Leben im Widerspruch – gegen den theologischen Mainstream, gegen den Nationalsozialismus und privat, unter einem Dach mit Ehefrau und Geliebter, im Widerspruch mit sich selbst.
Während sich deutsche Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg am Erlebnis von Gemeinschaft und Transzendenz berauschten, trat der Schweizer Theologe Karl Barth (1886 – 1968) allen Versuchen entgegen, in der Kultur oder den eigenen Gefühlen Göttliches zu finden. Gerade das machte ihn frei für höchst irdisches Engagement: Er galt als «roter Pfarrer», war federführend an der «Theologischen Erklärung von Barmen», dem Gründungsdokument der Bekennenden Kirche, beteiligt und protestierte gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Christiane Tietz geht überzeugend den Wechselwirkungen zwischen Barths persönlicher und politischer Biographie und seiner Theologie nach. Zahlreiche neu erschlossene Dokumente beleuchten weniger bekannte Seiten Barths, etwa seine langjährige «Notgemeinschaft zu dritt», die er mit seiner Frau und seiner Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum führte. Das anschaulich geschriebene Buch lässt einen der eigensinnigsten Denker des letzten Jahrhunderts neu entdecken.
- 2–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–12
- 13–14 Vorwort 13–14
- 15–38 1 «Ich bin Basler»: 1886–1904 15–38
- Zunftmeister, Pfarrer und Gelehrte: Die Vorfahren
- Strengste Wahrheitsliebe und christliche Zucht: Die Eltern
- «E großi großi Freud»: Kindheit und Jugend
- 39–64 2 «Dunkler Drang nach besserem Verstehen»: 1904–1909 39–64
- Entschluss zum Theologiestudium
- Student in Bern
- Farbentragend und nichtschlagend: In der Zofingia
- «Sehr fleißig und sehr tüchtig»: Student in Berlin
- Noch einmal Bern und dann Tübingen
- Endlich Marburg
- Mitarbeit bei der «Christlichen Welt»
- 65–78 3 «Die Treppe von Calvins Kanzel hinauf gestolpert»: 1909–1911 65–78
- Als Vikar in Genf
- Recht anspruchsvoll: Erster Konfirmandenunterricht
- Theologe in der Gemeinde
- «In so schrecklich frommer Umgebung»
- Eine Tochter aus gutem Hause: Verlobung mit Nelly Hoffmann
- Abschied von Genf
- 79–98 4 «Der rote Pfarrer»: Safenwil 1911–1921 79–98
- «Dieses Erwerbssystem muß fallen»: Arbeiter und Sozialisten
- Theologische Freundschaft: Eduard Thurneysen
- «Die Welt … entgöttert»: Der Erste Weltkrieg
- «Ein offenes Haus»: Familienleben
- 99–112 5 «Ein Buch für die Mitbekümmerten»: Der erste Römerbrief, 1919 99–112
- Menschliche Religion und göttliches Wort
- «Wie eine Bombe auf dem Spielplatz der Theologen»
- «Ohne Fenster gegen das Himmelreich»: Der Tambacher Vortrag
- 113–132 6 «Immer etwas schneller arbeiten»: Göttingen 1921–1925 113–132
- Vom Schweizer Pfarrer zum deutschen Professor
- «Unvermeidlicher Unfug des akademischen Betriebs»
- «Fast kameradschaftlich»: Studenten
- «Lebhafte Gefechte»: Emanuel Hirsch und andere Kollegen
- «Fremdling aus Neutralien»: Karl Barth und die Deutschen
- 133–162 7 «Kein Stein auf dem andern»: Der zweite Römerbrief, 1922 133–162
- «Kritische Wende»
- Die Neufassung des «Römerbriefs»
- Kritiker und Bewunderer
- Was ist Dialektische Theologie?
- Dialektische Weggenossen: Brunner, Bultmann, Gogarten
- Fünfzehn Fragen und sechzehn Antworten: Die Kontroverse mit Harnack
- 163–186 8 «Not des Weiterdenkens»: Münster 1925–1930 163–186
- Ein Ruf und eine folgenreiche Begegnung
- Herzlich empfangen, im Streit gegangen
- Im Tunnel des Semesters
- Zurück nach Bern?
- «Die Kirche, die Kirche, die Kirche»: Begegnungen mit dem Katholizismus
- Ausritte, Hausmusik und Reisen
- 187–206 9 «Notgemeinschaft» zu dritt: Charlotte von Kirschbaum 187–206
- Ein lange gehütetes Geheimnis
- «Ich habe doch nie gewußt, daß es so etwas geben könne»
- «Ein gewisses Doppelleben»
- Zu dritt unter einem Dach
- 207–272 10 «Mitten in Deutschland ein Schweizer»: Bonn 1930–1935 207–272
- Arbeit an der Theologie
- Die Menschlichkeit Gottes
- Erste Auseinandersetzung mit den Deutschnationalen: Der Fall Günther Dehn
- Gerade jetzt in der SPD: Das Jahr 1933
- Mahnungen an die Kirche und ein Brief an Hitler
- 1933 als häusliches Krisenjahr
- Die theologische Dimension der Beziehung zu Charlotte von Kirschbaum
- Angriffe auf den Schweizer
- Gegen den «deutschen Gruß»
- Bruch mit den dialektischen Weggenossen
- Die Barmer Theologische Erklärung
- Suspendierung, Redeverbot, Entlassung
- 273–318 11 «Wir, die wir noch reden können»: Basel 1935–1945 273–318
- Das Leben geht weiter: Professor in Basel
- Internationale Ehrungen und Unverständnis
- Kampf für die Bekennende Kirche
- Anti-Appeasement: Aufruf an die Tschechen zum Widerstand
- Die politische Verantwortung der Christen
- Kirchenkampf und Flüchtlingshilfe
- Der Krieg beginnt, die Ökumene schweigt
- Intrigen und Trauer in der Familie
- Aufruf zum militärischen Widerstand und die Schweizer Zensur
- Ein Freund der Deutschen trotzdem
- 319–368 12 «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel 1945–1962 319–368
- Kriegsende und Schulderklärung
- Zurück in Bonn und noch einmal Staat und Kirche
- «Gottes geliebte Ostzone»: Gegen den Antikommunismus
- Also doch Pazifist? Protest gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung
- Ja zur Ökumene, aber ohne Katholiken
- Der Meister mit der krumpeligen Krawatte
- Die Entdeckung des Optimismus im Gefängnis
- Mut, Tempo, Reinheit, Friede: Bekenntnis zu Mozart
- Kinder, Enkel und ein abgelehnter Wunschnachfolger
- 369–390 13 «Weißer Wal»: Die Kirchliche Dogmatik 369–390
- «Spiralenförmige Gedankengänge»: Barths Monumentalwerk
- Die dreifache Gestalt des Wortes Gottes
- Drei Seinsweisen Gottes
- «Gott ist» heißt «Gott liebt»
- Wen Gott erwählt
- Was Gott gebietet
- Warum Gott die Schöpfung will
- Das Nichtige und die Schattenseiten der Schöpfung
- Drei Ämter Christi und drei Gestalten der Sünde
- Das Licht leuchtet, wo es will
- Wassertaufe und Geisttaufe
- 391–416 14 «Alles in allem ein bisschen müde»: Die letzten Jahre, Basel 1962–1968 391–416
- «Fantastic»: Ein Calvinist in den USA
- «Lebensregeln für ältere Menschen im Verhältnis zu jüngeren»
- «Wie tief verschleiert»: Charlotte von Kirschbaum muss ausziehen
- «Getrennte Brüder»: Im Gespräch mit Rom
- Späte Freundschaft mit Carl Zuckmayer
- Unvollendetes Mammutwerk
- Am Ende des Lebensweges
- 417–420 Epilog 417–420
- 421–539 Anhang 421–539
- Dank
- Zeittafel
- Anmerkungen
- Literaturverzeichnis
- Bildnachweis
- Personenregister