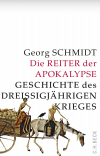Die Reiter der Apokalypse
Geschichte des Dreißigjährigen Krieges
Zusammenfassung
Mit dem berühmten Prager Fenstersturz im Mai 1618 begann ein gewaltiger Krieg, der Millionen Menschenleben fordern und drei Jahrzehnte andauern sollte. Bis heute ist diese beispiellose historische Katastrophe von Mythen überwuchert. Georg Schmidt, einer der großen Kenner der Epoche, legt aus Anlass des 400. Jahrestages eine Gesamtdarstellung des Dreißigjährigen Krieges auf dem neuesten Stand der Forschung vor.
„Die Reiter der Apokalypse“ – das waren Krieg, Hunger und Seuchen, die einen millionenfachen Tod brachten und weite Teile Mitteleuropas verwüsteten. In seiner großen Geschichte des Dreißigjährigen Krieges verknüpft Georg Schmidt souverän das politische und militärische Geschehen mit Tagebuchaufzeichnungen, Predigten und anderen zeitgenössischen Quellen, die beklemmend anschaulich zeigen, wie der Krieg erfahren und durchlitten wurde: als Strafe Gottes, als Kampf um die deutsche Freiheit, als blutiger Weg zu einem neuen Frieden. So ist ein grandioses Panorama entstanden, das zugleich das Geschehen historisch deutet und einordnet: in das große religiöse Ringen von Reformation und Gegenreformation, den Machtkampf zwischen der Habsburgermonarchie und den Reichsständen, die Ziele der Nachbarstaaten und die undurchsichtigen Ränkespiele eines Wallenstein.
- 1–9 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–9
- 10–26 Prolog 10–26
- 10–13 Eine Geschichte 10–13
- 13–17 Ein Komet 13–17
- 17–19 Die Reiter der Apokalypse 17–19
- 19–26 Die Erzählung 19–26
- 26–152 I. Spuren 26–152
- 26–63 1. Ungewissheiten oder warum die Freiheit ängstigte 26–63
- Die humanistische Öffnung
- Der reformatorische Umbruch
- Freiheit und Vaterland
- Deutsche Freiheit
- Türkenangst
- 63–107 2. Verhärtungen oder wie die Menschen Gott vereinnahmten 63–107
- Die Konfessionalisierung
- Der niederländische Freiheitskampf
- Die französischen Bürgerkriege
- Die kleine Eiszeit
- Wachsende Ungleichheit
- Der Hexenwahn
- Der prekäre Religionsfrieden
- 107–152 3. Krise oder wie Krieg zur Option wurde 107–152
- Der Reichs-Staat
- Union und Liga
- Der habsburgische Bruderzwist
- Konfrontation und Kompositionspolitik
- Meinungen und Inszenierungen
- Friedensappelle
- Das europäische Staatengefüge
- 152–546 II. Dreissig Jahre 152–546
- 152–209 4. Böhmen oder wie ein regionaler Konflikt eskalierte 152–209
- Die Tat
- Das Zeichen
- Krieg in Böhmen
- Zwei Wahlen
- Weichenstellungen
- Die Schlacht
- Kipper und Wipper
- 209–249 5. An den Rhein und nach Norden oder warum der Krieg immer neue Gebiete erfasste 209–249
- Grenzüberschreitungen
- Das Ende der Kurpfalz
- Eine instabile Ordnung
- Vorstoß nach Norden
- Die dänische Intervention
- 249–284 6. Wallenstein oder wie der Krieg funktionierte 249–284
- Der Aufstieg
- Keplers Horoskope
- Friedlands Wohlstand
- Kriegskredite
- Söldner
- Militärgesellschaft
- Waffen
- 284–342 7. Das Meer oder wie imperiale Visionen scheiterten 284–342
- Siegeszug
- Widerstand
- Dänische Niederlage
- Friedenswunsch und Kriegsziele
- Der Lübecker Friede
- Europäische Kriegsschauplätze
- Das Restitutionsedikt
- Entlassung
- 342–389 8. Werkzeug Gottes oder wie Gustav Adolf die Phantasie beflügelte 342–389
- Motive
- Aufladung
- Der Leipziger Konvent
- Magdeburg
- Breitenfeld
- Pfaffengasse
- 389–428 9. Schicksal oder wie der Krieg seinen Helden verlor 389–428
- Die Rückberufung
- München
- Gräueltaten
- Vor Nürnberg
- Lützen
- Werkzeug Gottes
- 428–466 10. Verwirrspiele oder warum Wallenstein sterben musste 428–466
- Der Heilbronner Bund
- Irrungen und Wirrungen
- Ein präventiver Mord
- Ein Kriegsjahr
- Nördlingen
- 466–505 11. Der Prager Frieden oder warum der Krieg weiterging 466–505
- Die Prager Koalition
- Nationale Begeisterung
- Das Ende einer Illusion
- Schwedischer Behauptungswille
- Ein neuer Kaiser
- Alternative Friedenspläne
- 505–546 12. Uneinsichtigkeiten oder warum sich das Leiden verlängerte 505–546
- Herzog Bernhards Krieg
- In Deutschlands Mitte
- Der Reichstag
- Schwedische Siege
- Vor dem Friedenskongress
- Der dänisch-schwedische Krieg
- Die Schweden vor Wien
- 546–671 III. Der Frieden 546–671
- 546–584 13. Arrangements oder was zu regeln war 546–584
- Die Ziele
- Die Kongressorte
- Die Delegierten
- Das Zeremoniell
- Grundprobleme
- Entschädigungen
- 584–619 14. Der Vertrag oder warum es so lange dauerte 584–619
- Der Hessenkrieg
- Religionsfragen
- Nebeneinander
- Letzte Gefechte
- Verständigungen
- Das Reichsgrundgesetz
- Der Exekutionstag
- 619–671 15. Bilanzen oder wie der Krieg bewältigt wurde 619–671
- Opfer
- Landwirtschaft
- Gewerbe, Handel und Geld
- Fürstenstaaten und Reichs-Staat
- Deutsche Nation
- Schule und Wissenschaft
- Architektur und Kunst
- Literatur und Musik
- Konfessionsfragen
- Friedensfeiern
- 671–698 Epilog 671–698
- 671–675 Gedächtnis 671–675
- 675–680 Urkatastrophe 675–680
- 680–683 Trauma 680–683
- 683–686 Mythos 683–686
- 686–698 Fazit 686–698
- 698–699 Dank 698–699
- 699–767 Anmerkungen 699–767
- 767–798 Literaturverzeichnis 767–798
- 798–800 Abbildungsnachweis 798–800
- 800–810 Personenregister 800–810
- 810–812 Karten 810–812