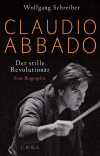Claudio Abbado
Der stille Revolutionär
Zusammenfassung
Claudio Abbado war der stille Revolutionär unter den großen Dirigenten. So leise er auftrat und auf jeden autoritären Habitus verzichtete, so ausdrucksmächtig war seine Musik. Dabei lebte er ganz in der Gegenwart, dirigierte für Arbeitet und setzte sich unermüdlich für die musizierende Jugend ein. Wolfgang Schreiber folgt in dieser ersten umfassenden Biographie dem an Glanzpunkten überreichen Lebensweg Abbados, der in der Musikwelt zwischen Mailand und London, zwischen Chicago und Berlin unauslöschliche Spuren hinterließ.
- 2–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–8
- 9–13 1. Der Club der Freunde 9–13
- 13–31 2. Kindheit und Jugend (1933–1949) 13–31
- 13–21 «Das klingende Haus» 13–21
- 21–31 «Lesen macht geheimnisvoll» 21–31
- 31–47 3. Studium in Mailand und Wien (1949–1958) 31–47
- 31–34 Ausflüge in die Literaturgeschichte: Salvatore Quasimodo 31–34
- 34–35 Siena-Kurs: Zubin Mehta und Daniel Barenboim 34–35
- 35–36 Erste Liebe 35–36
- 36–47 Wien: der Lehrer Hans Swarowsky 36–47
- 47–57 4. Erste Preise und Pult-Eroberungen (1958–1968) 47–57
- 47–50 Dozent für Kammermusik in Parma 47–50
- 50–54 Aufbruch in die Neue Welt: Leonard Bernstein in New York 50–54
- 54–57 Beginn der Dirigentenkarriere 54–57
- 57–81 5. Der Opern-Kanon: Teatro alla Scala (1968–1986) 57–81
- 57–73 Mailänder Innovationen 57–73
- 73–81 Claudio Abbados «Kernrepertoire» der Oper 73–81
- 81–101 6. «Musica/Realtà»: Claudio Abbado, Luigi Nono und Maurizio Pollini 81–101
- 101–111 7. Claudio Abbado und seine Jugendorchester 101–111
- 111–117 8. Viele Ämter am Pult (1972–1985) 111–117
- 117–127 9. Das London Symphony Orchestra (1979–1987) 117–127
- 127–155 10. «Im Palast der Gefühle»: Wiener Staatsoper (1986–1991) 127–155
- 127–137 «Wien modern» 127–137
- 137–145 Programmgestaltung 137–145
- 145–147 Neue Liebe 145–147
- 147–155 Abschied von Wien 147–155
- 155–195 11. Berliner Philharmoniker I (1989–1998) 155–195
- 155–159 Das Orchester und seine Dirigenten 155–159
- 159–167 Die Wahl 159–167
- 167–170 Das erste Jahr in Berlin 167–170
- 170–179 Probenstil und Musizierideal: auf Wilhelm Furtwänglers Spuren 170–179
- 179–185 «Musik über Berlin» 179–185
- 185–193 Gastspiele, Reisen und Salzburger Osterfestspiele 185–193
- 193–195 Der Siemens Musikpreis 193–195
- 195–223 12. Claudio Abbados Berliner Themenzyklen 195–223
- 195–201 Zyklus 1: Hölderlin (1993) 195–201
- 201–202 Zyklus 2: Faust (1994) 201–202
- 202–205 Zyklus 3: Griechische Antike (1994/95) 202–205
- 205–207 Zyklus 4: Shakespeare (1995/96) 205–207
- 207–209 Zyklus 5: Alban Berg/Georg Büchner (1996/97) 207–209
- 209–212 Zyklus 6: Der Wanderer (1997/98) 209–212
- 212–216 Zyklus 7/8: «Tristan und Isolde – Der Mythos von Liebe und Tod» / «Amore e morte» (1998/99) 212–216
- 216–219 Zyklus 9: «Musik ist Spaß auf Erden» (2000/01) 216–219
- 219–223 Zyklus 10: Parsifal (2001/02) 219–223
- 223–235 13. Berliner Philharmoniker II (1998–2002) 223–235
- 223–228 Schock der Berliner Verzichterklärung 223–228
- 228–235 Das Berliner Abschiedskonzert 228–235
- 235–251 14. Das Orchester aus Freunden: Luzern (2003–2013) 235–251
- 235–248 Das Lucerne Festival Orchestra 235–248
- 248–251 Immer wieder Berlin 248–251
- 251–265 15. Italien und Lateinamerika 251–265
- 251–256 Das Orchestra Mozart 251–256
- 256–259 Heimkehr an die Mailänder Scala 256–259
- 259–265 Engagement in Lateinamerika: «El Sistema» 259–265
- 265–277 16. Spätes Musizieren – verinnerlichtes Hören 265–277
- 265–274 Symphonisches Weltbild 265–274
- 274–277 Schallplattenproduktion 274–277
- 277–291 17. Tod und Verklärung 277–291
- Begegnung mit einem Charakter
- 291–321 Anhang 291–321
- 291–307 Anmerkungen 291–307
- 307–311 Diskographie 307–311
- 311–313 Bildnachweis 311–313
- 313–321 Personenregister 313–321
- 321–321 Zum Buch 321–321