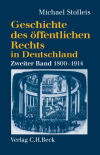Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland Bd. 2: Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914
Zusammenfassung
Dem 1988 vorgelegten ersten Band einer Wissenschaftsgeschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland (1600-1800) folgt hier der zweite Band. Er behandelt das 19. Jahrhundert - vom Ende des Alten Reichs 1806 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es ist die Zeit des Rheinbundes und des Wiener Kongresses, der Restauration und des "Biedermeier", der Verfassungsbewegung in den Staaten des Deutschen Bundes, der Revolution von 1848/49, der erneuten Restauration, des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs von 1871. Auf diesem Hintergrund entfalten sich die Staatsrechtslehre des Deutschen Bundes und der Einzelstaaten sowie die übergreifenden Deutungen der Allgemeinen Staatslehre. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kommen Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre als Erben der "Polizeiwirtschaft" hinzu. Das Buch hält zwar die Bilder der Verfassungskämpfe, der politischen Unterdrückung und der National- und Freiheitsbewegung stets präsent. Im Mittelpunkt des Interesses stehen aber nicht Ereignis- und Verfassungsgeschichte, sondern das staatsrechtliche und staatsphilosophische Denken, die Wechselwirkung zwischen theoretischem System und politischem Kontext sowie die schrittweise Herausbildung einer der Verfassungslage und dem Postulat des Rechtsstaats entsprechenden Verwaltungslehre. Michael Stolleis geht diesen Entwicklungen nicht nur auf den unterschiedlichen Ebenen nach, sondern er würdigt außer den Berühmtheiten auch die heute gänzlich vergessenen lokalen Autoren. Auf diese Weise gelingt ihm für das 19. Jahrhundert der "Versuch..., die Wissenschaftsgeschichte des öffentlichen Rechts zu rekonstruieren und sie mit der Verfassungsgeschichte und der allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Geschichte möglichst eng zu verbinden". Das Buch endet mit Reflexionen über den für Deutschland schicksalhaften Transformationsprozeß vom Nationalstaat zum Staat der Industriegesellschaft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.
- 1–13 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–13
- 14–16 Abkürzungen 14–16
- 16–38 Quellen 16–38
- 38–75 Erstes Kapitel: Das deutsche öffentliche Recht um 1800 38–75
- 38–47 I. Vom aufgeklärten Absolutismus zum konstitutionellen Zeitalter in Deutschland 38–47
- 1. Zäsuren der Wissenschaftsgeschichte
- 2. Die Epochenwende
- 3. Sozialgeschichtliche Bedingungen
- 47–57 II. Die Reichspublizistik in der Spätphase des Reiches 47–57
- 1. Die Tradition und der Bruch von 1806
- 2. Naturrechtslehre und Frühkonstitutionalismus
- 3. Öffentliches und privates Recht
- 4. Die letzten Reichspublizisten
- 57–61 III. Der Untergang des Reichs und Preußens Niederlage 57–61
- 61–75 IV. Rheinbund und Rheinbundliteratur 61–75
- 1. Die politische und literarische Lage
- 2. Die neue Souveränität
- 3. Der Rheinbund als Bundesstaat
- 4. Zusammenfassung
- 75–120 Zweites Kapitel: Wiener Kongreß und Deutscher Bund (1815–1848) 75–120
- 75–80 I. Der Wiener Kongreß und die Gründung des Deutschen Bundes 75–80
- 80–95 II. Staatsrechtslehre im Vormärz 80–95
- 1. J. L. Klüber
- 2. Rechtsquellen, Grundrisse
- 3. K. E. Weiß, H. Zöpfl
- 4. H. A. Zachariä
- 95–120 III. Dogmatische Grundpositionen 95–120
- 1. Die Möglichkeit eines «gemeinen deutschen Staatsrechts»
- 2. «Verfassung»
- 3. Das «monarchische Prinzip»
- 4. Ministerverantwortlichkeit, Gegenzeichnung
- 5. Staatssouveränität und «juristische Person»
- 6. Die Volksvertretungen und ihre Rechte
- a) Landstände oder Parlamente?
- b) Zweikammersystem, Wahlrecht, Staatsrat
- c) Gesetzesvorbehalt und Grundrechte
- 7. Die Dritte Gewalt
- 8. Verfassung und Militär
- 9. Staatsrechtslehre und Politik
- 120–186 Drittes Kapitel: Die «allgemeine Staatslehre» im Vormärz 120–186
- 120–155 I. Konservativismus, Romantik, Restauration 120–155
- 1. Einleitung
- a) Terminologie
- b) Von der «Maschine» zum «Organismus»
- c) Antirationalismus und Antiindividualismus
- 2. Der Denkweg zur «Identität»
- a) J. G. Fichte
- b) F. W. Schelling
- c) G. W. F. Hegel
- d) Identitätsphilosophie im politischen Kontext
- 3. Politische Romantik
- 4. Restauration der Staatswissenschaft
- a) K. L. v. Haller
- b) F. v. Gentz
- c) F. Ancillon
- d) C. E. Jarcke
- 5. Konservative Allgemeine Staatslehre
- 6. F. J. Stahl
- 7. Zusammenfassung
- 155–186 II. Liberalismus 155–186
- 1. Gruppierungen
- 2. Entwicklungsstufen
- 3. Der vernunftrechtliche Liberalismus
- a) K. v. Rotteck
- b) J. Chr. v. Aretin, W. J. Behr
- c) K. H. L. Pölitz
- d) F. Murhard
- e) K. E. Schmid
- f) S. Jordan
- 4. C. S. Zachariä
- 5. R. v. Mohl
- 6. Der «historisch-organische» Liberalismus
- a) C. Th. Welcker
- b) P. A. Pfizer
- c) F. Chr. Dahlmann
- d) F. Schmitthenner
- 7. Zusammenfassung
- 186–228 Viertes Kapitel: Das Staatsrecht der einzelnen Bundesstaaten 186–228
- 186–192 I. Die Verfassungsbewegung 186–192
- 192–228 II. Literatur zum Landesstaatsrecht vor 1848 192–228
- 1. Württemberg
- 2. Bayern
- 3. Baden
- 4. Kurhessen
- 5. Hessen-Darmstadt, Nassau
- 6. Hannover
- 7. Braunschweig
- 8. Mecklenburg
- 9. Sachsen, Thüringen
- a) Königreich Sachsen
- b) Die sächsisch-thüringischen Kleinstaaten
- 10. Schleswig, Holstein, Lauenburg
- 11. Die freien Städte
- 12. Preußen
- 13. Österreich
- 228–265 Fünftes Kapitel: Die Anfänge des Verwaltungsrechts vor 1848 228–265
- 228–242 I. Einleitung 228–242
- 1. Überblick
- 2. Verwaltungsausbildung
- 3. Wandel der Staatsaufgaben
- 4. Verwaltungskontrolle
- 242–257 II. Polizeiwissenschaft, Polizeirecht, Verwaltungsrecht 242–257
- 1. Policeywissenschaft vor 1800
- 2. Polizeiwissenschaft im Übergang zum Frühkonstitutionalismus
- a) G. H. v. Berg
- b) Polizeiwissenschaft bis 1830
- 257–265 III. Die erste Phase eines eigenständigen Verwaltungsrechts 257–265
- 1. R. v. Mohl
- 2. Verwaltungsrecht vor 1848
- 3. Zusammenfassung
- 265–280 Sechstes Kapitel: Die Staatsrechtslehre in der Revolution von 1848 265–280
- 265–273 I. Die deutsche Revolution 265–273
- 1. «Politische Professoren»
- 2. Die Revolution von 1848/49
- a) Universitäten
- b) Länder
- c) Nationalversammlung
- 273–280 II. Die Folgen 273–280
- 1. Die Enttäuschung
- 2. «Realpolitik»
- 3. Die Wendung zum Positivismus
- 4. Entwicklungsperspektiven
- 280–321 Siebentes Kapitel: Staats- und Verwaltungsrecht der Einzelstaaten bis 1914 280–321
- 280–283 I. Die Ausgangslage nach 1850 280–283
- 283–317 II. Die Entwicklung in den einzelnen Staaten 283–317
- 1. Bayern
- 2. Württemberg
- 3. Baden
- 4. Hessen-Darmstadt
- 5. Preußen
- 6. Österreich-Ungarn
- 7. Sachsen
- 8. Thüringen, Braunschweig, Oldenburg, Lippe, Mecklenburg
- 9. Elsaß-Lothringen
- 10. Die freien Städte
- 317–321 III. Zusammenfassung 317–321
- 321–380 Achtes Kapitel: Allgemeines Deutsches Staatsrecht – Reichsstaatsrechtslehre 321–380
- 321–329 I. Allgemeines Deutsches Staatsrecht bis zur Reichsgründung (1850–1866) 321–329
- 1. Einleitung
- 2. Die Kompendien des Bundesstaatsrechts
- 3. Neuere Darstellungen vor 1866
- a) J. v. Held
- b) G. A. Grotefend
- c) K. v. Kaltenborn
- d) O. Mejer
- e) H. Schulze (v. Gaevernitz)
- 329–347 II. «Juristische Methode» und Reichsstaatsrechtslehre 329–347
- 1. Methodenwandel im Zivilrecht
- 2. Methodenwandel im öffentlichen Recht: C. F. v. Gerber
- 3. Der Einbruch des positiven Staatsrechts
- a) Staatsrecht des Norddeutschen Bundes
- b) Reichsstaatsrecht und Übergang zum Gesetzespositivismus
- 4. P. Laband
- 347–363 III. Die Staatsrechtslehre bis zum Weltkrieg 347–363
- 1. Zeitgenossen und Opponenten Labands
- 2. Der historisch fundierte Positivismus
- a) G. Meyer
- b) G. Anschütz
- c) H. Schulze
- 3. Materiale Staatsrechtslehre
- 4. Genossenschaftslehre und Selbstverwaltung als Gegenmodelle
- a) O. v. Gierke
- b) H. Preuß
- c) H. Rosin
- 363–377 IV. Die dogmatischen Hauptfragen 363–377
- 1. Bundesstaat oder Staatenbund
- 2. Die «juristische Person» und ihre Organe
- 3. Gesetz und Verordnung, der doppelte Gesetzesbegriff
- 4. Grundrechte und subjektiv-öffentliche Rechte
- 5. Ungeschriebenes Verfassungsrecht –Verfassungswandel
- 377–380 V. Zeitschriften 377–380
- 380–422 Neuntes Kapitel: Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungslehre 1850–1914 380–422
- 380–409 I. Die Entwicklung des Verwaltungsrechts seit 1850 380–409
- 1. Einleitung
- 2. Staatswissenschaftliche Konzepte
- a) R. v. Gneist
- b) L. v. Stein
- c) H. Roesler
- 3. Die Entstehung eines «Allgemeinen Teils»
- a) Die Anfänge
- b) F. F. Mayer
- c) E. v. Meier
- d) G. Meyer
- e) O. v. Sarwey
- f) E. Loening
- g) K. Frhr. v. Stengel
- 4. Die Vollendung des «Allgemeinen Teils» durch Otto Mayer
- 5. Die Entwicklung bis 1914
- 409–416 II. Dogmatische Positionen 409–416
- 1. Verwaltungsakt, Besonderes Gewaltverhältnis, öffentlichrechtlicher Vertrag
- 2. Öffentliches Eigentum
- 3. Gesetzesbindung des Verwaltungshandelns
- 4. Institutionelle Formen
- 416–418 III. Zeitschriften 416–418
- 418–422 IV. Die Verwaltungslehre 418–422
- 1. Der Ausklang der Polizeiwissenschaft
- 2. Stein und seine Nachfolger
- 422–459 Zehntes Kapitel: Allgemeine Staatslehre 1850–1914 422–459
- 422–425 I. Die letzten Jahre des Deutschen Bundes 422–425
- 1. Die Wendung zu den «Tatsachen»
- 2. Terminologie und Abgrenzungen
- 425–434 II. Naturrecht und Spätidealismus 425–434
- 1. K. Ch. F. Krause und H. Ahrens
- 2. L. J. Gerstner, H. Bischof
- 3. J. C. Bluntschli
- 4. J. v. Held
- 434–446 III. Die realistische Staatsauffassung 434–446
- 1. Die Wendung zum Naturalismus
- 2. Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht
- 3. «Zeit der Dürre»: Vom Norddeutschen Bund bis zur Jahrhundertwende
- 4. Außenseiter
- a) L. Gumplowicz
- b) G. Ratzenhofer
- c) A. Menger
- d) F. Oppenheimer
- 446–454 IV. Fin de Siècle 446–454
- 1. Zentrifugale Tendenzen
- 2. Die Synthese: Georg Jellinek (1851–1911)
- 454–459 V. Nationalstaat oder Staat der Industriegesellschaft? 454–459
- 459–485 Anhang 459–485
- 459–464 Sachregister 459–464
- 464–474 Personenregister (Primärliteratur) 464–474
- 474–485 Personenregister (Sekundärliteratur) 474–485