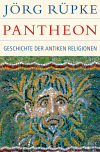Pantheon
Geschichte der antiken Religionen
Zusammenfassung
Dieses umfassende, reich bebilderte Werk zur Geschichte der antiken Religionen eröffnet einen neuen Zugang zur Alten Welt. Im Zentrum der faszinierenden Darstellung steht der Zeitraum vom Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. bis zur Ausbreitung des Christentums in der Spätantike. Der international renommierte Religionswissenschaftler Jörg Rüpke erzählt hier unter anderem von der Errichtung der ersten monumentalen Grabanlagen in Etrurien, von Tempelbauprojekten, von Priestern, Gläubigen und Ritualen, vom Kaiserkult und von den Versuchen Intellektueller, Religion in Wissen zu verwandeln. Er schaut, wo immer möglich, Frauen und Männern über die Schultern, die religiöse Erfahrungen in dunklen Heiligtümern oder vor Hausaltären machten, durch Gebet und Inschriften über den eigenen Tod hinaus in Erinnerung bleiben wollten oder beispielsweise nicht verstanden, warum ein neuer Gott von ihnen Verhaltensänderungen im Alltag erwartete. So eröffnet er seinen Leserinnen und Lesern das ungewöhnliche Panorama eines ebenso bedeutenden wie fremden Lebensbereichs der Antike.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–34 I Eine Religions-Geschichte 13–34
- 1 Was heißt mediterrane Religionsgeschichte?
- 2 Religion
- 3 Facetten religiöser Kompetenz
- Religiöses Handeln
- Religiöse Identität
- Religiöse Kommunikation
- 4 Religion als individuelle Strategie
- 35–66 II Medienrevolutionen im eisenzeitlichen Italien (9. – 7. Jh. v. Chr.) 35–66
- 1 Das Besondere
- Religion der frühen Eisenzeit: Methodische Überlegungen
- 2 Der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit im Mittelmeerraum
- Der Raum
- Entwicklungsmodelle und Entwicklungen
- 3 Deponierungen
- 4 Bestattungen
- 5 Götter, Bilder und Bankette
- Bilder
- Tempel und religiöse Differenzierung
- 67–94 III Religiöse Infrastruktur (7. – 5. Jh. v. Chr.) 67–94
- 1 Häuser für Götter
- Innovation
- Investitionen
- 2 Tempel und Altar?
- Religiöse Kommunikation
- 3 Dynamiken des sechsten und fünften Jahrhunderts
- Investition in Religion
- 95–120 IV Religiöse Praktiken (6. – 3. Jh. v. Chr.) 95–120
- 1 Körpereinsatz
- Wessen Kopf ist das?
- Im Gespräch bleiben
- Gelübde
- 2 Sakralisierung
- Klassifikationen
- Strategien
- 3 Komplexe Rituale
- Kalender
- 4 Erzählungen und Bilder
- 121–165 V Akteure: Aneignung und Gestaltung religiöser Praktiken (5. – 1. Jh. v. Chr.) 121–165
- 1 Heterarchie und Aristokratie
- 2 Priester
- Jungfrauen der Vesta
- Pontifices und Auguren
- 3 Distinktion
- Priesterkarrieren
- Tempelbau
- 4 Bankettkultur
- Bacchus
- 5 Massenkommunikation
- Spiele
- Kriege
- Krieg in Rom
- 6 Das Göttliche
- Auspizien
- Polisreligion
- 166–191 VI Reden und Schreiben über Religion (3. – 1. Jh. v. Chr.) 166–191
- 1 Schriftlichkeit von Ritual
- Disciplina etrusca
- 2 Selbst- und Fremdbeobachtung
- Mythen und Mythenkritik
- 3 Systematisierung
- Geschichtsschreibung und Handreichungen
- Wissen und Autorität
- «Religion»
- 192–217 VII Verdoppelung von Religion in der augusteischen Sattelzeit (1. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.) 192–217
- 1 Restauration als Innovation
- Augustus
- Netzwerke
- Rituale
- Verknappung von Religion
- 2 Religion im Raum
- Tempelbau
- 3 Verdoppelung von Religion
- Münzen
- Statuen und Kalender
- Texte
- 218–269 VIII Gelebte Religion (1. – 2. Jh. n. Chr.) 218–269
- 1 Die Einzelnen in ihren Weltbeziehungen
- 2 Haus und Familie
- Kombinationen
- 3 Religiöses Handeln lernen
- 4 Orte religiöser Erfahrung
- Schlafzimmer
- Gärten
- Gräber
- Grabprojekte
- 5 Hausgötter
- Lares
- 6 Gelebte Religion statt Hauskult
- 270–302 IX Neue Götter (1. Jh. v. Chr. – 2. Jh. n. Chr.) 270–302
- 1 Rahmenbedingungen
- 2 Isis und Serapis
- 3 Augusti: Initiative
- Institutionen
- Kontrolle
- Präsenz und Absenz
- 4 Das eigene Selbst
- 5 Resümee
- 303–334 X Experten und Anbieter (1. – 3. Jh. n. Chr.) 303–334
- 1 Religiöse Autorität
- 2 Expertinnen und Experten
- 3 «Öffentliche Priester» und religiöse Innovation
- 4 Prophetinnen und Visionäre
- 5 Religionsstifter
- 6 Veränderungen
- 335–370 XI Imaginäre und reale Gemeinschaften (1. – 3. Jh. n. Chr.) 335–370
- 1 Textgemeinschaften
- Gruppenbildung durch Texte
- Textualisierung von Religion
- 2 Erzählungen
- Das Imperium Romanum als erzählerischer Rahmen
- Biographische Schemata
- Erzählerisches Diversifizieren und der Ausbau von Netzwerken
- 3 Historisierungen und der Ursprung des Christentums
- Jüdische Kontexte
- Die Erfindung des Christentums
- 4 Religiöse Erfahrungen und Identitäten
- 371–394 XII Grenzziehungen und Gemeinsamkeiten (3. – 4. Jh. n. Chr.) 371–394
- 1 Der Marktwert religiösen Wissens
- 2 Politische Akteure
- Herrschaftsinteressen
- 3 Umgang mit Unterschieden
- Bibelepik
- 4 Konkurrenzen
- 395–399 XIII Epilog 395–399
- 400–560 Anhang 400–560
- Danksagung
- Anmerkungen
- Bibliographie
- Bildnachweis
- Register