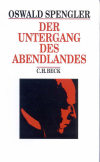Der Untergang des Abendlandes
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte
Zusammenfassung
Oswald Spenglers "Untergang des Abendlandes" gehört zu den meistgelesenen geschichtsphilosophischen Werken des 20. Jahrhunderts. Trotz der Kritik, die an seinen historischen, philosophischen und politischen Aussagen geübt worden ist, hat das Buch bis heute seinen Platz als Klassiker der Zivilisationskritik behauptet. In jüngster Zeit haben seine Thesen im Zusammenhang mit der Debatte über das "Ende der Geschichte" neue Aktualität gewonnen.
- I–XV Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XV
- 1–565 ERSTER BAND: GESTALT UND WIRKLICHKEIT 1–565
- 1–82 EINLEITUNG 1–82
- Die Aufgaben
- Morphologie der Weltgeschichte – eine neue Philosophie
- Für wen gibt es Geschichte?
- Die Antike und Indien unhistorisch
- Ägypten: Mumie und Totenverbrennung
- Die Form der Weltgeschichte. Altertum – Mittelalter – Neuzeit
- Entstehung dieses Schemas
- Seine Zersetzung
- Westeuropa kein Schwerpunkt
- Goethes Methode die einzig historische
- Wir und die Römer
- Nietzsche und Mommsen
- Probleme der Zivilsachen
- Imperialismus als Ausgang
- Notwendigkeit und Tragweite des Grundgedankens
- Verhältnis zur heutigen Philosophie
- Deren letzte Aufgabe
- Entstehung des Buches
- 83–83 TAFELN ZUR VERGLEICHENDEN MORPHOLOGIE DER WELTGESCHICHTE 83–83
- 83–136 ERSTES KAPITEL: VOM SINN DER ZAHLEN 83–136
- Grundbegriffe
- Die Zahl als Zeichen der Grenzsetzung
- Jede Kultur hat eine eigene Mathematik
- Die antike Zahl als Größe
- Weltbild des Aristarch
- Diophant und die arabische Zahl
- Die abendländische Zahl als Funktion
- Weltangst und Weltsehnsucht
- Geometrie und Arithmetik
- Die klassischen Grenzprobleme
- Überschreiten der Grenze des Sehsinnes. Symbolische Raumwelten
- Letzte Möglichkeiten
- 137–221 ZWEITES KAPITEL: DAS PROBLEM DER WELTGESCHICHTE 137–221
- I. Physiognomik und Systematik
- Kopernikanische Methode
- Geschichte und Natur
- Gestalt und Gesetz
- Physiognomik und Systematik
- Kultur als Organismen
- Innere Form, Tempo, Dauer
- Gleichartiger Bau
- „Gleichzeitigkeit“
- II. Schicksalsidee und Kausalitätsprinzip
- Organische und anorganische Logik
- Zeit und Schicksal, Raum und Kausalität
- Das Zeitproblem
- Die Zeit Gegenbegriff zum Raum
- Die Zeitsymbole (Tragik, Zeitmessung, Bestattung)
- Die Sorge (Erotik, Staat, Technik)
- Schicksal und Zufall
- Zufall und Ursache
- Zufall und Stil des Daseins
- Anonyme und persönliche Epochen
- Zukunftsrichtung und Bild der Vergangenheit
- Gibt es eine Geschichtswissenschaft?
- Die neue Fragestellung
- 222–293 DRITTES KAPITEL: MAKROKOSMOS 222–293
- I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem
- Der Makrokosmos als Inbegriff der Symbole in bezug auf eine Seele
- Raum und Tod
- „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“
- Das Raumproblem: Nur die Tiefe ist raumbildend
- Die Raumtiefe als Zeit
- Geburt der Weltanschauung aus dem Ursymbol einer Kultur
- Das antike Ursymbol der Körper, das arabische die Höhle, das abendländische der unendliche Raum
- II. Apollinische, faustische, magische Seele
- Ursymbol, Architektur und Götterwelt
- Das ägyptische Ursymbol der Weg
- Ausdruckssprache der Kunst: Ornamentik oder Imitation
- Ornament und Früharchitektur
- Architektur des Fensters
- Der große Stil
- Stilgeschichte als Organismus
- Zur Geschichte des arabischen Stils
- Philologie der Kunsttechnik
- 294–392 VIERTES KAPITEL: MUSIK UND PLASTIK 294–392
- I. Die bildenden Künste
- Musik eine bildende Kunst
- Einteilung nach andern als historischen Gesichtspunkten unmöglich
- Die Auswahl der Künste als Ausdrucksmittel höherer Ordnung
- Apollinische und faustische Kunstgruppe
- Die Stufen der abendländischen Musik
- Die Renaissance als antigotische (antimusikalische) Bewegung
- Charakter des Barocks
- Der Park
- Symbolik der Farben. Farben der Nähe und Ferne
- Goldgrund und Atelierbraun
- Patina
- II. Akt und Portrait
- Arten der Menschendarstellung
- Portrait, Bußsakrament, Satzbau
- Die Köpfe antiker Statuen
- Kinder- und Frauenbildnisse
- Hellenistische Bildnisse
- Das Barockbildnis
- Lionardo, Raffael und Michelangelo als Überwinder der Renaissance
- Sieg der Instrumentalmusik über die Ölmalerei um 1670 (entsprechend dem Sieg der Rundplastik über das Fresko um 460 v. Chr.)
- Impressionismus
- Pergamon und Bayreuth: Ausgang der Kunst
- 393–493 FÜNFTES KAPITEL: SEELENBILD UND LEBENSGEFÜHL 393–493
- I. Zur Form der Seele
- Das Seelenbild eine Funktion des Weltbildes
- Psychologie eine Gegenphysik
- Apollinisches, magisches, faustisches Seelenbild
- Der „Wille“ im gotischen „Seelenraum“
- Die „innere Mythologie“
- Wille und Charakter
- Antike Haltungs- und faustische Charaktertragödie
- Symbolik des Bühnenbildes
- Tages- und Nachtkunst
- Popularität und Esoterik
- Das astronomische Bild
- Der geographische Horizont
- II. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus
- Die faustische Moral rein dynamisch
- Jede Kultur besitzt eine eigene Form von Moral
- Haltungs- und Willensmoral
- Buddha, Sokrates, Rousseau als Wortführer anbrechender Zivilisation
- Tragische und Plebejermoral
- Rückkehr zur Natur, Irreligion, Nihilismus
- Der ethische Sozialismus
- Gleicher Bau der Philosophiegeschichte in jeder Kultur
- Die zivilisierte Philosophie des Abendlandes
- 494–565 SECHSTES KAPITEL: FAUSTISCHE UND APOLLINISCHE NATURERKENNTNIS 494–565
- Die Theorie als Mythos
- Jede Naturwissenschaft von einer vorausgegangenen Revolution abhängig
- Statik, Alchymie, Dynamik als Theorien dreier Kulturen
- Atomlehren
- Unlösbarkeit des Bewegungsproblems
- Stil des „kausalen Geschehens“, der „Erfahrung“
- Gottgefühl und Naturerkenntnis
- Der große Mythos
- Antike, magische, faustische numina
- Der Atheismus
- Die faustische Physik als das Dogma von der Kraft
- Grenzen ihrer theoretischen – nicht technischen – Fortentwicklung
- Selbstzerstörung der Dynamik; Eindringen geschichtlicher Vorstellungen
- Ausgang der Theorie: Auflösung in ein System morphologischer Verwandtschaften
- 566–1205 ZWEITER BAND: WELTHISTORISCHE PERSPEKTIVEN 566–1205
- 566–665 ERSTES KAPITEL: URSPRUNG UND LANDSCHAFT 566–665
- I. Das Kosmische und der Mikrokosmos
- Pflanze und Tier
- Dasein und Wachsein
- Empfinden, Verstehen, Denken
- Bewegungsproblem
- Massenseele
- II. Die Gruppe der hohen Kulturen
- Geschichtsbild, Naturbild
- Menschen- und Weltgeschichte
- Zwei Zeitalter: Primitive und hohe Kulturen
- Überblick der hohen Kulturen
- Der gesichtslose Mensch
- III. Die Beziehungen zwischen den Kulturen
- „Einwirkung“
- Das römische Recht
- Magisches Recht
- Recht des Abendlandes
- 666–793 ZWEITES KAPITEL: STÄDTE UND VÖLKER 666–793
- I. Die Seele der Stadt
- Mykene und Kreta
- Der Bauer
- Weltgeschichte ist Stadtgeschichte
- Stadtbild
- Stadt und Geist
- Geist der Weltstadt
- Unfruchtbarkeit und Zerfall
- II. Völker, Rassen, Sprachen
- Daseinsströme und Wachstumsverbindungen
- Ausdruckssprache und Mitteilungssprache
- Totem und Tabu
- Sprache und Sprechen
- Das Haus als Rasseausdruck
- Burg und Dom
- Die Rasse
- Blut und Boden
- Die Sprache
- Mittel und Bedeutung
- Wort, Grammatik
- Sprachgeschichte
- Schrift
- Morphologie der Kultursprachen
- III. Urvölker, Kulturvölker, Fellachenvölker
- Völkernamen, Sprachen, Rassen
- Wanderungen
- Volk und Seele
- Die Perser
- Morphologie der Völker
- Volk und Nation
- Antike, arabische, abendländische Nationen
- 794–970 DRITTES KAPITEL: PROBLEME DER ARABISCHEN KULTUR 794–970
- I. Historische Pseudomorphosen
- Der Begriff 784 Actium
- Das Russentum
- Arabische Ritterzeit
- Der Synkretismus
- Juden, Chaldäer, Perser der Vorkultur
- Mission
- Jesus
- Paulus
- Johannes, Marcion
- Heidnische und christliche Kultkirche
- II. Die magische Seele
- Dualismus der Welthöhle
- Zeitgefühl (Ära, Weltgeschichte, Gnade)
- Consensus
- Das „Wort“ als Substanz, der Koran
- Geheime Tora, Kommentar
- Die Gruppe der magischen Religionen
- Der christologische Streit
- Dasein als Ausdehnung (Mission)
- III. Pythagoras, Mohammed, Cromwell
- Wesen der Religionen
- Mythos und Kultus
- Moral als Opfer
- Morphologie der Religionsgeschichte
- Die Vorkultur: Franken, Russen
- Ägyptische Frühzeit
- Antike
- China
- Gotik (Marien- und Teufelsglaube, Taufe und Buße)
- Reformation
- Die Wissenschaft
- Puritanismus
- Rationalismus
- „Zweite Religiosität“
- Römischer und chinesischer Kaiserkult
- Das Judentum
- 971–1154 VIERTES KAPITEL: DER STAAT 971–1154
- I. Das Problem der Stände: Adel und Priestertum
- Mann und Weib
- Stamm und Stand
- Bauerntum und Gesellschaft
- Stand, Kaste, Beruf
- Adel und Priestertum als Symbole von Zeit und Raum
- Zucht und Bildung, Sitte und Moral
- Eigentum, Macht und Beute
- Priester und Gelehrte
- Wirtschaft und Wissenschaft: Geld und Geist
- Geschichte der Stände: Frühzeit
- Der dritte Stand: Stadt – Freiheit – Bürgertum
- II. Staat und Geschichte
- Bewegtes und Bewegung, „In-Form-sein“
- Recht und Macht
- Stand und Staat
- Der Lehnstaat
- Vom Lehnsverband zum Ständestaat
- Polis und Dynastie
- Der absolute Staat, Fronde und Tyrannis
- Wallenstein
- Kabinettspolitik
- Von der ersten zur zweiten Tyrannis
- Die bürgerliche Revolution
- Geist und Geld
- Formlose Gewalten (Napoleonismus)
- Emanzipation des Geldes
- „Verfassung“
- Vom Napoleonismus zum Cäsarismus (Zeitalter der „kämpfenden Staaten“)
- Die großen Kriege
- Römerzeit
- Vom Kalifat zum Sultanat
- Ägypten
- Die Gegenwart
- Der Cäsarismus
- III. Philosophie der Politik
- Das Leben ist Politik
- Politische Begabung
- Der Staatsmann
- Tradition schaffen
- Physiognomischer (diplomatischer) Takt
- Stand und Partei
- Das Bürgertum als Urpartei (Liberalismus)
- Vom Stand über die Partei zum Gefolge von Einzelnen
- Die Theorie: Von Rousseau bis Marx
- Geist und Geld (Demokratie)
- Die Presse
- Selbstvernichtung der Demokratie durch das Geld
- 1155–1205 FÜNFTES KAPITEL: DIE FORMENWELT DES WIRTSCHAFTSLEBENS 1155–1205
- I. Das Geld
- Die Nationalökonomie
- Die politische und die wirtschaftliche Seite des Lebens
- Erzeugende und erobernde Wirtschaft (Landbau und Handel)
- Politik und Handel (Macht und Beute)
- Urwirtschaft und Wirtschaftsstil der hohen Kulturen
- Stand und Wirtschaftsklasse
- Das stadtlose Land: Denken in Gütern
- Die Stadt: Denken in Geld
- Weltwirtschaft: Mobilisierung der Güter durch das Geld
- Das antike Geld: Die Münze
- Der Sklave als Geld
- Das faustische Denken in Geld: Der Buchwert
- Die doppelte Buchführung
- Die Münze im Abendland
- Geld und Arbeit
- Der Kapitalismus
- Wirtschaftliche Organisation
- Erlöschen des Denkens in Geld: Diokletian. Das Wirtschaftsdenken der Russen
- II. Die Maschine
- Geist der Technik
- Primitive Technik und Stil der hohen Kulturen
- Antike „Technik“
- Die faustische Technik: Der Wille zur Macht über die Natur. Der Erfinder
- Rausch der modernen Erfindungen
- Der Mensch als Sklave der Maschine
- Unternehmer, Arbeiter, Ingenieur
- Ringen zwischen Geld und Industrie
- Endkampf zwischen Geld und Politik; Sieg des Blutes
- 1206–1226 NACHWORT von Detlef Felken 1206–1226
- 1227–1275 Register I: Personen und Sachen 1227–1275
- 1276–1280 Register II: Benutzte oder empfohlene Autoren 1276–1280