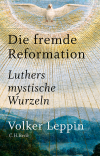Die fremde Reformation
Luthers mystische Wurzeln
Zusammenfassung
Die Reformation gilt als Zäsur, mit der das Mittelalter endet. Volker Leppin zeigt demgegenüber, dass der junge Luther einer von vielen mystischen Schriftstellern war, und führt uns eine Reformation vor Augen, die viel mittelalterlicher und fremder ist, als es die Meistererzählungen von diesem „Umbruch“ wahrhaben wollen. Der Thesenanschlag zu Wittenberg, die Urszene der Reformationsgeschichte, hat nicht stattgefunden. Vielmehr hat Luther an diesem Tag ein „Disputationszettelchen“ verschickt, so wie es akademischer Brauch war. Diese und viele andere überraschende Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn man Luther konsequent in seinem spätmittelalterlichen Umfeld betrachtet. Rechtfertigungslehre und „Priestertum aller Gläubigen“, Predigtgottesdienst, Papstkritik und landesherrliches Kirchenregiment – all dies war selbstverständlicher Teil des spätmittelalterlichen Spektrums an Positionen und Protesten. Neu war allerdings die Art, wie Luther diese Elemente miteinander verband und von unterschiedlichen Interessengruppen zum Vordenker erhoben wurde. Erst diese Gemengelage führte zur Zuspitzung des Konflikts mit Rom. Vergessen und verdrängt wurden dabei Luthers mystische Wurzeln. Volker Leppin ruft sie anschaulich in Erinnerung und gibt Luther den spätmittelalterlichen Kontext zurück, der ihm von Protestanten wie Katholiken seit Jahrhunderten vorenthalten wird.
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–10 Einleitung 9–10
- 11–34 I Luthers spätmittelalterliche Frömmigkeit 11–34
- Johann von Staupitz, der Beichtvater
- Johannes Tauler und die spätmittelalterliche Mystik
- Buße, Reue, Ablass
- Entdeckungen, Bekehrungen, Inszenierungen
- 35–64 II Von der mystischen Lektüre zu den 95 Thesen 35–64
- Süßester Trost
- Theologia deutsch und Die sieben Bußpsalmen
- Staupitz, Luther, Güttel: Die Propagierung der mystischen Sünden- und Gnadentheologie
- Humanistische Netzwerke und Disputationen gegen die Scholastik
- Was ist neu an den 95 Thesen?
- Luthers Meditationen über das Leiden und Sterben
- 65–84 III Von der Reform zur Kirchenkritik 65–84
- Wittenberg 1517: Briefe statt Thesenanschlag
- Ein Streit um die Wahrheit – und um den Papst
- Die Entdeckung des Publikums
- Heidelberg 1518: Zwischen Scholastik und Humanismus
- Augsburg 1518: Die Lösung von der Kirche zeichnet sich ab
- 85–116 IV Ketzer hier, Antichrist dort 85–116
- Mäzene und Machthaber: Die Päpste der Renaissance
- Rom 1518: Die Ausweitung der päpstlichen Macht
- Sola scriptura: Mit der einen Autorität gegen die Autoritäten
- Augsburg 1518 und die dreifache Exkommunikation
- Leipzig 1519: Für oder gegen den Papst?
- Zürich 1521: Klagen gegen Zwingli
- Wittenberg 1520: «Gegen die fluchwürdige Bulle des Antichrist»
- Worms 1521: Luther als christusgleicher Märtyrer
- 117–138 V Transformationen der Mystik 117–138
- Mystischer Geist und Gottes Wort
- Der Umbau der Sakramentenlehre
- Taufe und Abendmahl
- Die Befreiung der Sakramente
- Die Freiheit eines Christenmenschen
- 139–186 VI Von der Mystik zur Politik 139–186
- Luther und der «christliche Adel»
- Alle Getauften sind Priester
- Krieg für die Reformation: Franz von Sickingen
- Zwei Reiche, zwei Regimente
- Die Reformation der Bürger: Das Beispiel Nürnberg
- Zwingli und das Wurstessen in Zürich
- Bäuerliche Reformation
- Die Reformation der Fürsten
- Kirchenordnungen und Katechismen
- 187–208 VII Mystische Wege jenseits von Luther 187–208
- Ein innerweltliches Mönchtum
- Karlstadts mystische Radikalisierung
- Müntzers chiliastische Vision
- Täufer und Spiritualisten
- Luthers domestizierte Mystik
- Was ist lutherisch?
- 209–216 Epilog 209–216
- 217–247 Anhang 217–247
- Anmerkungen
- Bildnachweis
- Personenregister
- 248–248 Zum Buch 248–248
- 248–248 Über den Autor 248–248