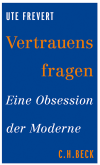Vertrauensfragen
Eine Obsession der Moderne
Zusammenfassung
«Vertrauen» – kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren eine so rasante Aufmerksamkeits- und Erregungskonjunktur zu verzeichnen. Auf Wahlplakaten und in der Produktwerbung begegnen wir ihm, bei jeder Krise wird sein Verlust alarmierend beschworen.
Warum sprechen wir heute so viel und gern von Vertrauen? Woher kommt die Liebe zu diesem Gefühl und seinem Begriff? Ute Frevert zeichnet nach, wie und weshalb sich Vertrauen seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr in moderne Lebensverhältnisse einnistet. Überall werden Vertrauensfragen gestellt: in der Liebe ebenso wie unter Freunden und Kameraden, im Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern nicht anders als in der Arbeits- und Geschäftswelt. Besonders wichtig wird Vertrauen in der Politik, wo es besonders im 20. Jahrhundert eine bemerkenswerte Karriere erlebt: nicht nur als Vertrauensfrage im Parlament, sondern auch, mit inflationärer Tendenz, in der Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern.
- 1–6 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–6
- 7–27 I. Fragen, Begriffe, Bedeutungen 7–27
- Vertrauensfragen, gegenwärtige und vergangene
- Fragen an das Vertrauen
- Das V-Wort
- Gefühl oder Kalkül?
- Warum und worin vertraut eine Oxforder Dame anno 2005?
- Vertrauen als Gefühlshaltung
- Historische Konjunkturen
- 28–43 II. Vertrauen lexikalisch: Spuren des Wandels 28–43
- Gott als sichere Bank des Vertrauens: Irritationen des 18. Jahrhunderts
- Die menschliche Herausforderung: Soziales Vertrauen im 19. Jahrhundert
- Überdehnung und Versachlichung: Tendenzen des 20. Jahrhunderts
- Vorläufige Bilanz
- 44–74 III. «Nie sollst Du mich befragen»: Liebe, Treue, Vertrauen 44–74
- Elsas Geschichte
- Vertrauens-Asymmetrien
- Romantische Liebe
- Ein neuer Gefühlscode: Literarische Modelle
- Lohengrins Liebesverlangen
- Richard Wagners Suche nach grenzenlosem Vertrauen
- Autonomie und Seelenmischung
- Arbeit am Gefühl
- Offenheit und Geheimnis in der Eheberatung
- Hochmoderne Verhältnisse: Hofreiters Untreue
- Das Roulette der Interessen
- 75–103 IV. Freunde, Kameraden, Lehrer: Vertrauen im Nahverhältnis 75–103
- Vertraute Freunde
- Misstrauen und Treulosigkeit
- Bund und Gemeinschaft
- Kameradenvertrauen
- Urvertrauen, Selbstvertrauen, Weltvertrauen
- Pädagogisches Vertrauen
- Reformpädagogik und Landerziehungsheime
- Vertrauen à la Gerold Becker
- Die Liebe zum Vertrauen
- Emanzipation vom Vertrauen? 1968 und die Folgen
- 104–146 V. Vertrauens-Ökonomien 104–146
- Kredit und Information
- Netzwerke der Vertrauensbildung
- Genossenschaften
- Imagepflege im Bankensektor
- Solidarität statt Vertrauen
- Vertrauensmänner in der Arbeitswelt
- «Mittler des Vertrauens»: Nationalsozialistische Vertrauensräte
- Konsumentenvertrauen
- Vertrauen als Werbewort
- Markenvertrauen
- Neue Vertrauenstechnologien für deregulierte Märkte
- Demoskopische Vertrauensfragen
- Vertrauen in der Krise
- 147–208 VI. Der Vertrauensstaat 147–208
- Theorie und Praxis politischen Vertrauens in der Neuzeit
- Absolutistische Treue-Verhältnisse
- Volksliebe und ihre Bedingungen
- Bürgervertrauen in Vormärz und Revolution
- Vertrauen(smänner) in der Bürgergesellschaft
- Tradition, Legalität, Charisma
- Zwischen demokratischer Vertrauensdiktatur und Führer-Vertrauen
- Postfaschistische Ent- und Verpflichtungen in der DDR
- Bundesrepublikanische Vertrauensfragen
- Chancen und Grenzen politischen Vertrauens
- 209–220 VII. Obsessive Fragen, kritische Antworten 209–220
- Zuversicht oder Vertrauen?
- Individualisierung und Emotionalisierung
- Die Sprache des Vertrauens
- Vertrauens-Spieler
- Die Macht des Vertrauens
- 221–222 Dank 221–222
- 223–224 Bildnachweis 223–224
- 225–260 Anmerkungen 225–260