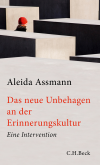Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur
Eine Intervention
Zusammenfassung
Im Ausland gilt die deutsche Erinnerungskultur als Erfolgsgeschichte und Vorbild. Innerhalb des Landes aber ist sie immer öfter Gegenstand von Unbehagen und Kritik. Indem die Generation der Zeitzeugen abtritt, die Deutungsmacht der 68er schwindet und Deutschland sich zunehmend als eine Einwanderungsgesellschaft begreift, steht auch die Erinnerung an den Holocaust vor neuen Herausforderungen. Aleida Assmann greift in ihrem Buch Themen und Stichworte aus dem aktuellen Diskurs des Unbehagens auf und nimmt sie zum Ausgangspunkt für eine grundsätzliche Befragung unserer Erinnerungskultur. Welche Rolle soll diese Erinnerung fortan in unserer Gesellschaft spielen? Soll sie überhaupt fortgesetzt werden, und wenn ja, wie? Wohin soll der Weg gehen, und wer soll ihn gehen? Dabei richtet Aleida Assmann den Blick auch auf andere Länder und deren Umgang mit der Vergangenheit und befreit die deutsche Debatte damit aus ihrer Selbstbezüglichkeit.
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–16 Einleitung 9–16
- 16–107 Vergessen, Beschweigen, Erinnern 16–107
- 16–33 1. Probleme mit der Gedächtnisforschung 16–33
- Individuelles und kollektives Gedächtnis
- Geschichte und Gedächtnis
- Kulturelles Gedächtnis
- Identitätsbezug
- Bedeutungen des Begriffs ‹Erinnerungskultur›
- 33–59 2. Arbeit am deutschen Familiengedächtnis – eine unendliche Geschichte? 33–59
- Das Schweigen brechen – der ZDF-Dreiteiler ‹Unsere Mütter, unsere Väter›
- Die Latenz des Schweigens – Hermann Lübbes Thesen zur deutschen Nachkriegsgeschichte
- Schlussstrich und Trennungsstrich
- Externalisierung und Internalisierung
- Das Crescendo der Holocaust-Erinnerung
- 59–107 3. Probleme mit der deutschen Erinnerungskultur 59–107
- Weltmeister im Erinnern?
- Deutungsmacht und gefühlte Opfer – Erinnerungskultur als Generationenkonflikt
- Der Holocaust als negativer Gründungsmythos
- Fertig erinnert?
- Ritualisierung
- Political Correctness
- Moralisierung und Historisierung
- 107–142 Praxisfelder der Deutschen Erinnerungskultur 107–142
- 107–123 4. Die Erinnerung an zwei deutsche Diktaturen 107–123
- Die Erinnerung an die DDR – ein deutscher Sonderweg?
- Die Rede von den beiden deutschen Diktaturen
- Vergangenheitsbewahrung und Vergangenheitsbewältigung
- Die Erinnerung an die Opfer der DDR
- Die Europäisierung der DDR-Erinnerung
- 123–142 5. Erinnern in der Migrationsgesellschaft 123–142
- Negative Erinnerung als Bürgerrecht?
- Das ethnische Paradox und die Pluralisierung des nationalen Gedächtnisses
- Der Schock des 4. November 2011
- Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- Empathie zwischen Differenz und Ähnlichkeit
- 142–204 Transnationale Perspektiven 142–204
- 142–180 6. Opferkonkurrenzen 142–180
- Exklusive und inklusive Opferdiskurse
- Europas gespaltenes Gedächtnis
- Politik der Reue
- Historische Wunden
- Verknüpfte Erinnerungen (multidirectional memories)
- 180–204 7. Vier Modelle für den Umgang mit traumatischer Vergangenheit 180–204
- Erinnern oder vergessen?
- Dialogisches Vergessen
- Erinnern, um niemals zu vergessen
- Erinnern, um zu überwinden
- Dialogisches Erinnern
- 204–212 Schluss: Prämissen der Neuen Erinnerungskultur 204–212
- 212–232 Anhang 212–232
- 212–229 Anmerkungen 212–229
- 229–232 Personenregister 229–232