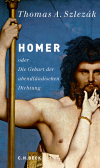Homer
oder Die Geburt der abendländischen Dichtung
Zusammenfassung
Um wieviel ärmer wäre die Weltliteratur, hätte uns Homer nicht Ilias und Odyssee geschenkt. Ohne seine Helden, die mit Todesverachtung vor Troia für Liebe und Ehre kämpfen oder sich allen Fährnissen zum Trotz standhaft um die Heimkehr mühen, wüßten wir nichts vom Zorn des Achill und von der Tapferkeit Hektors, nichts von der verführerischen Anmut Helenas und nichts vom Listenreichtum des Odysseus.
Auch hat kein anderes Werk auf die Literaturauffassung, Literaturgestaltung und Literaturtheorie anderer Epochen einen solchen Einfluß gehabt wie die Ilias auf die literarischen Traditionen Europas bis ins 19. Jahrhundert. In diesem Sinne kann man in der Ilias ‚die Geburt der abendländischen Dichtung’ sehen, in der Odyssee bereits den Beginn der von der Ilias bestimmten ‚Tradition’. Daß aber diese Wirkungsmacht überhaupt entfaltet werden konnte, liegt in dem Kunstreichtum des Dichters begründet – in der Meisterschaft seiner Komposition, der Eleganz seiner Sprache, der Wucht seines Versmaßes, der Glaubwürdigkeit seiner Charaktere. So schildert Homer eine Welt, die uns auch aus einer jahrtausendeweiten Distanz immer noch kohärent und überzeugend scheint. Dabei erzählt er großartige Geschichten von Göttern und Helden, von Himmel und Hades, von heroischer Tapferkeit und elender Feigheit oder von Edelmut und menschlichen Abgründen, die auch uns Heutige immer noch zu fesseln vermögen, so wie sie wohl einst die Zeitgenossen des Dichters in Bann schlugen. Doch so nah und verständlich uns manche Handlung und manches Gefühl in dem einen Gesang der Epen scheint, so fremd und verstörend muten sie uns in einem anderen an. All jenen, die die Werke Homers kennen- und verstehen lernen oder mehr noch als bisher mit ihnen vertraut werden wollen, öffnet Thomas A. Szlezák mit diesem Buch einen Zugang zur Welt des Dichters. Dabei erläutert er gleichermaßen anregend und verständlich Wesenszüge und Besonderheiten seiner Dichtkunst, skizziert den Gang der Ereignisse in seinen Werken, beschreibt die Gesellschaften, denen seine Protagonisten entstammen, und erhellt deren Weltbilder und Geisteshaltung sowie die Grundzüge ihrer Konflikte. Schließlich fragt er nach der Bedeutung der homerischen Epen und nach den Verbindungslinien, die sich zu altorientalischen Traditionen finden lassen.
- 1–9 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–9
- 10–50 I. ‹Homer› 10–50
- 10–18 1. Am Anfang stand das Vollkommene 10–18
- 18–30 2. Wie vollkommen war dieser ‹vollkommene› Anfang? Unterschiedliche Formen der Kritik an Homer 18–30
- 30–50 3. Sind die homerischen Epen wirklich ein Anfang? 30–50
- Zur griechischen Sagengeschichte
- Gab es einen Troianischen Krieg?
- Die formelhafte Sprache Homers weist in die Vergangenheit
- Altorientalische Einflüsse
- In welchem Sinne Homer dennoch als Anfang gelten kann
- Zur Datierung ‹Homers›
- 50–146 II. Ilias 50–146
- 50–61 1. Skizze des Geschehens 50–61
- 61–110 2. Literarische Form und Gestaltungsmittel 61–110
- Beschränkung der Handlung auf eine ‹Episode›
- Gliederung im Großen und im Kleinen
- ‹Klammertechnik› und Ringkomposition
- Fernbezüge
- Sukzessive Verdeutlichung. Retardation
- Aufsparungen
- Parallel geführte Handlungslinien
- Reden
- Charakterzeichnung
- Sprache, Versmaß, Formeln
- ‹Typische Szenen›
- Motivwiederholung
- Stilunterschiede
- Hypsos
- Gleichnisse
- Epische Breite
- 110–122 3. Interpretation ausgewählter Szenen und Situationen 110–122
- Das Leben der Menschen
- Ursache und Ausgang des Krieges
- Zwei Arten, den Krieg zu erleben
- Achilleus als Sohn, Freund, Rächer und Mitmensch
- 122–139 4. Himmel und Erde, Götter und Menschen. Das Weltbild der Ilias 122–139
- Die Welt
- Die Götter
- Die Menschen
- Homerische ‹Psychologie›: gibt es die eigene Entscheidung?
- Homerische Ethik
- Gesellschaft
- 139–146 5. Bedeutung und Anspruch der Ilias 139–146
- 146–218 III. Odyssee 146–218
- 146–156 1. Skizze des Geschehens 146–156
- 156–168 2. Einheit und Vielfalt in der Odyssee 156–168
- 168–193 3. Interpretation ausgewählter Szenen und Situationen 168–193
- Odysseus’ Rettung aus dem Seesturm (5.282–493)
- Drei Frauen
- Die Utopie des Phaiakenlandes
- Odysseus erwacht auf Ithaka
- Das Lachen der Freier
- Der Tod der Freier
- Schwieriges Sich-Finden
- Athene stiftet Frieden
- 193–214 4. Die Welt der Odyssee 193–214
- Menschenbild
- Gesellschaft und Wirtschaft
- Ethik
- Religion
- 214–218 5. Bedeutung und Anspruch. Die Leistung des Odyssee-Dichters 214–218
- 218–242 IV. Gilgamesch und Achilleus, Gilgamesch und Odysseus. Ähnlichkeiten und Unterschiede 218–242
- 242–246 Glossar und Erklärung der wichtigsten Personen-und Götternamen 242–246
- 246–250 Register: Namen und Sachen 246–250
- 250–256 Literaturverzeichnis 250–256
- 250–251 Übersetzungen, Textausgaben, Kommentare 250–251
- 251–256 Sekundärliteratur 251–256
- 256–256 Bildnachweis 256–256