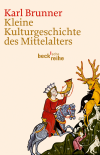Kleine Kulturgeschichte des Mittelalters
Zusammenfassung
Was wird man mit Fug und Recht von einer Kleinen Kulturgeschichte des Mittelalters erwarten dürfen? Geschichten von Rittern und Edelfräulein, Beispiele der Minnedichtung, Beschreibungen der Lebensverhältnisse in Burgen und Klöstern? Gewiss – diese Aspekte gehören dazu. Doch der Kreis, der auszumessen ist, um die Kultur dieser Epoche zu erfassen, reicht viel weiter und umschließt buchstäblich alle Lebensbereiche des Menschen: den Körper, seine Funktionen, Krankheit und Medizin, Ernährung und Versorgung, Kleidung, Bildung, Wissen, Kommunikation, Kunst, Vergnügungen und Askese, Wohnen, Handwerk, die dörfliche Welt ebenso wie die der Städte und der gestalteten Landschaft, Vorstellungen von Schönheit, Recht, Religion, Gottesferne und noch vieles andere mehr – einschließlich der Idee vom Paradies. Der Mittelalterforscher Karl Brunner lädt mit diesem informativen, lebendig geschriebenen Buch seine Leserinnen und Leser ein, die Kultur des Mittelalters neu zu entdecken.
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–12 Vorwort 9–12
- 13–55 I Der kulturell geformte Körper 13–55
- Mikrokosmos
- Organe und Körperfunktionen
- Körpermetaphern
- Elemente und Säfte
- Typologie
- Affekte – Gefühle
- Arbeit
- Lebens-Mittel
- Essen
- Trinken
- Habitus
- Schönheit
- Kleidung
- Lebenskreis
- Zeugung, Schwangerschaft, Geburt
- Kleinkind
- Ausbildung
- Rollenmuster
- Krankheiten und Heilungen
- Erbe, Heirat, Alter und Tod
- Minne
- Ritter
- Dichter
- Dame
- 56–97 II Haus und Hof 56–97
- Bauernhof
- Dorf
- Markt
- Burg
- Versorgung, Abgaben und Dienste
- Leben auf der Burg
- Ausstattung
- Unterhaltung: Klassische Stoffe und andere Dichtungen
- Artus und Gral
- Táin – Rinderraub
- Nibelungenlied
- Kudrun
- Tristan
- Herrscherkritik
- Dietrich von Bern
- Antike, Rom und Orient
- Geistliche Dichtung
- Geschichtsdichtung und didaktische Literatur
- «Bauern»-Satiren
- Vermittlung und Publikum
- Eine Kulturlandschaft in der Provinz
- 98–146 III Kirche und Kloster 98–146
- Die Räume
- Innenräume
- Sinn(en)-Räume
- Das christliche Leben und seine Bauten
- Spätantike Traditionen und Grundbegriffe
- Renovatio Imperii: Romanik
- Kirchenorganisation
- Eine neue Sicht: Gotik
- Klosterbauten
- Askese
- Frauenbewegungen
- Kloster und Welt
- Lateinische Schriftkultur
- Schreibstoffe
- Antikes Erbe
- Diskurse der «Wahrheit»: Dialoge
- Gebirge der Gelehrsamkeit
- Briefliteratur
- Predigten
- Geschichtsschreibung
- Biographien
- Fachliteratur
- Pragmatische Schriftlichkeit
- Die Kirche und die «Anderen»
- Heiden
- Mission
- Juden
- Muslime
- Neuerer, «Häretiker» und «Ketzer»
- 147–170 IV Die Stadt 147–170
- Mauern, Tore und Türme
- Flüsse und Umland
- Der «ökologische Fußabdruck»
- Straßen, Märkte, Plätze
- Handel und Gewerbe
- Zeit
- Geld
- Kreditwesen
- Fernhandel
- Gewerbe
- Unterschichten und Randgruppen
- Sondergruppen
- Bürger
- Der Dichter und Beobachter
- Das Mittelalter der Bürger
- 171–215 V Fest – Turnier – Krieg 171–215
- Kirchenfeste
- Die Messfeier, der Spiegel aller Feste
- Jahreskreis
- Reliquien
- Lebenskreis
- Höfische Feste
- Musik
- Das Muster-Fest
- Jagd
- Hunde und Katzen
- Turnier und Kampf
- Zweikampf und Gottesurteil
- Fehde
- Krieg
- Opfer
- Romzug
- Kreuzzüge
- Abenteuer
- 216–247 VI Kultur-Landschaften 216–247
- Landschaft und Weltbild
- Römisches Erbe
- Karolingische Reform
- Millennium und ottonische Renovatio
- Wald und Wildnis als Orte der Kultur
- Das werdende Land
- Netzwerke
- Kirchenhoheit
- Gerichte
- Marken und Länder
- Kolonisation
- Bergbau und Landschaft
- Akzente und Zeichen
- Pilgerwege
- Reisende und Straßen
- Wasserwege
- Das Paradies
- Wege zum Paradies
- Der Garten
- Wiedergeburt und Neue Zeit
- 248–254 Literaturhinweise 248–254
- 255–255 Bildnachweis 255–255
- 256–269 Register 256–269