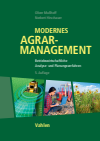Modernes Agrarmanagement
Betriebswirtschaftliche Analyse- und Planungsverfahren
Zusammenfassung
Gemäß dem Motto „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ geht es im vorliegenden Lehrbuch darum, Studierenden und Praktikern beim Erwerb analytischer Fähigkeiten und einer problemlösungsorientierten Methodenkompetenz zu helfen.
Für die Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark verändert. Insbesondere der Wettbewerbsdruck und das unternehmerische Risiko sind infolge der Liberalisierung der Agrarmärkte und des Klimawandels angestiegen. Hinzu kommen ein laufender Anpassungsdruck an veränderte Verbraucherwünsche, neue gesellschaftliche Anforderungen sowie eine zunehmende Verflechtung zwischen den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Das vorliegende Lehrbuch trägt diesen Entwicklungen durch die Fokussierung auf die praktische unternehmerische Entscheidungsunterstützung unter Risiko Rechnung.
Dieses Buch schafft zum einen das theoretisch-konzeptionelle Verständnis für die grundlegenden ökonomischen Strukturen der wichtigsten unternehmerischen Entscheidungsanlässe. Zum anderen vermittelt es das handwerkliche Können im Umgang mit betriebswirtschaftlichen Analyse- und Planungsinstrumenten, über das Manager in einer unsicheren Unternehmensumwelt verfügen müssen, um erfolgreiche Entscheidungen fällen zu können.
Aus dem Inhalt:
Grundlagen und Ziele unternehmerischen Entscheidens
Kontrolle und Analyse
Produktionstheorie
Produktionsprogrammplanung
Investitionsplanung und Finanzierung
Risikomanagement
Bewertung und Taxation
Corporate Social Responsibility
Über die Autoren:
Prof. Dr. Oliver Mußhoff leitet den Arbeitsbereich „Landwirtschaftliche Betriebslehre“ am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Georg-August-Universität Göttingen.
Prof. Dr. Norbert Hirschauer leitet den Arbeitsbereich „Unternehmensführung im Agribusiness“ am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Für Dozenten steht unter www.vahlen.de/30246055 ein auf das Buch abgestimmter Foliensatz mit den Abbildungen und Tabellen des Buches zur Verfügung. Für Studierende sind Übungsaufgaben formuliert.
- I–XVIII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XVIII
- 1–8 1 Einleitung 1–8
- 1.1 Einordnung der Agrarbetriebslehre
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau des Lehrbuchs
- 9–58 2 Grundlagen und Ziele unternehmerischen Entscheidens 9–58
- 2.1 Die Unternehmertätigkeit als Planungsprozess
- 2.1.1 Das zentrale Anliegen des Unternehmensmanagements
- 2.1.2 Entscheidungsphasen der unternehmerischen Planung
- 2.2 Zur unternehmerischen Zielsetzung
- 2.2.1 Systematik der Unternehmerziele
- 2.2.2 Umgang mit Mehrfachzielen
- a) Präferenzfunktion und Tradeoffs
- b) Das Konzept des homo oeconomicus
- c) Dominanzkonzept
- 2.3 Zu den Rahmenbedingungen der Agrarproduktion
- 2.3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen und Rechtsformen
- 2.3.2 Grundlagen und Bedingungen der Agrarproduktion
- a) Standortspezifische Verhältnisse
- b) Betriebsspezifische Verhältnisse
- 2.3.3 Entwicklungstrends in der Agrarwirtschaft
- a) Kurzbeschreibung der Ausgangssituation
- b) Trends
- 2.4 Wirtschaftliches Denken und ökonomische Planungsprinzipien
- 2.4.1 Das allgemeine Grenzwertprinzip
- a) Die Differenzrechnung bei diskreter Betrachtung
- b) Das Marginalprinzip bei stetiger Betrachtung
- 2.4.2 Das Opportunitätskostenprinzip bei absoluter Faktorknappheit
- 2.4.3 Das Kostendeckungsprinzip bei langfristiger Planung
- 2.4.4 Die Break-Even-Analyse
- 2.5 Metaplanung
- 2.5.1 Zum Problem des Messens
- 2.5.2 Systematisierung von Planungs- und Entscheidungsproblemen
- 2.5.3 Systematisierung von Entscheidungsunterstützungsinstrumenten
- 2.5.4 Auswahl adäquater Planungsverfahren
- 2.6 Literaturhinweise
- 59–140 3 Kontrolle und Analyse 59–140
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Grundlegende Begriffsdefinitionen
- 3.3 Jahresabschluss
- 3.3.1 Gesetzliche Grundlagen und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 3.3.2 Instrumente der Finanzbuchführung
- a) Inventur und Inventar
- b) Bilanz
- c) Gewinn- und Verlustrechnung
- 3.3.3 Technischer Ablauf der doppelten Buchführung
- 3.3.4 Jahresabschlussanalyse
- a) Anliegen und Ablauf
- b) Ausgewählte Jahresabschlusskennzahlen
- c) Residualentlohnungsgrößen über den Gewinn hinaus
- d) Potenziale und Probleme der Kennzahlenanalyse
- 3.4 Leistungs-Kostenrechnung
- 3.4.1 Zweck der Leistungs-Kostenrechnung
- 3.4.2 Wichtige Kostenbegriffe
- 3.4.3 Kostenarten- und Kostenstellenrechnung
- a) Kostenerfassung und Kostenartenrechnung
- b) Kostenstellenbildung und Kostenstellenrechnung
- 3.4.4 Teilkostenrechnung
- a) Einstufige Deckungsbeitragsrechnung
- b) Mehrstufige Fixkostendeckungsrechnung
- 3.4.5 Vollkostenrechnung
- a) Grundsätzlicher Ablauf
- b) Technische Durchführung mit dem Betriebsabrechnungsbogen
- c) Interpretation der Ergebnisse
- d) Mischung zwischen Teil- und Vollkostenrechnung
- e) Prozesskostenrechnung
- 3.5 Zusammenfassung und kritische Würdigung der Unternehmenskontrolle und -analyse
- 3.6 Literaturhinweise
- 141–184 4 Produktionstheorie 141–184
- 4.1 Vorbemerkungen
- 4.2 Optimale spezielle Intensität
- 4.2.1 Beschreibung und Lösung des Entscheidungsproblems
- 4.2.2 Erweiterungen
- a) Komparative Statik
- b) Alternative Formen der Produktionsfunktion
- c) Zusammenhang zwischen Produktions- und Kostenfunktion
- 4.3 Minimalkostenkombination
- 4.3.1 Beschreibung und Lösung des Entscheidungsproblems
- 4.3.2 Erweiterungen
- a) Komparative Statik
- b) Alternative Formen der Isoquante
- 4.4 Expansionspfad
- 4.4.1 Beschreibung und Lösung des Entscheidungsproblems
- 4.4.2 Erweiterungen
- a) Optimale Faktorkombination bei begrenztem Budget
- b) Zum Verhältnis von Expansionspfad und optimaler spezieller Intensität
- 4.5 Optimale Produktionsrichtung
- 4.5.1 Beschreibung und Lösung des Entscheidungsproblems
- 4.5.2 Erweiterungen
- a) Komparative Statik
- b) Alternative Formen der Kapazitätslinie
- 4.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung der Produktionstheorie
- 4.7 Literaturhinweise
- 185–224 5 Produktionsprogrammplanung 185–224
- 5.1 Vorbemerkungen
- 5.2 Grundlagen der linearen Programmierung
- 5.2.1 Formulierung eines LP-Problems
- 5.2.2 Lösung eines LP-Problems
- a) Grafischer Ansatz
- b) Enumerativer Ansatz
- c) Simplexmethode
- 5.2.3 Bestandteile einer LP-Lösung
- 5.3 Anwendungen und Erweiterungen
- 5.3.1 Zusätzliche Aktivitäten und Restriktionen
- 5.3.2 Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen
- a) Lösung eines LP-Problems mit Hilfe von MS-EXCEL
- b) Interpretation von Sensitivitätsberichten
- 5.3.3 Hinweise zur modelltechnischen Abbildung realer Komplexitäten
- 5.4 Zur Anwendungsrelevanz der linearen Programmierung
- 5.5 Literaturhinweise
- 225–332 6 Investitionsplanung und Finanzierung 225–332
- 6.1 Vorbemerkungen
- 6.2 Finanzmathematische Grundlagen
- 6.2.1 Aufzinsen und Abzinsen
- a) Aufzinsen und Endwertberechnung heterogener Zahlungen
- b) Abzinsen und Kapitalisieren heterogener Zahlungen
- c) Unterjährige Verzinsungsperioden
- 6.2.2 Rentenrechnung
- a) Kapitalisieren homogener Zahlungen
- b) Verrenten eines Barwertes
- c) Rentenendwertrechnung
- d) Rentenendwertverteilungsrechnung
- 6.3 Rentabilitätsanalyse von Investitionen
- 6.3.1 Aufstellung des Investitionsplans
- 6.3.2 Bestimmung des Kalkulationszinsfußes
- 6.3.3 Berechnung und Interpretation von Investitionskalkülen
- a) Kapitalwert
- b) Interner Zinsfuß
- c) Leistungs-Kostendifferenz
- d) Durchschnittskosten
- e) Eigenkapitalrendite
- f) Übersicht der Investitionskalküle
- 6.4 Anwendungen und Erweiterungen
- 6.4.1 Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen
- 6.4.2 Inflation
- 6.4.3 Steuern
- 6.5 Verschiedene Investitionssituationen
- 6.5.1 Investitionen ohne wechselseitige Interdependenzen
- 6.5.2 Investitionen mit wechselseitigen Interdependenzen
- a) Investitionen mit unterschiedlicher Tiefe
- b) Investitionen mit unterschiedlicher Breite
- c) Dynamische Entscheidungsprobleme unter Sicherheit
- 6.5.3 Nutzungsdauerentscheidungen
- a) Ex ante optimale Nutzungsdauer einer Investition
- b) Ex post optimaler Ersatzzeitpunkt einer Investition
- 6.6 Finanzierung von Investitionen
- 6.6.1 Beschreibung verschiedener Finanzierungsformen
- a) Rechtliche Stellung der Kapitalgeber und Herkunftsquellen von Kapital
- b) Kurzfristige Fremdfinanzierung
- c) Mittel- und langfristige Fremdfinanzierung
- d) Alternative Finanzierungsformen
- 6.6.2 Vorteilhaftigkeit unterschiedlicher Fremdfinanzierungsangebote
- a) Lieferantenkredit versus Kontokorrentkredit
- b) Darlehen mit Disagio versus Darlehen ohne Disagio
- c) Abschlussgebühren, Zinsverbilligungen und verlorene Zuschüsse
- d) Auswirkungen unterjähriger Kapitaldienstzahlungen
- e) Leasing versus Bankkredit
- 6.6.3 Liquiditätsmanagement und Finanzpläne
- 6.7 Simultane Betrachtung von Investition und Finanzierung
- 6.7.1 Maximierung des Vermögensendwertes bei Entweder-Oder-Entscheidungen
- 6.7.2 Zur Problematik umfassender Investitions- und Finanzierungsprogramme
- 6.8 Zur Anwendungsrelevanz der Investitionsrechnung
- 6.9 Literaturhinweise
- 333–486 7 Risikomanagement 333–486
- 7.1 Vorbemerkungen
- 7.2 Einführung in das Risikomanagement
- 7.2.1 Beschreibung des Entscheidungsproblems
- a) Handlungsalternativen, Umweltzustände und Eintrittswahrscheinlichkeiten
- b) Individuelle Risikoeinstellung und Entlohnung für die Risikoübernahme
- c) Risikoquellen
- d) Relevante Erfolgsgröße
- 7.2.2 Systematisierung des Risikomanagements
- a) Verschiedene Risikoperspektiven
- b) Grundsätzlicher Ablauf des ex ante Risikomanagements
- 7.2.3 Innerbetriebliche Risikomanagementinstrumente
- 7.2.4 Außerbetriebliche Risikomanagementinstrumente
- a) Bilaterale Verträge
- b) Warenterminkontrakte
- c) Schadens- und Indexversicherungen
- d) Pachtpreisanpassungsklauseln
- 7.2.5 Staatliche Förderung des unternehmerischen Risikomanagements
- 7.3 Qualitative Risikobewertung
- 7.3.1 Risikomatrix
- 7.3.2 Vorgehensweise bei der qualitativen Risikobewertung
- 7.3.3 Probleme der qualitativen Herangehensweise
- 7.4 Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen quantitativer Risikoanalysen
- 7.4.1 Ausprägungs- und Darstellungsformen von Zufallsvariablen
- a) Stetige und diskrete Zufallsvariablen
- b) Darstellungsformen von Verteilungsinformationen
- 7.4.2 Maßzahlen zur Charakterisierung von Zufallsvariablen
- 7.4.3 Häufig gemachte Fehler beim Umgang mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- a) Vernachlässigung des Bayes-Theorems
- b) Weitere verbreitete Fehler bei der Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten
- 7.4.4 Ausgewählte Verteilungen
- 7.5 Quantitative Risikoanalyse
- 7.5.1 Grundsätzliche Vorgehensweise
- 7.5.2 Identifizierung adäquater Verteilungsannahmen
- 7.5.3 Bestimmung der Verteilung eines Portfoliowertes
- a) Historische Simulation
- b) Varianz-Kovarianz-Methode
- c) Stochastische Simulation
- 7.5.4 Anwendung der Risikoanalyse auf Betriebsebene
- 7.5.5 Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen
- 7.6 Entscheidungsfindung unter Unsicherheit
- 7.6.1 Zur Notwendigkeit der Berücksichtigung von Variabilität bei Risikoneutralität
- 7.6.2 Pragmatische Ansätze zur Berücksichtigung des Risikos
- 7.6.3 Entscheidungskalküle unter Risiko
- a) Das Konzept der stochastischen Dominanz
- b) Das Erwartungsnutzen-Prinzip
- c) Das Erwartungswert-Varianz-Kriterium
- d) Quantifizierung der individuellen Risikoeinstellung von Entscheidern
- e) Zusammenfassung der Ablaufschritte des quantitativen Risikomanagements
- 7.6.4 Entscheidungsfindung unter Ungewissheit
- 7.7 Dynamische Entscheidungsprobleme unter Risiko
- 7.8 Zur Anwendungsrelevanz des Risikomanagements
- 7.9 Literaturhinweise
- 487–534 8 Bewertung und Taxation 487–534
- 8.1 Vorbemerkungen
- 8.2 Zum Zusammenhang zwischen Planung und Taxation
- 8.3 Rechtliche Bedeutung von Artikel 14 GG für die Taxation
- 8.4 Auswahl relevanter Wertansätze
- 8.4.1 Übersicht der Wertansätze
- 8.4.2 Bestimmung des relevanten Wertansatzes
- a) Auswahlregel
- b) Anwendung von Planungsmethoden bei der Taxation
- 8.5 Grundsätzliche Vorgehensweise bei der wirtschaftlichen Bewertung
- 8.5.1 Bewertung kurzlebiger Produktionsmittel
- 8.5.2 Bewertung langlebiger Produktionsmittel
- 8.6 Die Unternehmensbewertung
- 8.6.1 Bestimmung subjektiv relevanter Unternehmenswerte
- a) Entscheidungsorientierte Unternehmenswerte und Einigungspreise
- b) Das Ertragswertverfahren
- 8.6.2 Bestimmung objektivierter Unternehmenswerte
- 8.6.3 Der Wert von Unternehmensanteilen bei unterschiedlichen Rechtsformen
- 8.6.4 Zusammenfassende Systematik der Unternehmensbewertungsverfahren
- 8.7 Bewertung nichthandelbarer Güter
- 8.7.1 Arten nichthandelbarer Güter
- 8.7.2 Bewertung von Umwelt- und Sozialgütern
- 8.8 Literaturhinweise
- 535–586 9 Corporate Social Responsibility - Über die Grenzen der einzelwirtschaftlichen Sicht hinaus 535–586
- 9.1 Vorbemerkungen
- 9.2 Individuelle versus kollektive Rationalität
- 9.2.1 Regeln des Wirtschaftens und Dimensionen sozialer Verantwortung
- 9.2.2 Externe Effekte und ihre Wirkungsweise
- 9.2.3 Die wohlfahrtstheoretische Sicht auf externe Effekte
- 9.2.4 Die spieltheoretische Sicht auf externe Effekte
- a) Das Gefangenen-Dilemma
- b) Das soziale Dilemma
- c) Das Konzept des Nash-Gleichgewichts und der Kaldor-Hicks- und Pareto-Optimalität
- 9.2.5 Eine Übersicht klassischer Spiele
- 9.2.6 Das rekonstruierende Verstehen der Präferenzen gesellschaftlicher Akteure
- a) Grundsätzliche Motivationsquellen menschlichen Handelns
- b) Empirische Analyse von Anreizsituationen
- 9.3 Die Suche nach kollektiv-rationalen Lösungen
- 9.3.1 Externe Effekte, Gütereigenschaften und institutionelle Regelungen
- 9.3.2 Lösungsansätze für Externalitätenprobleme
- a) Förderung von Corporate Social Responsibility
- b) Förderung des Marktmechanismus
- c) Zuteilung von Verfügungsrechten und Coase-Verhandlungslösung
- d) Pigou-Steuer
- e) Ordnungsrechtliche Maßnahmen
- f) Staatliche Bereitstellung von Gütern
- g) Nudge
- 9.4 Dringlichkeitsadäquates kollektives Handeln
- 9.5 Literaturhinweise
- 587–594 Anhang: Tabellen finanzmathematischer Faktoren 587–594
- 595–602 Notation und Abkürzungen 595–602
- 603–622 Sachregister 603–622