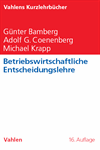Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre
Zusammenfassung
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Günter Bamberg war Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Universität Augsburg.
Prof. em. Dr. Dres. h.c. Adolf G. Coenenberg war Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftsprüfung und Controlling, an der Universität Augsburg.
Prof. Dr. Michael Krapp ist Extraordinarius für Quantitative Methoden an der Universität Augsburg.
In Unternehmen müssen täglich Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen erhebliche Konsequenzen für die eigene Geschäftsentwicklung haben können. Aus diesem Grund ist die Entscheidungstheorie ein wichtiger Bestandteil in der betriebswirtschaftlichen Lehre an Universitäten, Hochschulen und Akademien.
Die betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie stellt ein mathematisches Instrumentarium zur Verfügung, welches die Entscheidungsfindung erleichtert und auf eine rationale Basis stellt. Dieses Lehrbuch führt Sie in die Entscheidungstheorie ein, stellt Entscheidungen bei Sicherheit, Risiko und Ungewissheit ausführlich dar und erläutert Ihnen die Grundbegriffe der Spieltheorie ebenso wie die der dynamischen Programmierung.
- I–XVI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XVI
- 1–12 1. Erkenntnisziele der Entscheidungstheorie 1–12
- 1.1 Präskriptive Entscheidungstheorie
- 1.2 Deskriptive Entscheidungstheorie
- 1.3 Die Entscheidungstheorie als Grundlage der Betriebswirtschaftslehre
- 13–40 2. Das Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre 13–40
- 2.1 Modellbegriff
- 2.2 Das Entscheidungsfeld
- 2.2.1 Der Aktionenraum
- 2.2.2 Der Zustandsraum und das Informationssystem
- 2.2.3 Handlungskonsequenzen und Ergebnisfunktion
- 2.3 Das Zielsystem
- 2.3.1 Bestandteile des Zielsystems
- 2.3.2 Anforderungen an das Zielsystem
- 2.4 Messtheoretische Aspekte und Rationalitätspostulate
- 2.4.1 Bewertung der Aktionen und der Ergebnisse
- 2.4.2 Nutzenmessung
- 2.4.3 Entscheidungsmatrix, Nutzenmatrix, Schadensmatrix, Opportunitätskostenmatrix
- 2.4.4 Dominanzprinzip
- 2.5 Klassifikation von Entscheidungsmodellen
- 41–65 3. Entscheidungen bei Sicherheit 41–65
- 3.1 Sicherheitssituationen
- 3.2 Entscheidungen bei einer Zielsetzung
- 3.3 Entscheidungen bei mehreren Zielsetzungen
- 3.3.1 Praktische Bedeutung
- 3.3.2 Präferenzunabhängigkeit
- 3.3.3 Zielanalyse
- 3.3.4 Effiziente Aktionen
- 3.4 Spezielle Entscheidungsregeln für multikriterielle Entscheidungsprobleme
- 3.5 Sonstige Lösungsmöglichkeiten für multikriterielle Probleme
- 3.5.1 Saatys Methode (Analytic Hierarchy Process)
- 3.5.2 Interaktive Methoden
- 3.5.3 Prävalenzrelationen; Electre
- 3.6 Aufgaben
- 67–108 4. Entscheidungen bei Risiko 67–108
- 4.1 Risikosituationen
- 4.2 Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Umfeldzustände
- 4.3 Das Bernoulli-Prinzip
- 4.4 Empirische Ermittlung des Bernoulli-Nutzens
- 4.5 Diskussion einiger Nutzenfunktionen
- 4.6 Risikoprämien und Arrow-Pratt-Maß für die Risikoaversion
- 4.7 Begründung des Bernoulli-Prinzips
- 4.8 Klassische Entscheidungsprinzipien
- 4.9 Welche Präferenzen berücksichtigt das Bernoulli-Prinzip?
- 4.10 Stochastische Dominanz
- 4.11 Kritische Zusammenfassung
- 4.12 Aufgaben
- 109–122 5. Entscheidungen bei Ungewissheit 109–122
- 5.1 Ungewissheitssituationen
- 5.2 Möglichkeiten zur Lösung von Ungewissheitssituationen
- 5.3 Spezielle Entscheidungsregeln
- 5.4 Kritische Zusammenfassung
- 5.5 Aufgaben
- 123–154 6. Entscheidungen bei variabler Informationsstruktur 123–154
- 6.1 Entscheidungsregeln; LPI-Modelle
- 6.1.1 Entscheidungsregeln bei unzuverlässiger Zustandsverteilung
- 6.1.2 Entscheidungsregeln bei partieller Information; LPI-Modelle
- 6.2 Informationsbeschaffungsaktionen bei vollkommenen Informationssystemen
- 6.3 Informationsbeschaffungsaktionen bei unvollkommenen Informationssystemen; Information durch Stichproben
- 6.4 Bayes-Analyse
- 6.5 Die allgemeine Entscheidungssituation bei Informationsbeschaffungsmöglichkeiten
- 6.6 Informations-Asymmetrie und Prinzipal-Agent-Ansätze
- 6.6.1 Beispiele für Prinzipal-Agent-Beziehungen
- 6.6.2 Relevante und optimale Anreizschemata
- 6.6.3 Extreme Informations-Asymmetrie; Informations-Extraktion
- 6.7 Aufgaben
- 155–209 7. Entscheidungen bei bewusst handelnden Gegenspielern 155–209
- 7.1 Spielsituationen
- 7.2 Klassifikation und grundlegende Definitionen
- 7.2.1 Baumdarstellung
- 7.2.2 Spiele in Normalform
- 7.2.3 Das Dyopol
- 7.2.4 Klassifikation; Programm dieses Kapitels
- 7.2.5 Gleichgewichtspunkte
- 7.3 Zweipersonennullsummenspiele
- 7.3.1 Gleichgewichtspunkte
- 7.3.2 Maximin-Strategien und Spielwerte
- 7.3.3 Determinierte Spiele
- 7.3.4 Indeterminierte Spiele und gemischte Erweiterung
- 7.3.5 Berechnung des Spielwertes und der Maximin-Strategien von gemischten Erweiterungen
- 7.4 Allgemeine nichtkooperative Zweipersonenspiele
- 7.4.1 Spiele vom Typ „Gefangenendilemma“
- 7.4.2 Spiele vom Typ „Kampf der Geschlechter“
- 7.4.3 Auszahlungsdiagramm und Garantiepunkt
- 7.4.4 Diskussion verschiedener Lösungsansätze
- 7.5 Allgemeine kooperative Zweipersonenspiele
- 7.5.1 Die Nash-Lösung
- 7.5.2 Die Nash-Lösung eines Tarifkonfliktes
- 7.5.3 Das verallgemeinerte Verhandlungsmodell von Nash
- 7.6 Kooperative N-Personenspiele
- 7.6.1 Imputationen und Kern eines Spiels
- 7.6.2 Die Von-Neumann-Morgenstern-Lösung
- 7.7 Kritische Zusammenfassung
- 7.8 Aufgaben
- 211–231 8. Entscheidungen durch Entscheidungsgremien 211–231
- 8.1 Probleme einer gerechten Aggregation individueller Präferenzen
- 8.2 Das Unmöglichkeitstheorem von Arrow
- 8.3 Modifizierung der Forderungen des Unmöglichkeitstheorems
- 8.4 Traditionelle Entscheidungsverfahren
- 8.5 Strategisches Verhalten
- 8.6 Aufgaben
- 233–256 9. Mehrstufige Entscheidungen 233–256
- 9.1 Mehrstufige Entscheidungen
- 9.2 Klassifikation und grundlegende Definitionen
- 9.3 Mehrstufige Entscheidungen bei Sicherheit
- 9.3.1 Das Optimalitätsprinzip
- 9.3.2 Ein Beispiel aus der Lagerhaltung
- 9.4 Mehrstufige Entscheidungen bei Risiko
- 9.4.1 Entscheidungsbaumanalyse bei Risikoneutralität
- 9.4.2 Entscheidungsbaumanalyse bei beliebiger Risikonutzenfunktion
- 9.5 Aufgaben
- 257–280 Lösungen zu den Aufgaben 257–280
- 281–304 Literaturverzeichnis 281–304
- 305–308 Stichwortverzeichnis 305–308