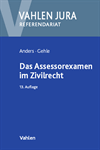Das Assessorexamen im Zivilrecht
Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
Das seit über 30 Jahren erscheinende Standardwerk liefert sämtliche Grundlagen für die Ausbildung im Referendariat und für die Arbeit des Praktikers am Zivilrechtsfall.
Im Referendariat wird das Erlernen neuer Denkweisen verlangt, um das im rechtswissenschaftlichen Studium erworbene theoretische Wissen – allem voran im Examen – erfolgreich anwenden zu können. Denn anders als noch im feststehenden Sachverhalt der Ersten Juristischen Prüfung ist das dem Fall zugrunde liegende Geschehen vielfach streitig.
Erläutert wird zunächst jene – Relationsmethode genannte – Denkweise, deren Verständnis zur systematischen und schnellstmöglichen Erarbeitung einer praktisch verwertbaren Falllösung für Richter und Rechtsanwälte erforderlich ist. Auf die Darstellung des Aufbaus zivilgerichtlicher Entscheidungen folgen Ausführungen zur Anwaltsperspektive, insbesondere zu prozesstaktischen Überlegungen. Die im ersten Abschnitt aufgezeigten Grundzüge des zivilprozessualen Erkenntnisverfahrens werden in Kapiteln zu den wichtigsten prozessualen Konstellationen vertieft. Hinweise zum Aktenvortrag sowie zur zivilgerichtlichen Dezernatsarbeit runden die Darstellung ab.
In die Ausführungen eingegangen ist die Erfahrung der Autoren aus beruflicher Praxis und langjähriger Tätigkeit als Prüfer und Ausbilder. Das Werk eignet sich somit für die Ausbildung und gleichermaßen als Handbuch der Anwalts- und Gerichtspraxis.
Die neu bearbeitete Auflage berücksichtigt jüngste Gesetzesänderungen sowie aktuelle Rechtsprechung und Literatur. Das Werk wurde um Formulierungsbeispiele ergänzt und um viele Hinweise zu immer wiederkehrenden Fehlern in Examensarbeiten bereichert. Ständige Aktualisierung unter www.vahlen.de.
Die Autoren
Dr. Monika Anders ist Präsidentin des Landgerichts Essen; Dr. Burkhard Gehle ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Köln.
- I–XXIX Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXIX
- 1–3 Einleitung 1–3
- 3–187 1. Abschnitt. Allgemeiner Teil 3–187
- 3–119 A. Bearbeitung eines Zivilrechtsfalles 3–119
- 3–7 I. Effizienz der Entscheidungsfindung (Relationstechnik) 3–7
- 1. Bedeutung der Relationstechnik für die Praxis
- 2. Grunderwägungen
- 7–8 II. Aufbau eines Gutachtens 7–8
- 8–37 III. Sachverhalt 8–37
- 1. Grundsätze des Zivilprozesses
- 2. Tatbestand und Sachbericht (Terminologie)
- 3. Stoffsammlung
- 4. Stoffordnung
- 5. Inhalt und Form von Sachbericht und Tatbestand
- 37–73 IV. Rechtliche Würdigung 37–73
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Auslegung des Klageantrages
- 3. Sonstige Vorfragen
- 4. Zulässigkeit der Klage
- 5. Begründetheit der Klage (Darlegungsstationen) – Grundzüge der Relationstechnik
- 73–85 V. Tatsächliche Würdigung (Beweisstation) 73–85
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Beweisbedürftigkeit
- 3. Beweiswürdigung
- 4. Beweislast, non liquet und Beweisfälligkeit
- 5. Die Beweiserhebung
- 6. Strengbeweis und Freibeweis
- 7. Aufbau anhand von Schaubildern
- 85–118 VI. Die Tenorierung 85–118
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Abgrenzung zur sogenannten Entscheidungsstation
- 3. Hauptsachenentscheidung
- 4. Kostenentscheidung
- 5. Vorläufige Vollstreckbarkeit
- 118–118 VII. Rechtsmittelbelehrung 118–118
- 118–119 VIII. Übungsfälle 118–119
- 1. Grundfall
- 2. Verkehrsunfall und Berufung
- 119–146 B. Urteil und Beschluss 119–146
- I. Das Urteil
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Rubrum
- 3. Tenor
- 4. Tatbestand
- 5. Entscheidungsgründe
- II. Der Beschluss
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Form und Inhalt
- 3. Muster eines Hinweis- und Auflagenbeschlusses sowie eines Beweisbeschlusses
- III. Übungsfall
- 146–151 C. Die Examensklausur aus dem Tätigkeitsbereich eines Zivilgerichts 146–151
- I. Allgemeines
- II. Besonderheiten bei Urteils- oder Beschlussklausuren
- III. Besonderheiten bei Gutachtenklausuren
- 151–181 D. Besonderheiten beim Gutachten aus Anwaltssicht 151–181
- I. Allgemeine Anforderungen an eine Anwaltsklausur
- II. Begutachtung
- 1. Ausgangspunkt
- 2. Einzelne Denkschritte
- 3. Aufbau
- 4. Erarbeitung des Sachverhalts
- 5. Vorschlag
- 6. Antrag oder andere Vorfragen
- 7. Zulässigkeit der Klage
- 8. Schlüssigkeit und Erheblichkeit
- 9. Beweisprognose
- 10. Zweckmäßigkeitserwägungen
- 11. Ergebnis und Antrag
- 12. Schreiben an den Mandanten
- 13. Übungsfall
- 14. Schriftsatz an das Gericht
- 181–187 E. Der mündliche Vortrag (Aktenvortrag) 181–187
- I. Allgemeines
- II. Aufbau
- 1. Einleitung
- 2. Sachverhalt
- 3. Vorschlag
- 4. Stellungnahme
- 5. Tenor oder anderer Entscheidungsvorschlag
- III. Praktische Hinweise
- IV. Übungsfall zum Aktenvortrag (Übung zu Teil E.)
- V. Exkurs: Das Votum
- 187–593 2. Abschnitt. Besonderer Teil 187–593
- 187–272 F. Beweis und Beweiswürdigung 187–272
- I. Die Beweismittel
- 1. Der Zeuge
- 2. Der Sachverständige
- 3. Der Augenschein
- 4. Die Urkunde
- 5. Die Parteivernehmung
- 6. Amtliche Auskünfte
- 7. Die Glaubhaftmachung
- II. Das selbstständige Beweisverfahren
- 1. Aufgaben und Grundlagen
- 2. Verwertung im Rechtsstreit
- 3. Kosten
- 4. Streitwert
- III. Die Beweiswürdigung
- 1. Allgemeines
- 2. Die Ergiebigkeit des Beweismittels
- 3. Die Überzeugungskraft des Beweismittels
- IV. Indizien
- 1. Allgemeine Grundsätze
- 2. Gutachten und Urteil
- 3. Exkurs: Der fingierte Verkehrsunfall
- V. Vermutungen und Anscheinsbeweis
- 1. Grundlage: Erfahrungssätze
- 2. Gesetzliche Vermutungen
- 3. Tatsächliche Vermutungen, Anscheinsbeweis
- 4. Gutachten und Urteil
- 5. Schema
- VI. Die Beweislast
- 1. Gesetzliche Grundlagen
- 2. Beweislastumkehr
- 3. Beweiserleichterungen
- 4. Beweisvereinbarungen
- VII. Beweisvereitelung
- VIII. Die Schadensschätzung nach § 287
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Prozessuale Situation des Klägers
- 3. Streitwert und Kostenentscheidung
- 4. Gutachten und Urteil
- 272–296 G. Die Aufrechnung des Beklagten im Prozess 272–296
- I. Rechtsnatur und Wirkungen
- II. Rechtskraft und Rechtshängigkeit
- 1. Wirkungen des § 322 II ZPO
- 2. Keine Rechtshängigkeit
- III. Aufrechnung als Verteidigungsmittel – Prozessuale Auswirkungen
- 1. Prozessuale Besonderheiten
- 2. Vorbehaltsurteil
- IV. Zulässigkeit der Aufrechnung im Einzelnen
- 1. Unzulässigkeit aus prozessualen Gründen
- 2. Unzulässigkeit aus materiell-rechtlichen Gründen
- V. Gutachten und Urteil
- 1. Prüfungsreihenfolge
- 2. Gutachten
- 3. Urteil
- 4. Streitwert und Kosten
- VI. Hilfsaufrechnung
- 1. Abgrenzung von Haupt- und Hilfsaufrechnung
- 2. Besonderheiten beim Gutachten
- 3. Besonderheiten beim Tatbestand und bei den Entscheidungsgründen
- 4. Streitwert und Kosten
- VII. Exkurs: Das Zurückbehaltungsrecht
- 1. Materiell-rechtliche und prozessuale Grundlagen
- 2. Hauptsachentenor, Streitwert und Kosten
- 3. Weitere Besonderheiten in Gutachten und Urteil
- VIII. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 296–313 H. Versäumnisurteil und Einspruchsverfahren 296–313
- I. Das Versäumnisurteil
- 1. Echte und unechte Versäumnisurteile
- 2. Voraussetzungen für den Erlass eines echten Versäumnisurteils
- II. Das Einspruchsverfahren
- 1. Zulässigkeit des Einspruchs
- 2. Das zweite Versäumnisurteil
- 3. Sachentscheidung nach Einspruch
- 4. Gutachten und Urteil
- III. Entscheidung nach Lage der Akten
- IV. Exkurs: Vollstreckungsbescheid
- V. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 313–322 I. Verspätete Angriffs- und Verteidigungsmittel 313–322
- I. Bedeutung der Verspätungsvorschriften
- II. Systematik des Gesetzes
- III. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Verspätungsvorschriften
- 1. Angriffs- und Verteidigungsmittel
- 2. Gerichtliche Fristen
- 3. Verzögerung des Rechtsstreits
- 4. Verschulden
- IV. Gutachten und Urteil
- 1. Aufbau des Gutachtens 1. Instanz
- 2. Urteil
- V. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 322–336 J. Haupt- und Hilfsvorbringen 322–336
- I. Der Streitgegenstand
- 1. Gesetzliche Ausgangslage
- 2. Praktische Handhabung
- II. Mehrfache Anspruchsbegründung
- 1. Grundsätze
- 2. Beispielsfälle
- 3. Gutachten und Urteil
- III. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 336–356 K. Haupt- und Hilfsantrag 336–356
- I. Prozessuale Fragen
- 1. Grundlagen und Grenzen der Zulässigkeit
- 2. Besondere Teilaspekte
- II. Gutachten und Urteil
- 1. Gutachten
- 2. Urteil
- III. Streitwert und Kostenentscheidung
- 1. Streitwert
- 2. Kostenentscheidung
- IV. Sonderfälle
- 1. Verdeckte Hilfsanträge
- 2. Teilklagen
- 3. Wechsel- (Scheck-) und Kausalforderung
- 4. Hilfsantrag auf Verweisung
- V. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 1. Vollständige Prüfung
- 2. Vertretung des Beklagten
- 3. Vertretung des Klägers
- 4. Sonderfälle
- 356–370 L. Unechte Hilfsanträge (Der Unvermögensfall) 356–370
- I. Begründetheit als Bedingung
- II. Frist zur Erfüllung und Schadensersatz
- 1. Materiell-rechtliche Grundlagen
- 2. Fristsetzung im Urteil
- 3. Leistungsantrag für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs
- 4. § 510b ZPO
- 5. Gutachten und Urteil
- 6. Streitwert
- 7. Prozessuale Nebenentscheidungen
- III. Der Einwand des Unvermögens
- 1. Die Veräußerung des streitbefangenen Gegenstands
- 2. Die gegen den mittelbaren Besitzer gerichtete Herausgabeklage
- 3. Streitige Unmöglichkeit
- 4. Hilfsantrag: »im Unvermögensfall«
- 5. Fristsetzung bei Unerheblichkeit des Unvermögenseinwands
- IV. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 370–388 M. Die Widerklage 370–388
- I. Prozessuale Gegebenheiten
- 1. Ausgangslage
- 2. Zur Zulässigkeit im Einzelnen
- II. Darstellung in Gutachten und Urteil
- 1. Gutachten
- 2. Urteil
- III. Streitwert und Kostenentscheidung
- 1. Streitwert
- 2. Kostenentscheidung
- IV. Sonderfälle
- 1. Die petitorische Widerklage
- 2. Die Hilfs-Widerklage
- 3. Widerklagen unter Beteiligung Dritter
- V. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 388–409 N. Die Stufenklage 388–409
- I. Einführung
- 1. Verfahrensrechtliche Fragen
- 2. Materiell-rechtliche Fragen
- II. Charakteristische Merkmale der Stufenklage
- 1. Stufenweises Vorgehen
- 2. Exkurs: Das Teilurteil im Allgemeinen
- 3. Teilurteil auf einer der ersten Stufen
- 4. Unbegründetheit der Klage
- 5. Ergebnislosigkeit der Auskunft und »Erledigung« der dritten Stufe
- III. Darstellung in Gutachten und Urteil
- 1. Gutachten
- 2. Urteil
- IV. Streitwert und Kostenentscheidung
- 1. Streitwert
- 2. Die Kostenentscheidung
- V. Besonderheiten in der Rechtsmittelinstanz
- 1. Berufung gegen Teilurteil auf einer unteren Stufe
- 2. Berufung gegen klageabweisendes Urteil
- VI. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 409–427 O. Die Feststellungsklage 409–427
- I. Bedeutung und Voraussetzungen
- 1. Zulässigkeit
- 2. Begründetheit
- 3. Rechtskraft
- II. Aufbau des Gutachtens
- III. Die negative Feststellungsklage
- 1. Zulässigkeit: Antrag und rechtliches Interesse
- 2. Darlegungs- und Beweislast
- 3. Rechtskraftwirkungen des Urteils
- 4. Teilerfolg des Klägers
- IV. Die Zwischenfeststellungsklage
- 1. Vorgreiflichkeit
- 2. Entscheidung des Gerichts
- V. Kollision von negativer Feststellungsklage und Leistungsklage
- 1. Zulässigkeit der Leistungsklage
- 2. Feststellungsinteresse
- VI. Streitwert
- VII. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 427–470 P. Die Erledigung des Rechtsstreits 427–470
- I. Ausgangspunkt
- 1. Erste Instanz
- 2. Rechtsmittelinstanz und Anhörungsrüge
- II. Übereinstimmende Erledigungserklärungen
- 1. Rechtsnatur und Wirkungen
- 2. Wirksamkeits- und Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 3. Der Beschluss nach § 91a
- 4. Teilweise übereinstimmende Erledigungserklärungen
- III. Einseitige Erledigungserklärung
- 1. Rechtsnatur und Wirkungen
- 2. Auslegungsfragen
- 3. Feststellungsinteresse
- 4. Begründetheit des Feststellungsantrags
- 5. Tenor und Streitwert
- 6. Rechtsmittel und Rechtskraft
- 7. Gutachten und Urteil
- IV. Hilfsanträge
- 1. Hilfsweise erklärte Erledigung
- 2. Ursprüngliches Klagebegehren als Hilfsantrag
- 3. Hilfsweise abgegebene Erledigungserklärung des Beklagten
- V. Durchsetzung des Kosteninteresses in anderen Fällen
- 1. Ausgangsproblem
- 2. Kostenentscheidung nach § 269 III 3
- 3. Kostenentscheidung nach § 91a
- 4. Streitige Feststellung des Kosteninteresses
- VI. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 1. Aus der Sicht des Klägers
- 2. Aus der Sicht des Beklagten
- 470–490 Q. Der Urkundenprozess 470–490
- I. Wesentliche Merkmale
- II. Die Zulässigkeit des Vorverfahrens
- 1. Allgemeine Voraussetzungen
- 2. Statthaftigkeit
- 3. Erfordernis der Vorlage von Urkunden
- 4. Objektive Klagenhäufung
- III. Weitere Besonderheiten des Urkundenprozess
- 1. Beschränkung der Beweismittel
- 2. Einwendungen des Beklagten
- 3. Widerklage
- 4. Wechsel des Verfahrens
- IV. Der Wechsel- und Scheckprozess
- 1. Verfahren
- 2. Statthaftigkeit
- 3. Beschränkung der Beweismittel
- 4. Einrede des Schiedsvertrags
- V. Gutachten und Urteil im Vorverfahren
- 1. Gutachten
- 2. Urteil
- VI. Das Nachverfahren
- 1. Allgemeines
- 2. Die Wirkungen des Vorbehaltsurteils
- 3. Klageänderung im Nachverfahren
- 4. Der Abschluss des Nachverfahrens
- 5. Gutachten und Urteil
- VII. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 490–513 R. Parteiänderungen 490–513
- I. Begründung der Parteistellung
- II. Parteiwechsel
- 1. Gesetzliche Regelungen
- 2. Gewillkürter Parteiwechsel
- III. Parteierweiterung
- IV. Weitere Überlegungen des Anwalts
- V. Rubrumsberichtigung
- 1. Identität der Parteien
- 2. Gutachten und Urteil
- VI. Exkurs: Zwischenurteile
- 1. Arten von Zwischenurteilen
- 2. Tatbestand und Entscheidungsgründe
- 3. Besonderheiten bei der Frage der Zulässigkeit des Parteiwechsels
- 4. Besonderheiten beim Streit um die Wirksamkeit eines Prozessvergleichs
- 513–576 S. Berufung 513–576
- I. Allgemeine Grundsätze
- 1. Wesen und Wirkungen
- 2. Prüfungskompetenz des Berufungsgerichts
- 3. Verspätungsvorschriften
- II. Zulässigkeit der Berufung
- 1. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 2. Entscheidung bei Unzulässigkeit der Berufung
- III. Entscheidungen bei zulässiger Berufung
- 1. Allgemeines
- 2. Zurückweisung durch Beschluss, § 522 II
- 3. Eigene Sachentscheidung durch Urteil
- 4. Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz durch Urteil
- IV. Anschlussberufung
- 1. Zulässigkeit
- 2. Entscheidung
- 3. Kostenentscheidung bei Verlust der Wirkung
- V. Gutachten und Urteil
- 1. Rubrum
- 2. Ausführungen zur Zulässigkeit und zur Begründetheit
- 3. Aufbau des Gutachtens
- 4. Gründe (= Tatbestand und Entscheidungsgründe)
- VI. Weitere Überlegungen des Anwalts
- 1. Zulässigkeitsfragen
- 2. Veränderung der Situation
- 3. Bestimmung des Sach- und Streitstandes
- 4. Verfahrensmängel
- 5. Kosten und vorläufige Vollstreckbarkeit
- 576–589 T. Arrest und einstweilige Verfügung 576–589
- I. Gemeinsame Grundlagen
- 1. Zweck und Besonderheiten
- 2. Vorgehen des Gerichts
- 3. Besonderheiten im Rubrum
- 4. Schadensersatz
- II. Arrest
- 1. Voraussetzungen
- 2. Tenor und Streitwert
- 3. Begründung
- III. Einstweilige Verfügung
- 1. Voraussetzungen
- 2. Keine Vorwegnahme der Hauptsache
- IV. Rechtsmittel, Widerspruch und Aufhebung
- 1. Erfolgloser Antrag
- 2. Erfolgreicher Antrag
- 3. Keine Anrufung des BGH
- 589–593 U. Verkehrsunfall 589–593
- 1. Schlüssigkeit (Klägerstation)
- 2. Erheblichkeit (Beklagtenstation)
- 3. Tatsächliche Würdigung (Beweisstation)
- 593–605 Anhang: Die Arbeit im Zivildezernat 593–605
- 593–600 I. Grundlagen 593–600
- 1. Die Aufgaben der Geschäftsstelle
- a) Allgemeines
- b) Register und Kalender
- c) Aktenfächer, elektronische Akte
- 2. Verfügungen
- a) Allgemeines
- b) Ausgangslage
- c) Beispiel: Versenden von Ablichtungen
- d) Der Abschluss der Verfügung
- 3. Abkürzungen
- 600–605 II. Beispiele 600–605
- 605–623 Sachverzeichnis 605–623
- 623–623 Impressum 623–623