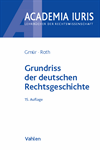Grundriss der deutschen Rechtsgeschichte
Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
Kurze, prägnante Erläuterungen grundlegender Rechtsbegriffe, deren Kenntnis nicht nur für das Studium der Rechtsgeschichte, sondern darüber hinaus auch für das Verständnis des geltenden Rechts notwendig ist, führen den Leser dieses Werkes schnell in das behandelte Themengebiet ein. Die anschließenden rechtshistorischen Ausführungen selbst skizzieren die deutsche Rechtsentwicklung mit ihren europäischen Bezügen und befassen sich dabei vornehmlich mit Institutionen, die mehrere Epochen überdauert haben.
Das Werk konzentriert sich hierbei auf Quellen und Grundzüge des Rechts aus den verschiedenen Phasen mitteleuropäischer Geschichte, beginnend mit der Zeit der Germanen bis hin ins 21. Jahrhundert.
Besonderer Wert wird auf die Darstellung von Entwicklungen gelegt, welche unser heutiges Rechtssystem maßgeblich beeinflusst haben. Die Abhandlung schließt mit einer Bestandsaufnahme der geltenden Rechtsordnung und eröffnet dem Leser mit der Sicht auf die Kontinuitäten und Innovationen eine interessante Perspektive.
Die Autoren
Prof. Dr. Andreas Roth ist Inhaber eines Lehrstuhls für deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht an der Universität Mainz. Begründet wurde das Werk von Prof. Dr. Rudolf Gmür †.
- I–XVI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XVI
- 1–11 1. Kapitel. Einleitung 1–11
- A. Grundbegriffe
- I. Recht
- 1. objektives Recht (Recht in objektivem Sinn)
- 2. subjektives Recht (Recht in subjektivem Sinn)
- II. Gesetz – Gewohnheitsrecht
- III. Recht im engeren und weiteren Sinn
- B. Bedeutung der Rechtsgeschichte für den Juristen
- C. Begrenzung und Gliederung des Stoffes
- I. Geographische Begrenzung
- II. Zeitliche Begrenzung
- III. Institutionelle Begrenzung
- IV. Gliederung
- D. Schrifttum (zusammenfassende Werke in Auswahl)
- I. Grundrisse und Lehrbücher
- II. Andere Einführungsliteratur
- III. Handbücher
- IV. Werke über Teilbereiche der deutschen Rechtsgeschichte
- 1. Privatrechtsgeschichte
- 2. Strafrechtsgeschichte
- 3. Verfassungsgeschichte und Geschichte des öffentlichen Rechts
- 4. Geschichte des Kirchenrechts
- 5. Biographien/Geschichte der Rechtswissenschaft
- V. Werke über die Rechtsentwicklung in der ehemaligen DDR, in Österreich und der Schweiz
- VI. Gesamteuropäische Rechtsgeschichte
- VII. Lexikon
- E. Rechtsquellen
- I. Begriff
- II. Unmittelbare und mittelbare Rechtsquellen
- 13–19 2. Kapitel. Germanische Zeit (ca. 100 v. Chr. – ca. 500 n. Chr.) 13–19
- A. Quellen
- I. Cäsar, De bello gallico, 58–50 v. Chr., VI 21–28
- II. Tacitus, Germania, 98 n. Chr. (unter Trajan)
- B. Grundzüge germanischer Stammesrechte
- I. Forschungsstand
- II. Gesellschaftsordnung
- III. Gerichtswesen
- IV. Unrechtsfolgen
- V. Privatrecht
- C. Zuverlässigkeit der Angaben von Tacitus?
- D. Dauer und örtlicher Bereich der geschilderten Verhältnisse
- E. Beurteilung des Rechts der germanischen Zeit
- 21–41 3. Kapitel. Fränkische Zeit (ca. 500–888) 21–41
- A. Vorbemerkungen
- B. Rechtsquellen
- I. Leges barbarorum (Volksrechte)
- 1. Name und Entstehung
- 2. Die einzelnen Volksrechte
- 3. Sprache, Aufbau und Inhalt
- II. Andere unmittelbare Rechtsquellen
- 1. Kapitularien
- 2. Konzilsbeschlüsse
- III. Mittelbare Rechtsquellen
- 1. Formelsammlungen
- 2. Urkunden über Grundstücksgeschäfte
- 3. Urbare
- 4. Rechtswissenschaftliche Bücher
- 5. Chroniken
- C. Verfassung
- I. Monarchie
- II. Hofämter
- III. Grafen und Zentenare – Beginn des Lehenwesens
- IV. Grundherrschaft
- V. Die Kirche
- VI. Städte
- VII. Ländliche Besitzverhältnisse
- VIII. Mitwirkung des Volkes
- D. Recht im engeren Sinn
- I. Gerichtswesen
- 1. Dinggenossenschaft
- 2. Königsgericht
- 3. Grundherrliche Gerichte
- II. Strafrecht
- III. Privatrecht
- E. Würdigung des fränkischen Rechts
- 43–63 4. Kapitel. Hochmittelalter (888 – ca. 1200) 43–63
- A. Vorbemerkungen
- B. Territoriale Neugestaltungen
- C. Rechtsquellen
- D. Weiterentwicklung fränkischer Institutionen
- E. Lehensverhältnisse
- I. Terminologisches
- II. Entstehung
- III. Das Lehenrecht
- 1. Lehensfähigkeit und Heerschildordnung
- 2. Errichtung eines Lehensverhältnisses
- 3. Persönliche Wirkungen der Belehnung
- 4. Dingliche Wirkungen der Belehnung
- IV. Ausblick: Niedergang des Lehenwesens
- F. Die Kirche im Feudalstaat
- I. Vorbemerkungen: Geistige Grundlagen – Römisches Kirchenrecht
- II. Papsttum
- III. Bischöfe
- IV. Abteien
- V. Pfarreien
- VI. Schlussbemerkung
- G. Anfänge der Rezeption des römischen und kanonischen Rechts
- I. Die Rechtswissenschaft in Italien
- 1. Vorbemerkungen: Aufschwung des Handelsrechts
- 2. Römisches Recht: Die Glossatoren
- 3. Kanonisches Recht
- II. Einfluss auf die Praxis
- 65–98 5. Kapitel. Spätmittelalter (ca. 1200 – ca. 1500) 65–98
- A. Vorbemerkungen
- B. Verfassung
- I. Allgemeines
- II. Königtum und Kaisertum
- 1. Geistige Grundlagen
- 2. Schranken der monarchischen Gewalt – Widerstandsrecht
- 3. Königs- und Kaiserwahl
- 4. Krönung
- III. Anfänge des Reichstags
- IV. Die Landesherrschaft
- V. Städte
- 1. Begriffsmerkmale
- 2. Entstehung
- 3. Verfassung
- 4. Stadtherren
- 5. Konflikte zwischen Städten und Stadtherren
- 6. Innerstädtische Verfassungskämpfe
- 7. Ausübung der städtischen Autonomie – Wirtschaftsrecht, besonders Zunftwesen
- 8. Stadtrecht
- 9. Stadtrechtsfamilien
- 10. Ausblick: Niedergang der Städte in der frühen Neuzeit
- 11. Anhang: Bürger, citoyen und »Bourgeois«
- C. Rechtsquellen
- I. Quellen universalen Rechts
- II. Quellen des gemeinen Reichsrechts, dh des grundsätzlich im ganzen Reich geltenden Rechts
- 1. Reichsgesetze
- 2. Corpus iuris civilis
- 3. Libri feudorum
- 4. Literatur
- 5. Einzelurkunden
- III. Quellen partikulären Rechts
- 1. Unmittelbare Rechtsquellen
- 2. Mittelbare Rechtsquellen
- D. Privatrecht, Strafrecht und Prozessrecht
- I. Privatrecht
- II. Strafrecht
- III. Strafprozessrecht
- IV. Zivilprozessrecht
- 99–149 6. Kapitel. Frühe Neuzeit (ca. 1500–1806) 99–149
- A. Vorbemerkungen
- B. Reichsverfassung
- I. Reichsreformbestrebungen um 1500
- 1. Ewiger Landfriede (1495)
- 2. Reichskammergericht (1495)
- 3. Gemeiner Pfennig
- 4. Reichsregiment (1500–1502, 1521–1530)
- 5. Reichskreise
- II. Der Reichstag
- 1. Zusammensetzung des Reichstags im 16.–18. Jahrhundert
- 2. Verfahren
- 3. Kompetenzen und tatsächliche Wirksamkeit
- III. Der Kaiser
- IV. Weiterentwicklung der Reichsverfassung
- 1. Augsburger Religionsfrieden (1555)
- 2. Der Westfälische Frieden (1648)
- V. Beurteilung der Reichsverfassung
- VI. Ende der Reichsverfassung
- C. Territorialverfassungen
- I. Kräftigung der Landesherrschaft
- II. Konflikte mit den Landständen
- III. Aufbau moderner Staatswesen – Beispiele
- D. Grundherrschaft
- I. Terminologisches
- II. Rückblick auf die Entwicklung im Hoch- und Spätmittelalter
- III. Fortentwicklung in der frühen Neuzeit
- IV. Bäuerlicher Widerstand
- V. Ausblick: Aufhebung der Grundherrschaft
- E. Markgenossenschaften
- I. Terminologisches
- II. Ursprung: Entwicklung bis ca. 1500
- III. Fortentwicklung in der frühen Neuzeit
- IV. Besonderheiten in Westfalen als Beispiel einer Gegend mit vorherrschender Einzelhofsiedlung
- 1. Hutegenossenschaften
- 2. Nachbarschaften, Bauerschaften und Kirchspiele
- V. Auflösung der Markgenossenschaften
- VI. Rechtsnatur der Anteilsrechte an der gemeinen Mark nach ehemaligem und geltendem Recht
- F. Zivilrecht und Zivilprozessrecht
- I. Reichskammergerichtsordnung (1495)
- II. Stadt- und Landrechtsreformationen des 15.–17. Jahrhunderts
- III. Polizeiordnungen
- IV. Usus modernus Pandectarum
- V. Naturrecht
- VI. Kodifikationen
- 1. Codex Maximilianeus bavaricus civilis (1756)
- 2. Das Preußische Allgemeine Landrecht (= ALR, 1794)
- 3. Code civil (1804)
- 4. Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (= ABGB, 1811)
- VII. Zivilprozess
- G. Strafrecht und Strafprozessrecht
- I. Reformen unter Bewahrung des mittelalterlichen Strafrechtscharakters
- II. Reformpostulate der Aufklärungszeit
- 1. Christian Thomasius
- 2. Montesquieu
- 3. Beccaria
- III. Reformen der Aufklärungszeit
- 1. Einzelreformen
- 2. Kodifikationen
- IV. Strafrechtspostulate des deutschen Idealismus
- 1. Kant
- 2. Paul Anselm Feuerbach
- 3. Ausblick: Auswirkungen in den Strafgesetzbüchern des 19. Jahrhunderts
- 151–179 7. Kapitel. Das Zeitalter des liberalen Rechtsstaates (1806–1900) 151–179
- A. Zusammenbruch der mittelalterlichen Institutionen
- B. Verfassungen der Einzelstaaten
- I. Freiheitsrechte
- 1. Persönliche Freiheit
- 2. Freiheit des Bodens
- 3. Niederlassungsfreiheit
- 4. Handels- und Gewerbefreiheit
- 5. Ehefreiheit (Eheschließungsfreiheit)
- 6. Glaubens- und Gewissensfreiheit
- 7. Pressefreiheit
- 8. Vereinsfreiheit
- II. Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung
- III. Bindung der Regierung (im weitesten Sinn) an Gesetze
- 1. Der Grundsatz der gesetzmäßigen Verwaltung
- 2. Der Grundsatz »nulla poena sine lege«
- 3. Notwendigkeit der Begründung von Zivilurteilen
- IV. Strafprozess-Reformen
- 1. Trennung von Voruntersuchung und Hauptverfahren
- 2. Staatsanwaltschaft
- 3. Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit des Hauptverfahrens
- 4. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung
- 5. Schwurgerichte
- V. Gleichheitsgrundsatz
- VI. Allgemeine Wehrpflicht
- VII. Allgemeine Schulpflicht
- VIII. Universitätsreform
- C. Die Einigung Deutschlands
- I. Die Bundesakte v. 6. Juni 1815
- II. Die Gründung des Deutschen Zollvereins (1833)
- III. Die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 (Paulskirchenverfassung)
- IV. Der norddeutsche Bund
- V. Die Reichsverfassung von 1871
- D. Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871
- E. Die Reichsjustizgesetze von 1877
- F. Das Reichshaftpflichtgesetz von 1871
- G. Gesetze über den gewerblichen Rechtsschutz
- H. Kulturkampfgesetze (1871–1875)
- J. Die Vereinheitlichung des bürgerlichen Rechts
- I. Thibauts Schrift »Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland« (1814)
- II. Savignys Gegenschrift »Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft« (1814)
- III. Historische Rechtsschule
- IV. Pandektenwissenschaft und deutsches Privatrecht
- V. Reichsgesetze bis 1871
- 1. Allgemeine deutsche Wechselordnung (1848)
- 2. Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch (1861)
- 3. Dresdener Entwurf eines Obligationenrechts (1866)
- VI. Entstehung des BGB
- K. Sozialversicherungs-, arbeits- und wirtschaftsrechtliche Gesetze
- L. Zoll- und Steuergesetzgebung
- 181–234 8. Kapitel. Das Zeitalter des sozialen Rechtsstaates (20. Jahrhundert) 181–234
- A. Allgemeine Entwicklung – Verfassung
- I. Zustand um 1914
- II. Ende der konstitutionell-monarchischen Reichsverfassung (1918)
- III. Die Weimarer Reichsverfassung v. 11.8.1919
- 1. Entstehung
- 2. Inhalt
- 3. Auswirkungen
- IV. Die nationalsozialistische Zeit (1933–1945)
- 1. Lebenslauf Hitlers bis 1925
- 2. Grundgedanken und propagandistische Erfolge Hitlers
- 3. Hitlers Herrschaft
- 4. Die Juristen im Dritten Reich
- V. Die Zeit der Herrschaft von Besatzungsmächten (1945–1949)
- VI. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949
- 1. Entstehung
- 2. Inhalt
- 3. Auswirkungen
- 4. Wirtschaftliche Entwicklung
- VII. Die DDR und die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
- B. Entwicklung des Verwaltungsrechts
- I. Allgemeine Entwicklung
- II. Ausbau der Leistungsverwaltung
- III. Steuergesetzgebung
- IV. Verwaltungsrechtspflege
- C. Arbeitsrecht
- D. Wettbewerbsrecht
- E. Strafrecht und Strafprozessrecht
- I. Reformbestrebungen
- II. Widerstand der klassischen Strafrechtsschule
- III. Einzelreformen
- F. Zivilrecht
- I. Gesetzgebung
- II. Gerichtspraxis
- III. Rechtswissenschaft
- G. Zivilprozess
- 235–256 Namen- und Sachverzeichnis 235–256
- 257–257 Rechtssprichwörter 257–257
- 258–258 Impressum 258–258