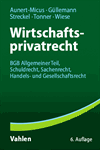Wirtschaftsprivatrecht
BGB Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht
Zusammenfassung
Zum Inhalt
Das erfolgreiche Studienbuch, nunmehr in 6. Auflage, behandelt kompakt, gut verständlich und aktuell die wirtschaftlich relevanten Bereiche des Bürgerlichen Rechts und des Handels- und Gesellschaftsrechts.
• BGB Allgemeiner Teil
• BGB Schuldrecht
• BGB Sachenrecht
• HGB Handelsrecht
• Gesellschaftsrecht
• AGG
• UN-Kaufrecht
Die Neuauflage bringt das Werk auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung. Es berücksichtigt insbesondere das neue Verbraucherrecht infolge der EU-Verbraucherrichtlinie, ferner die Änderungen im Kaufrecht, im Werkvertragsrecht mit den neuen Baurechtsverträgen und das neue Reiserecht. Das Internationale UN-Kaufrecht ist ebenfalls dargestellt.
Zur Didaktik
Besonders anschaulich durch
• viele Beispiele, Grafiken, Checklisten, Prüfungsschemata, Merksätze
• Wiederholungsfragen mit Rückverweisungen
• kurze Fälle mit Lösungshinweisen
• verständliche Sprache und gute Lesbarkeit
Damit wird ein nachhaltiger Lernerfolg gesichert.
Zielgruppe
Das Werk richtet sich an Studierende in betriebswirtschaftlichen, wirtschaftsjuristischen und rechtswissenschaftlichen Studiengängen an Hochschulen und Universitäten sowie in dualen Studiengängen und bereitet sie auf die Prüfungen vor.
Die Autoren
Prof. Dr. Shirley Aunert-Micus, Prof. em. Dr. Dirk Güllemann, Prof. em. Dr. Siegmar Streckel, Prof. Dr. Norbert Tonner und Prof. Dr. Ursula Eva Wiese, lehr(t)en sämtlich Wirtschaftsprivatrecht an der Hochschule Osnabrück und sind durch zahlreiche Veröffentlichungen ausgewiesen. Das Gemeinschaftswerk ist Ergebnis ihrer langjährigen Lehrtätigkeit.
Das Buch eignet sich für Bachelor- oder Masterstudiengänge in gleicher Weise.
- I–XXVIII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXVIII
- 1–20 1 Einführung 1–20
- 1.1 Begriff und Funktionen des Rechts
- 1.2 Rechtsquellen
- 1.2.1 Nationale Rechtsquellen
- 1.2.2 Rechtsquellen der EU
- 1.3 Das Rechtssystem
- 1.3.1 Privatrecht und öffentliches Recht
- 1.3.2 Sonstige Einteilungen des Rechts
- 1.3.2.1 Objektives Recht – Subjektives Recht
- 1.3.2.2 Absolutes Recht – Relatives Recht
- 1.3.2.3 Zwingendes Recht – Nachgiebiges (dispositives) Recht
- 1.4 Geschichte, Aufbau und Grundgedanken des BGB
- 1.4.1 Die Geschichte des BGB
- 1.4.2 Der Aufbau des BGB
- 1.4.3 Der Grundsatz der Privatautonomie
- 1.4.3.1 Die Vertragsfreiheit
- 1.4.3.2 Vereinigungsfreiheit, Eigentumsfreiheit, Testierfreiheit
- 1.5 Die deutsche Gerichtsbarkeit
- 1.5.1 Aufgaben und Aufbau der Gerichtsbarkeit
- 1.5.2 Die Zivilgerichtsbarkeit
- 1.5.3 Das Mahnverfahren
- 1.6 Methodik der Rechtsfindung – Fallbearbeitung
- 1.6.1 Grundsätzliches
- 1.6.2 Die Gesetzesauslegung
- 1.6.3 Die Subsumtion
- 1.6.4 Juristische Arbeitsmittel
- 21–44 2 Personen und Objekte im Rechtsverkehr 21–44
- 2.1 Natürliche Personen
- 2.1.1 Rechtsfähigkeit
- 2.1.2 Handlungsfähigkeit
- 2.1.2.1 Geschäftsfähigkeit
- 2.1.2.2 Deliktsfähigkeit
- 2.1.2.3 Verschuldensfähigkeit
- 2.1.3 Bedeutung des Wohnsitzes
- 2.1.4 Namensrecht
- 2.1.5 Natürliche Personen als Verbraucher/Unternehmer
- 2.2 Juristische Personen
- 2.2.1 Juristische Personen des öffentlichen Rechts
- 2.2.2 Juristische Personen des Privatrechts
- 2.2.2.1 Die Stiftung
- 2.2.2.2 Der Verein
- 2.2.2.3 Der nichtrechtsfähige Verein
- 2.3 Objekte des Rechtsverkehrs (§§ 90 ff. BGB)
- 2.3.1 Rechtsobjekte
- 2.3.2 Sachen
- 2.3.2.1 Bewegliche Sachen
- 2.3.2.2 Verbrauchbare und nicht verbrauchbare Sachen
- 2.3.2.3 Unbewegliche Sachen
- 2.3.2.4 Teilbare und unteilbare Sachen
- 2.3.2.5 Bestandteile, Zubehör, Nutzungen, Früchte, Lasten
- 2.3.2.6 Tiere
- 2.3.3 Rechte
- 2.3.3.1 Absolute und relative Rechte
- 2.3.3.2 Gestaltungsrechte, Einreden, Einwendungen
- 45–73 3 Grundlagen des Handelsrechts 45–73
- 3.1 Grundgedanken und Aufbau
- 3.1.1 Handelsrecht als Sonderprivatrecht
- 3.1.2 Rechtsquellen des Handelsrechts
- 3.1.3 Der Begriff des Kaufmanns
- 3.2 Der Kaufmann
- 3.2.1 Das Betreiben eines Gewerbes
- 3.2.1.1 Der Begriff des Gewerbes
- 3.2.1.2 Der Begriff des Betreibens
- 3.2.2 Der Istkaufmann (Kaufmann kraft Betätigung, § 1 HGB)
- 3.2.3 Der Kannkaufmann (Kaufmann kraft Eintragung, § 2 HGB)
- 3.2.4 Kaufmann bei Land- und Forstwirtschaft (§ 3 HGB)
- 3.2.5 Der Formkaufmann (§ 6 HGB)
- 3.2.5.1 Kapitalgesellschaften
- 3.2.5.2 Personenhandelsgesellschaften
- 3.2.6 Fiktivkaufmann und Scheinkaufmann
- 3.2.6.1 Der Fiktivkaufmann (§ 5 HGB)
- 3.2.6.2 Der Scheinkaufmann
- 3.3 Das Handelsregister
- 3.3.1 Begriff, Aufgaben und Inhalt des Handelsregisters
- 3.3.2 Formelles Handelsregisterrecht
- 3.3.3 Die Publizität des Handelsregisters nach § 15 HGB
- 3.3.3.1 Der Schutz Dritter bei fehlender Eintragung und Bekanntmachung eintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 I HGB)
- 3.3.3.2 Der Schutz bei richtiger Eintragung und Bekanntmachung von Tatsachen (§ 15 II HGB)
- 3.3.3.3 Der Schutz Dritter bei unrichtiger Bekanntmachung eintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 III HGB)
- 3.4 Die Handelsfirma
- 3.4.1 Begriff und Bedeutung
- 3.4.2 Grundsätze der Firmenbildung und Firmenführung
- 3.4.2.1 Firmenwahrheit
- 3.4.2.2 Firmenbeständigkeit
- 3.4.2.3 Firmeneinheit
- 3.4.2.4 Firmenausschließlichkeit
- 3.4.2.5 Firmenöffentlichkeit
- 3.4.2.6 Firmenschutz
- 75–91 4 Das Rechtsgeschäft 75–91
- 4.1 Arten
- 4.1.1 Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte
- 4.1.2 Verpflichtungsgeschäfte
- 4.1.3 Verfügungsgeschäfte
- 4.1.4 Abstraktionsgrundsatz
- 4.2 Die Willenserklärung
- 4.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen
- 4.2.1.1 Objektiver Tatbestand
- 4.2.1.2 Subjektiver Tatbestand
- 4.2.2 Wirksamwerden der Willenserklärung
- 4.2.2.1 Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung
- 4.2.2.2 Zugang einer empfangsbedürftigen Willenserklärung
- 4.2.2.3 Widerruf
- 4.2.2.4 Vereitelung des Zugangs
- 4.2.3 Auslegung
- 4.2.3.1 Begriffsbestimmung
- 4.2.3.2 Auslegung von Willenserklärungen
- 4.2.3.3 Auslegung von Verträgen
- 4.3 Form des Rechtsgeschäfts
- 4.3.1 Sinn und Zweck der Formbedürftigkeit
- 4.3.2 Formarten
- 4.3.2.1 Schriftformarten
- 4.3.2.2 Notarielle Beurkundung
- 4.3.2.3 Öffentliche Beglaubigung
- 4.3.3 Rechtsfolgen eines Formmangels
- 93–107 5 Der Vertrag 93–107
- 5.1 Grundsatz der Vertragsfreiheit
- 5.2 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – AGG
- 5.2.1 Ziel und Anwendungsbereich
- 5.2.2 Die Diskriminierungsgründe im Einzelnen
- 5.2.3 Zulässigkeit unterschiedlicher Behandlungen
- 5.2.4 Rechtsfolgen einer Verletzung
- 5.2.5 Beweislast und Rechtsschutz
- 5.3 Vorstufen des Vertragsschlusses
- 5.4 Zustandekommen des Vertrages
- 5.4.1 Angebot
- 5.4.2 Annahme
- 5.4.2.1 Modifizierte Annahme
- 5.4.2.2 Rechtzeitigkeit der Annahme
- 5.4.2.3 Annahmeerklärung ohne Zugang
- 5.5 Dissens
- 5.5.1 Offener Dissens
- 5.5.2 Versteckter Dissens
- 5.6 Bindungswirkung des Vertrages
- 109–126 6 Mängel des Rechtsgeschäfts und deren Folgen 109–126
- 6.1 Nichtigkeit von Rechtsgeschäften
- 6.1.1 Geschützte Personen
- 6.1.2 Formverstöße
- 6.1.3 Gesetzliche Verbote
- 6.1.4 Sittenwidrige Rechtsgeschäfte
- 6.1.4.1 Der Wuchertatbestand
- 6.1.4.2 Sittenwidrigkeit gem. § 138 BGB
- 6.2 Nichtigkeit und Anfechtbarkeit bei Willensmängeln
- 6.2.1 Willensvorbehalte
- 6.2.2 Irrtümer bei der Willenserklärung
- 6.2.2.1 Begriff des Irrtums und Abgrenzungen
- 6.2.2.2 Der unbeachtliche Irrtum
- 6.3 Arten von Irrtümern
- 6.3.1 Der Inhaltsirrtum (§ 119 I 1. Alt. BGB)
- 6.3.2 Der Erklärungsirrtum (§ 119 I 2. Alt. BGB)
- 6.3.3 Der Kalkulationsirrtum
- 6.3.4 Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften (§ 119 II BGB)
- 6.3.5 Übermittlungsfehler (§ 120 BGB)
- 6.4 Willensbeeinträchtigung aufgrund arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung gem. § 123 BGB
- 6.4.1 Arglistige Täuschung
- 6.4.2 Widerrechtliche Drohung
- 6.5 Voraussetzungen der Anfechtung und deren Rechtsfolgen
- 6.5.1 Voraussetzungen der Anfechtung
- 6.5.1.1 Anfechtungsgründe
- 6.5.1.2 Anfechtungserklärung (§ 143 BGB)
- 6.5.1.3 Anfechtungsfristen (§§ 121, 124 BGB)
- 6.5.1.4 Ausschlussgründe
- 6.5.2 Rechtsfolgen der Anfechtung
- 6.5.2.1 Nichtigkeit (§ 142 BGB)
- 6.5.2.2 Schadensersatzverpflichtung (§ 122 BGB)
- 6.6 Nichtigkeit und Umdeutung
- 127–141 7 Allgemeine Geschäftsbedingungen 127–141
- 7.1 Begriff der AGB
- 7.2 Funktionen und Erscheinungsformen von AGB
- 7.3 Rechtliche Grundlagen
- 7.4 Einbeziehung von AGB
- 7.5 Überraschende, mehrdeutige Klauseln und Vorrang von Individualvereinbarungen
- 7.6 Inhaltskontrolle von AGB
- 7.6.1 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
- 7.6.2 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
- 7.6.3 Generalklausel
- 7.7 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit
- 7.8 Anwendungsbereich
- 7.8.1 Beschränkungen in persönlicher Hinsicht
- 7.8.2 Beschränkungen in sachlicher Hinsicht
- 7.8.3 Erweiterungen bei Verbraucherverträgen
- 7.9 Individueller Rechtsschutz und Verbandsklagen
- 143–162 8 Die Stellvertretung 143–162
- 8.1 Begriff und Anwendungsbereich der Stellvertretung
- 8.2 Voraussetzungen der Stellvertretung
- 8.2.1 Eigene Willenserklärung des Vertreters
- 8.2.2 Handeln im fremden Namen
- 8.2.2.1 Offenkundigkeitsprinzip
- 8.2.2.2 Einschränkungen des Offenkundigkeitsgrundsatzes
- 8.2.3 Vertretungsmacht
- 8.2.3.1 Erteilung der Vollmacht
- 8.2.3.2 Form der Vollmacht
- 8.2.3.3 Erlöschen der Vollmacht
- 8.2.3.4 Schutz des guten Glaubens an die Vollmacht
- 8.2.4 Handelsrechtliche Spezialvollmachten
- 8.2.4.1 Die Prokura
- 8.2.4.2 Die Handlungsvollmacht
- 8.2.5 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht
- 8.2.6 Einschränkungen der Vertretungsmacht
- 8.2.6.1 Verbot des Insichgeschäfts
- 8.2.6.2 Missbrauch der Vertretungsmacht
- 163–173 9 Verjährung/Fristen/Termine 163–173
- 9.1 Fristen und Termine (§§ 187 ff. BGB)
- 9.1.1 Begriff
- 9.1.2 Berechnung von Fristen und Terminen
- 9.2 Die Verjährung von Rechtsansprüchen
- 9.2.1 Einführung
- 9.2.1.1 Der Verjährungsgegenstand
- 9.2.1.2 Gestaltungsrechte und unverjährbare Ansprüche
- 9.2.1.3 Abgrenzungen
- 9.2.1.4 Wirkung der Verjährung
- 9.3 Die Verjährungsregelungen des BGB
- 9.3.1 Zentrale Gesetzesregelungen
- 9.3.2 Verjährungsfristen
- 9.3.2.1 Grundlagen der regelmäßigen Verjährung
- 9.3.2.2 Abweichende Verjährungsregelungen (§§ 196, 197 BGB)
- 9.3.3 Sonderregelungen zur Verjährung, insbesondere im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht
- 9.3.3.1 Verjährungsregelungen im Kaufrecht
- 9.3.3.2 Verjährungsregelungen im Werkvertragsrecht
- 9.3.4 Verjährungsvereinbarungen
- 9.3.5 Inhaltskontrolle gem. §§ 305 ff. BGB
- 9.4 Hemmung und Neubeginn der Verjährung
- 9.4.1 Hemmung der Verjährung
- 9.4.1.1 Wirkung der Hemmung
- 9.4.1.2 Gründe der Hemmung
- 9.4.2 Neubeginn der Verjährung
- 175–208 10 Inhalt von Schuldverhältnissen 175–208
- 10.1 Begriff des Schuldverhältnisses
- 10.2 Begründung und Arten der Schuldverhältnisse
- 10.2.1 Rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis
- 10.2.2 Rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis
- 10.2.3 Dritthaftung
- 10.2.4 Gesetzliches Schuldverhältnis
- 10.3 Leistungspflicht
- 10.3.1 Hauptpflichten/Nebenpflichten
- 10.3.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben
- 10.4 Der Leistungsgegenstand
- 10.4.1 Stückschuld
- 10.4.2 Gattungsschuld
- 10.4.3 Geld- und Zinsschuld
- 10.4.3.1 Geldschuld
- 10.4.3.2 Zinsschuld
- 10.5 Der Leistungsort (§ 269 BGB)
- 10.6 Leistungszeit (§ 271 BGB)
- 10.7 Verbraucherverträge und besondere Vertriebsformen
- 10.7.1 Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 10.7.2. Allgemeine Vorgaben für Verbraucherverträge (§§ 312, 312a, 312k BGB)
- 10.7.3 Besondere Vertriebsformen
- 10.7.3.1 Außergeschäftsraumverträge (AGV, § 312 b BGB)
- 10.7.3.2 Fernabsatzverträge (§§ 312c–h BGB)
- 10.7.3.3 Informationspflichten bei AGV und Fernabsatzverträgen
- 10.7.3.4 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
- 10.7.4 Elektronischer Geschäftsverkehr (§ 312i BGB)
- 10.7.4.1 Begriff
- 10.7.4.2 Pflichten des Unternehmers
- 10.8 Die Beteiligung mehrerer am Schuldverhältnis
- 10.8.1 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
- 10.8.1.1 Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB)
- 10.8.1.2 Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- 10.8.2 Gläubigerwechsel
- 10.8.2.1 Voraussetzungen der Abtretung
- 10.8.2.2 Rechtsfolgen der Abtretung
- 10.8.2.3 Besondere Formen der Abtretung im Rahmen der Kreditsicherung
- 10.8.2.4 Gesetzlicher Forderungsübergang
- 10.8.2.5 Übertragung anderer Rechte
- 10.8.3 Schuldnerwechsel
- 10.8.4 Gesamtschuldnerschaft
- 10.8.4.1 Außenverhältnis zu den Gläubigern
- 10.8.4.2 Innenverhältnis der Gesamtschuldner
- 10.8.5 Gesamtgläubigerschaft
- 209–218 11 Beendigung von Schuldverhältnissen 209–218
- 11.1 Erfüllung (§§ 362 BGB)
- 11.2 Leistung an Erfüllungs statt (§ 364 I BGB)/Leistung erfüllungshalber (§ 364 II BGB)
- 11.3 Hinterlegung
- 11.4 Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB)
- 11.4.1 Aufrechnungsvoraussetzungen
- 11.4.1.1 Aufrechnungslage
- 11.4.1.2 Aufrechnungserklärung
- 11.4.1.3 Ausschluss der Aufrechnung
- 11.4.2 Wirkung der Aufrechnung
- 11.5 Erlass
- 11.6 Rücktritt, Kündigung
- 11.6.1 Rücktritt
- 11.6.2 Kündigung
- 11.7 Aufhebungsvertrag
- 11.8 Störung bzw. Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
- 219–259 12 Leistungsstörungen 219–259
- 12.1 Begriff
- 12.2 Systematik des Leistungsstörungsrechts
- 12.2.1 Schadensersatz bei Pflichtverletzung
- 12.2.2 § 280 I BGB als Schlüsselvorschrift für Schadensersatzansprüche
- 12.2.2.1 Bestehen eines Schuldverhältnisses
- 12.2.2.2 Pflichtverletzung
- 12.2.2.3 Vertretenmüssen
- 12.2.2.4 Schadensersatz neben der Leistung als Rechtsfolge
- 12.2.3 Schadensersatz statt der Leistung bei speziellen Leistungsstörungstatbeständen
- 12.2.4 Ersatz vergeblicher Aufwendungen anstelle von Schadensersatz (§ 284 BGB)
- 12.2.5 Leistungsstörungen bei gegenseitig verpflichtenden Verträgen (§§ 320 ff. BGB)
- 12.3 Unmöglichkeit
- 12.3.1 Ausschluss der Leistungspflicht bei tatsächlicher Unmöglichkeit, § 275 I BGB
- 12.3.2 Ausschluss der Leistungspflicht bei faktischer Unmöglichkeit und höchstpersönlichen Leistungen, § 275 II, III BGB
- 12.3.3 Abgrenzung zur Störung/Wegfall der Geschäftsgrundlage
- 12.3.4 Schadensersatz bei ursprünglicher Unmöglichkeit, § 311a BGB
- 12.3.5 Schadensersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit
- 12.3.6 Befreiung von der Pflicht zur Gegenleistung, § 326 BGB
- 12.3.7 Rückforderungsanspruch nach § 326 IV BGB und Rücktritt bei Unmöglichkeit, § 326 V iVm § 323 BGB
- 12.4 Schuldnerverzug (Verzögerung der Leistung)
- 12.4.1 Begriff
- 12.4.2 Ersatz des Verzögerungsschadens
- 12.4.2.1 Voraussetzungen
- 12.4.2.2 Rechtsfolgen
- 12.4.3 Schadensersatz statt der Leistung
- 12.4.3.1 Voraussetzungen
- 12.4.3.2 Rechtsfolgen
- 12.4.4 Rücktrittsrecht, § 323 BGB
- 12.4.4.1 Voraussetzungen
- 12.4.4.2 Rechtsfolgen
- 12.4.5 Weitere Verzugsfolgen
- 12.5 Schlechtleistung
- 12.5.1 Begriff
- 12.5.2 Verletzung einer leistungsbezogenen Pflicht (Qualitätsmangel)
- 12.5.2.1 Schadensersatz statt der Leistung
- 12.5.2.2 Rücktritt
- 12.5.3 Verletzung einer Schutzpflicht iSv § 241 II BGB
- 12.5.3.1 Schadensersatz neben der Leistung (Begleitschäden)
- 12.5.3.2 Schadensersatz statt der Leistung
- 12.5.3.3 Rücktritt, § 324 BGB
- 12.5.4 Schadensersatz bei Verletzung vorvertraglicher Pflichten
- 12.6 Der Gläubiger- oder Annahmeverzug
- 12.6.1 Voraussetzungen des Gläubigerverzugs
- 12.6.2 Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs
- 261–298 13 Veräußerungsverträge 261–298
- 13.1 Kaufvertrag
- 13.1.1 Begriff und wirtschaftliche Bedeutung
- 13.1.2 Gesetzliche Grundlagen – Reform des Kaufrechts
- 13.1.3 Überblick über das Kaufrecht
- 13.1.4 Allgemeine Charakterisierung des Kaufs
- 13.1.4.1 Verpflichtungscharakter
- 13.1.4.2 Kaufgegenstand
- 13.1.4.3 Form
- 13.1.5 Pflichten des Verkäufers
- 13.1.5.1 Die Eigentumsverschaffung
- 13.1.5.2 Besitzverschaffung
- 13.1.5.3 Mangelfreiheit
- 13.1.5.4 Nebenleistungspflichten
- 13.1.6 Pflichten des Käufers
- 13.1.6.1 Zahlung des Kaufpreises
- 13.1.6.2 Abnahme
- 13.1.6.3 Nebenleistungspflichten
- 13.1.7 Gefahrtragung
- 13.1.8 Mängelhaftung
- 13.1.8.1 Die Struktur der Mängelhaftung
- 13.1.8.2 Mängelrechte des Käufers im Überblick
- 13.1.8.3 Voraussetzungen der Mängelhaftung
- 13.1.8.4 Ausschluss der Mängelhaftung
- 13.1.8.5 Inhalt der Mängelhaftung
- 13.1.8.6 Nacherfüllung
- 13.1.8.7 Rücktritt
- 13.1.8.8 Minderung
- 13.1.8.9 Schadensersatz im Allgemeinen
- 13.1.8.10 Schadensersatz statt der Leistung
- 13.1.8.11 Schadensersatz neben der Leistung
- 13.1.9 Kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht
- 13.1.10 Garantie
- 13.1.11 Rückgriff des Unternehmers in einer Lieferkette
- 13.1.12 Verjährung der Mängelansprüche
- 13.1.13 Besondere Arten des Kaufs
- 13.1.13.1 Verbrauchsgüterkauf
- 13.1.13.2 Kauf unter Eigentumsvorbehalt
- 13.1.13.3 Finanzierungshilfen
- 13.1.13.4 Besondere Vertriebsformen beim Kauf
- 13.1.13.5 Kauf auf Probe
- 13.1.13.6 Wiederkauf
- 13.1.13.7 Vorkauf
- 13.2 Internationaler Kauf, insb. UN-Kaufrecht
- 13.3 Tausch
- 13.4 Schenkung
- 299–316 14 Überlassungsverträge 299–316
- 14.1 Mietvertrag/Pachtvertrag
- 14.1.1 Definition und Gegenstand des Mietvertrages
- 14.1.2 Systematik des Gesetzes
- 14.1.3 Rechte und Pflichten der Mietvertragsparteien
- 14.1.3.1 Rechte und Pflichten des Vermieters
- 14.1.3.2 Rechte und Pflichten des Mieters
- 14.1.3.3 Folgen der Verletzung vertraglicher Pflichten der Mietparteien
- 14.1.4 Beendigung des Mietverhältnisses
- 14.1.5 Weitere Besonderheiten der Mietverhältnisse über Wohnraum
- 14.2 Pachtvertrag
- 14.3 Leasingvertrag
- 14.4 Leihe (§§ 598–606 BGB)
- 14.5 Darlehensvertrag
- 14.5.1 Sachdarlehen
- 14.5.2 Das (Geld-)Darlehen (§§ 488–505e, 511–514 BGB)
- 14.6 Finanzierungshilfen und Ratenkreditverträge (§§ 506–515 BGB)
- 317–348 15 Werkverträge und Dienstleistungsverträge 317–348
- 15.1 Werkvertrag
- 15.1.1 Charakteristik
- 15.1.2 Vertragsgegenstand
- 15.1.3 Vertragstypische Pflichten im Überblick
- 15.1.4 Pflichten des Unternehmers
- 15.1.4.1 Die Werkherstellung
- 15.1.4.2 Mangelfreiheit und Mängelhaftung
- 15.1.4.3 Voraussetzungen der Mängelhaftung
- 15.1.4.4 Ausschluss der Mängelhaftung
- 15.1.4.5 Inhalt der Mängelhaftung
- 15.1.4.6 Nacherfüllung
- 15.1.4.7 Selbstvornahme
- 15.1.4.8 Rücktritt
- 15.1.4.9 Minderung
- 15.1.4.10 Schadensersatzansprüche
- 15.1.4.11 Aufwendungsersatz
- 15.1.4.12 Verjährung der Mängelrechte
- 15.1.5 Pflichten des Bestellers
- 15.1.5.1 Abnahmepflicht
- 15.1.5.2 Vergütungspflicht
- 15.1.6 Beendigung durch Kündigung
- 15.2 Bau-Werkverträge
- 15.2.1 Der Bauvertrag, § 650a BGB
- 15.2.2 Der Verbraucherbauvertrag, § 650i BGB
- 15.2.3 Der Architekten- und Ingenieurvertrag, § 650p BGB
- 15.2.4 Der Bauträgervertrag, § 650u BGB
- 15.3 Dienstvertrag und ähnliche Verträge
- 15.3.1 Charakteristik und Erscheinungsformen
- 15.3.2 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag
- 15.3.2.1 Pflichten des Dienstverpflichteten
- 15.3.2.2 Pflichten des Dienstberechtigten
- 15.3.3 Pflichtverletzungen
- 15.3.3.1 Pflichtverletzungen durch den Dienstverpflichteten
- 15.3.3.2 Pflichtverletzungen durch den Dienstberechtigten
- 15.3.4 Beendigung des Dienstverhältnisses
- 15.3.4.1 Ordentliche Kündigung
- 15.3.4.2 Außerordentliche Kündigung
- 15.3.5 Medizinische Behandlungsverträge
- 15.4 Sonstige Dienstleistungsverträge im Überblick
- 15.4.1 Auftrag
- 15.4.2 Geschäftsbesorgungsvertrag
- 15.4.3 Reisevertrag
- 15.4.4 Maklervertrag
- 349–381 16 Gesetzliche Schuldverhältnisse 349–381
- 16.1 Unerlaubte Handlungen
- 16.1.1 Schadensersatzanspruch gem. § 823 I BGB
- 16.1.1.1 Betroffenes Recht oder Rechtsgut
- 16.1.1.2 Verletzungshandlung
- 16.1.1.3 Kausalität
- 16.1.1.4 Rechtswidrigkeit
- 16.1.1.5 Verschulden
- 16.1.1.6 Schaden
- 16.1.1.7 Schmerzensgeld
- 16.1.2 Schadensersatzanspruch gem. § 823 II BGB in Verbindung mit einem Schutzgesetz
- 16.1.3 Schadensersatzanspruch gem. § 831 BGB
- 16.1.3.1 Verrichtungsgehilfe
- 16.1.3.2 Tatbestandsmäßige und rechtswidrige unerlaubte Handlung
- 16.1.3.3 Handeln in Ausführung der Verrichtung
- 16.1.3.4 Rechtswidrigkeit
- 16.1.3.5 Verschulden des Geschäftsherrn
- 16.1.4 Konkurrenz zwischen § 831 BGB und § 278 BGB
- 16.2 Produkthaftung
- 16.2.1 Produzentenhaftung gem. § 823 I BGB
- 16.2.1.1 Hersteller
- 16.2.1.2 Produktspezifische Verkehrssicherungspflicht
- 16.2.1.3 Verschulden des Herstellers
- 16.2.2 Haftung gem. § 1 Produkthaftungsgesetz (ProdHG)
- 16.2.2.1 Verletzungserfolg
- 16.2.2.2 Produktfehler
- 16.2.2.3 Hersteller
- 16.2.2.4 Kein Haftungsausschluss gem. § 1 II, III ProdHG
- 16.2.2.5 Rechtsfolge
- 16.2.2.6 Beweislast
- 16.3 Grundzüge der ungerechtfertigten Bereicherung
- 16.3.1 Die Leistungskondiktion gem. § 812 I 1, 1. Alt. BGB
- 16.3.1.1 Das erlangte Etwas
- 16.3.1.2 Leistung
- 16.3.1.3 Ohne Rechtsgrund
- 16.3.1.4 Kein Ausschluss des Anspruchs
- 16.3.1.5 Rechtsfolgen
- 16.3.1.6 Wegfall der Bereicherung
- 16.3.1.7 Haftungsverschärfung
- 16.3.2 Die Eingriffskondiktion gem. § 812 I 1, 2. Alt. BGB
- 16.3.2.1 Das erlangte Etwas
- 16.3.2.2 In sonstiger Weise
- 16.3.2.3 Auf Kosten eines anderen
- 16.3.2.4 Ohne Rechtsgrund
- 16.3.3 Ansprüche aus § 816 BGB
- 16.3.3.1 Entgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten
- 16.3.3.2 Unentgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten
- 16.3.3.3 Leistung an einen Nichtberechtigten
- 383–417 17 Grundzüge des Sachenrechts 383–417
- 17.1 Einführung
- 17.2 Aufbau, Bedeutung und Grundprinzipien des Sachenrechts
- 17.3 Besitz
- 17.3.1 Begriff
- 17.3.2 Arten
- 17.3.3 Erwerb und Verlust
- 17.3.4 Besitzschutz
- 17.4 Eigentum
- 17.4.1 Begriff und Wesen
- 17.4.2 Schranken des Eigentums
- 17.4.3 Eigentumsformen
- 17.4.4 Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an beweglichen Sachen
- 17.4.4.1 Einigung
- 17.4.4.2 Übergabe
- 17.4.4.3 Berechtigung des Veräußerers
- 17.4.4.4 Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten
- 17.4.5 Gesetzlicher Eigentumserwerb an beweglichen Sachen
- 17.4.5.1 Ersitzung
- 17.4.5.2 Verbindung, Vermischung, Verarbeitung
- 17.4.5.3 Aneignung
- 17.4.5.4 Fund
- 17.4.5.5 Erbfall
- 17.4.6 Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an Grundstücken
- 17.4.6.1 Einigung (Auflassung)
- 17.4.6.2 Eintragung ins Grundbuch
- 17.4.6.3 Berechtigung
- 17.4.6.4 Vormerkung
- 17.5 Eigentumsschutz
- 17.5.1 Der Herausgabeanspruch nach §§ 985, 986 BGB
- 17.5.2 Nutzungsersatz- und Schadensersatzansprüche sowie Verwendungsersatzansprüche nach §§ 987 ff. BGB
- 17.5.3 Der Störungsbeseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB
- 17.5.4 Schadensersatzansprüche nach § 823 I BGB
- 17.6 Grundpfandrechte
- 17.6.1 Hypothek
- 17.6.1.1 Bestellung der Hypothek
- 17.6.1.2 Rangverhältnisse
- 17.6.1.3 Hypothekenarten
- 17.6.1.4 Gegenstand der Hypothekenhaftung
- 17.6.1.5 Übertragung der Hypothek
- 17.6.1.6 Tilgung der Hypothek
- 17.6.1.7 Verwertung der Hypothek
- 17.6.2 Grundschuld
- 17.6.3 Rentenschuld
- 419–437 18 Handelsgeschäfte 419–437
- 18.1 Begriff, Vermutung für Handelsgeschäfte, Arten
- 18.1.1 Begriff und Vermutung für Handelsgeschäfte
- 18.1.2 Arten
- 18.2 Besonderheiten beim Zustandekommen und der Auslegung
- 18.2.1 Schweigen im Handelsverkehr
- 18.2.1.1 Schweigen auf ein Angebot zur Geschäftsbesorgung
- 18.2.1.2 Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben
- 18.2.2 Handelsbrauch
- 18.3 Besonderheiten der kaufmännischen Leistungspflicht
- 18.3.1 Kaufmännische Sorgfaltspflich
- 18.3.2 Bürgerlich-rechtliche Schutzvorschriften
- 18.3.3 Entgeltlichkeit der kaufmännischen Leistung
- 18.3.4 Zeit und Art und Weise der Leistung
- 18.4 Spezielle Handelsgeschäfte
- 18.4.1 Das Kommissionsgeschäft
- 18.4.1.1 Bedeutung, Begriff, Arten
- 18.4.1.2 Das Rechtsverhältnis zwischen Kommissionär und Kommittent
- 18.4.1.3 Der Schutz des Kommittenten (gegenüber Dritten)
- 18.4.2 Transportgeschäfte
- 18.4.2.1 Das Frachtgeschäft
- 18.4.2.2 Das Speditionsgeschäft
- 18.4.2.3 Das Lagergeschäft
- 439–470 19 Die Personengesellschaften 439–470
- 19.1 Einteilung der Gesellschaften
- 19.2 Die BGB-Gesellschaft
- 19.2.1 Einführung
- 19.2.2 Grundlagen und Entstehung
- 19.2.2.1 Der Gesellschaftsvertrag
- 19.2.2.2 Der Gesellschaftszweck und die Beitragspflicht
- 19.2.2.3 Gesellschafterbeschlüsse
- 19.2.3 Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft
- 19.2.4 Das Gesellschaftsvermögen
- 19.2.5 Geschäftsführung und Vertretung
- 19.2.5.1 Die Geschäftsführung
- 19.2.5.2 Widerspruchsrecht
- 19.2.5.3 Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis
- 19.2.6 Die Vertretung
- 19.2.7 Haftung
- 19.2.7.1 Haftung der Gesellschafter und der Gesellschaft
- 19.2.7.2 Gesamtschuldnerische Haftung
- 19.2.7.3 Das Gesamtschuldverhältnis
- 19.2.7.4 Haftungsbeschränkungen
- 19.2.7.5 Haftung für deliktisches Verhalten
- 19.2.8 Rechte und Pflichten der Gesellschafter im Innenverhältnis
- 19.2.8.1 Pflichten der Gesellschafter
- 19.2.8.2 Rechte der Gesellschafter
- 19.2.9 Gesellschafterwechsel
- 19.2.9.1 Ausscheiden eines Gesellschafters
- 19.2.9.2 Rechtsfolgen
- 19.2.9.3 Der Eintritt eines neuen Gesellschafters
- 19.2.9.4 Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils
- 19.2.10 Tod eines Gesellschafters
- 19.2.11 Auflösung
- 19.2.11.1 Auflösungsgründe
- 19.2.11.2 Kündigung
- 19.2.11.3 Auseinandersetzung
- 19.3 Die offene Handelsgesellschaft (OHG)
- 19.3.1 Einführung
- 19.3.2 Grundlagen und Entstehung
- 19.3.2.1 Der Gesellschaftsvertrag
- 19.3.2.2 Der gemeinsame Zweck
- 19.3.2.3 Eintragung/Entstehung
- 19.3.2.4 Gemeinsame Firma
- 19.3.2.5 Gesellschafterbeschlüsse
- 19.3.3 Rechtsfähigkeit
- 19.3.4 Gesellschaftsvermögen
- 19.3.5 Geschäftsführung und Vertretung
- 19.3.5.1 Die Geschäftsführungsbefugnis
- 19.3.5.2 Das Alleinvertretungsrecht
- 19.3.6 Haftung
- 19.3.6.1 Haftung der Gesellschaft
- 19.3.6.2 Haftung der Gesellschafter nach § 128 HGB
- 19.3.6.3 Haftung neu eintretender und ausscheidender Gesellschafter
- 19.3.7 Pflichten und Rechte im Innenverhältnis
- 19.3.7.1 Pflichten der Gesellschafter
- 19.3.7.2 Rechte der Gesellschafter
- 19.3.8 Gesellschafterwechsel
- 19.3.8.1 Ausscheiden eines Gesellschafters
- 19.3.8.2 Eintritt eines neuen Gesellschafters
- 19.3.9 Auflösung der OHG
- 19.3.9.1 Auflösungsgründe
- 19.3.9.2 Abwicklung
- 19.4 Die Kommanditgesellschaft (KG)
- 19.4.1 Einführung
- 19.4.2 Entstehung und Grundlagen
- 19.4.3 Geschäftsführung und Vertretung
- 19.4.4 Haftung
- 19.4.4.1 Haftung des Kommanditisten
- 19.4.4.2 Haftung neu eintretender sowie ausscheidender Gesellschafter
- 19.4.5 Pflichten und Rechte der Gesellschafter
- 19.4.5.1 Pflichten der Gesellschafter
- 19.4.5.2 Rechte der Gesellschafter
- 19.4.6 Gesellschafterwechsel
- 19.4.6.1 Ausscheiden eines Gesellschafters
- 19.4.6.2 Eintritt eines neuen Gesellschafters
- 19.4.7 Auflösung der KG
- 471–498 20 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 471–498
- 20.1 Bedeutung
- 20.2 Gründung
- 20.2.1 Der Gesellschaftsvertrag
- 20.2.2 Bestellung des Geschäftsführers
- 20.2.3 Aufbringung des Stammkapitals
- 20.2.3.1 Die Bargründung
- 20.2.3.2 Die Sachgründung
- 20.2.3.3 Sicherung der Erfüllung der Einlagepflicht
- 20.2.4 Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister und Eintragung
- 20.3 Haftung im Gründungsstadium
- 20.3.1 Vorgründungsgesellschaft
- 20.3.2 Vor-GmbH
- 20.3.2.1 Merkmale der Vor-GmbH
- 20.3.2.2 Haftung in der Vor-GmbH
- 20.3.3 Handelndenhaftung
- 20.4 Organe der GmbH
- 20.4.1 Der Geschäftsführer
- 20.4.1.1 Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer
- 20.4.1.2 Vertretung der GmbH durch die Geschäftsführer
- 20.4.1.3 Rechte und Pflichten der Geschäftsführer
- 20.4.1.4 Haftung der Geschäftsführer
- 20.4.2 Die Gesellschafterversammlung
- 20.4.2.1 Aufgaben
- 20.4.2.2 Beschlussfassung
- 20.4.3 Der Aufsichtsrat
- 20.5 Rechte und Pflichten der Gesellschafter
- 20.5.1 Rechte der Gesellschafter
- 20.5.1.1 Vermögensrechte
- 20.5.1.2 Verwaltungsrechte
- 20.5.2 Pflichten der Gesellschafter
- 20.5.2.1 Verhaltens- und Vermögenspflichten
- 20.5.2.2 Durchgriffshaftung
- 20.6 Erhaltung des Stammkapitals
- 20.6.1 Rückzahlungsverbot
- 20.6.2 Insolvenzantragspflicht
- 20.7 Auflösung und Liquidation der GmbH
- 20.8 Die GmbH & Co. KG
- 20.8.1 Gründe für eine GmbH & Co. KG
- 20.8.2 Entstehung der GmbH & Co. KG
- 20.8.3 Innenverhältnis
- 20.8.4 Außenverhältnis
- 20.8.4.1 Vertretung
- 20.8.4.2 Haftung für Gesellschaftsschulden
- 20.8.5 Beendigung
- 499–520 21 Die Aktiengesellschaft 499–520
- 21.1 Bedeutung, Begriff und Wesensmerkmale, Rechtsquellen
- 21.2 Die Finanzverfassung der AG
- 21.2.1 Das Grundkapital
- 21.2.1.1 Begriff
- 21.2.1.2 Der Grundsatz der Kapitalerhaltung
- 21.2.1.3 Kapitalerhöhung und -herabsetzung
- 21.2.2 Die Aktie
- 21.2.2.1 Bruchteil des Grundkapitals
- 21.2.2.2 Mitgliedschaftsrecht
- 21.2.2.3 Wertpapier
- 21.3 Gründung und Beendigung der AG
- 21.3.1 Gründung
- 21.3.1.1 Einfache Gründung
- 21.3.1.2 Qualifizierte Gründung (§§ 26, 27 AktG)
- 21.3.1.3 Beendigung
- 21.4 Die Organisationsverfassung der AG
- 21.4.1 Vorstand
- 21.4.1.1 Zusammensetzung und Bestellung
- 21.4.1.2 Anstellungsvertrag
- 21.4.1.3 Aufgaben
- 21.4.1.4 Haftung
- 21.4.2 Aufsichtsrat
- 21.4.2.1 Zusammensetzung
- 21.4.2.2 Wahl, Bestellung und Abberufung der Mitglieder
- 21.4.2.3 Aufgaben
- 21.4.3 Hauptversammlung
- 21.4.3.1 Rechte der Hauptversammlung
- 21.4.3.2 Einberufung
- 24.4.3.3 Teilnahmeberechtigung, Auskunftspflicht und Stimmrecht des Aktionärs
- 21.4.3.4 Beschlüsse
- 21.5 Die KGaA
- 21.6 Die Europäische (Aktien-)Gesellschaft (SE)
- 21.6.1 Gründung
- 21.6.2 Organisationsverfassung
- 521–534 Sachverzeichnis 521–534
- 535–535 Impressum 535–535