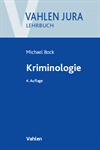Kriminologie
Für Studium und Praxis
Zusammenfassung
Vorteile
- Mit zahlreichen Übersichten, Tabellen, Formulierungsbeispielen und Hinweisen
- Zur Einführung wie auch zur Prüfungsvorbereitung geeignet
- Hohe Praxisrelevanz durch die völlig neue didaktische Konzeption der Angewandten Kriminologie
Zum Werk
Dieser Band ermöglicht dem Benutzer einen selbständig-kritischen Blick auf die Kriminologie als Wissenschaft. Die heterogenen Materien des Fachs werden in einen einheitlichen Verständnishorizont gestellt, aus dem sich die verschiedensten Fragestellungen, Themen und Befunde einordnen, vertiefen und lernen lassen. Der Band dient damit
- als Einführung
- der Prüfungsvorbereitung
- als Arbeitsbuch für Studierende und Praktiker
Zur Neuauflage
In der 4. Auflage wurden sämtliche Teile des Werkes teilweise erheblich verändert und aktualisiert. Dabei wurde die inhaltliche Schwerpunktsetzung bei der Angewandten Kriminologie beibehalten, jedoch aufgrund weiterer eigener Forschungs- Praxiserfahrung konzeptionell vertieft, modernisiert und ergänzt. Neu sind hierbei insbesondere die Verlaufsform einer Kriminalität in Krisen sowie die Berücksichtigung der Besonderheiten bei der Kriminalprognose persönlichkeitsgestörter Straftäter.
Gegenüber der Vorauflage aufgewertet, stärker mit der Angewandten Kriminologie verzahnt und inhaltlich umgestaltet wurden die Einwirkungsmöglichkeiten (jetzt Teil 4) mit einer sachlich begründeten Auswahl von grundlegenden Konzepten, bekannten Maßnahmen und beispielhaften Projekten, in denen sich eine zeitgemäße Haltung im Umgang mit straffälligen Menschen konkretisiert. Der Band kommt damit noch verstärkt dem Bedürfnis nach professioneller Orientierung bei Praktikern und Studierenden entgegen.
Autor
Prof. Dr. Dr. Michael Bock ist Inhaber des Lehrstuhls Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugsrecht und Strafrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und u.a. Herausgeber des großen Lehrbuchs von Göppinger zur Kriminologie.
Zielgruppe
Studierende der Rechtswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Polizeiwissenschaft sowie für alle Praktiker der Strafrechtspflege und Jugendhilfe.
- I–XX Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XX
- 1–37 1. Teil. Grundlagen und Methoden 1–37
- 1–17 § 1. Grundlagen 1–17
- I. Kriminologie und Prävention
- 1. Allgemeines zu den Straftheorien
- 2. Die Entwicklung der Straftheorien in der Neuzeit
- II. Die Bedeutung des Positivismus für die Kriminologie
- 1. Magische, ethische und rationalistische Vorstellungen
- 2. Der Positivismus als wissenschaftliches Programm und weltanschauliche Bewegung
- 3. Folgerungen für die Geschichte der Kriminologie
- 4. Das Beispiel von E. Durkheims Methodenlehre
- 5. Der Durchbruch der US-amerikanischen Kriminologie
- 6. Kritische Stellungnahme
- III. Die Entwicklung in Deutschland
- 1. Franz v. Liszt und die Gesamte Strafrechtswissenschaft
- 2. Vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus
- 3. Die weitere Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland
- IV. Gegenstand, Themen und Bezugswissenschaften
- 1. Natürlicher, juristischer und soziologischer Verbrechensbegriff
- 2. Kriminologische Topographie
- 17–37 § 2. Methoden 17–37
- I. Funktion und Bedeutung von Methoden
- II. Methodologische Vorfragen
- 1. Zur Genese wissenschaftlicher Fragestellungen
- 2. Gesetzes- und Wirklichkeitswissenschaft
- 3. Qualitative Sozialforschung
- 4. Quantitative Sozialforschung
- 5. Folgerungen für die Kriminologie
- III. Erhebungstechniken
- IV. Auswertung
- 1. Verfahren der qualitativen Sozialforschung
- 2. Verfahren der quantitativen Sozialforschung
- V. Werturteilsfreiheit
- 37–116 2. Teil. Theorien und Forschungsansätze 37–116
- 37–72 § 3. Klassische Kriminalitätstheorien 37–72
- I. Funktion und Bedeutung von Theorien
- II. Biosoziale Befunde und Modelle
- 1. Einführung
- 2. Vererbung
- 3. Verbreitete Auffälligkeiten in der frühkindlichen Entwicklung
- 4. Neurophysiologische und -psychologische Befunde
- 5. Biosoziale Modelle
- III. Psychoanalytische Ansätze
- 1. Grundannahmen der Psychoanalyse
- 2. Der Straftäter als Individuum
- 3. Die Psychologie der strafenden Gesellschaft
- IV. Bindungs- und Kontrolltheorien
- 1. Die (ursprüngliche) Theorie der vier Bindungen
- 2. Die Theorie der low self-control
- 3. Die Theorie der Kontrollbalance von Charles Tittle
- V. Lerntheorien
- 1. Die Lerntheorien Eysencks und Skinners
- 2. Die sozial-kognitive Lerntheorie Albert Banduras
- 3. Sutherlands Theorie der differentiellen Kontakte
- 4. Die soziale Lerntheorie von Akers
- 5. Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung
- VI. Kulturkonflikt und Subkultur
- 1. Die Theorie des Kulturkonflikts (Thorsten Sellin)
- 2. Subkulturtheorien
- 3. Das Konzept der Neutralisierungstechniken
- VII. Sozialstruktur
- 1. Die Anomietheorie Durkheims
- 2. Die Anomietheorie Mertons
- 3. Theorie der differentiellen Gelegenheit
- 4. Die allgemeine Drucktheorie von Agnew
- 5. Heitmeyers Desintegrationstheorie
- VIII. Etikettierungsansätze
- 1. Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit
- 2. Die soziale Konstruktion der Identität
- 3. Kritik an Strafrechtspflege und Kriminologie
- 4. Zum Erklärungspatt zwischen „Ätiologie“ und „Labeling“
- 5. Die Fehlrezeption des labeling-approach in der deutschen Kriminologie
- IX. Der rational-choice-Ansatz
- 1. Annahmen
- 2. Kriminalitätsprävention aus Sicht des rational-choice-Ansatzes
- X. Leistungen und Grenzen klassischer Kriminalitätstheorien
- 1. Begrenzte empirische Geltung
- 2. Zeitlose Bedeutung
- 72–81 § 4. Übergreifende Theorien 72–81
- I. Die Theorie des reintegrative shaming von Braithwaite
- II. Die konstruktivistische Kriminalitätstheorie von Scheerer und Hess
- III. Dual-Process-Theorien von Esser/Kroneberg und Wikström
- 1. Von der intentionalen zur erfahrungsbasierten Rationalität
- 2. Das Modell der Frame Selektion (MFS)
- 3. Das Modell der situativen Handlungswahl (situational action theory – SAT) von Wikström
- IV. Kritische Stellungnahme
- 81–101 § 5. Die entwicklungskriminologische Wende 81–101
- I. Verlaufsmuster von Kriminalität: Kohorten- und Langzeitstudien
- II. Neuere entwicklungsdynamische Theorien
- 1. Die Alterstheorie von Greenberg
- 2. Die Wechselwirkungstheorie von Thornberry
- 3. Die Theorie der altersabhängigen informellen Sozialkontrolle von Sampson und Laub
- III. Empirische Studien zum entwicklungsdynamischen Ansatz
- 1. Sampson und Laub
- 2. Stelly und Thomas
- 3. Farrington u. a.
- 4. Moffitt und ihre duale Tätertaxonomie
- 5. Die Berliner CRIME-Studie
- 6. Die Duisburger Verlaufsstudie
- 101–116 § 6. Der Täter in seinen sozialen Bezügen 101–116
- I. Menschenbild und Wissenschaftskonzeption
- II. Die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung als Grundlage der Angewandten Kriminologie
- 1. Konzeption
- 2. Aktualität
- III. Die Instrumente für die Analyse des Einzelfalls
- 1. Synopse idealtypischer Verhaltensweisen
- 2. Kriminorelevante Kriterien und Konstellationen
- 3. Idealtypen der Stellung der Tat im Lebenslängsschnitt
- 4. Zur Bedeutung der Relevanzbezüge und Wertorientierung
- IV. Die fallbezogene Integration von Einzelbefunden
- 116–266 3. Teil. Angewandte Kriminologie 116–266
- 116–137 § 7. Standortbestimmung 116–137
- I. Rechtliche Anforderungen an Kriminalprognosen
- 1. Individualität
- 2. Aktualität
- 3. Vollständigkeit und Richtigkeit der Sachverhaltsermittlung
- 4. Interventionsplanung
- 5. Das Elend der Praxis
- II. Empirische Anforderungen an Kriminalprognosen
- 1. Zum Problem der Verhaltensvorhersage
- 2. Zur Güteeinschätzung
- 3. Das Problem der false alarms bei der Kriminalprognose
- 4. Die Basisratenproblematik
- III. Die Prognosemethoden auf dem Prüfstand
- 1. Die statistische Prognose und ihre Probleme
- 2. Die intuitive Prognose und ihre Probleme
- 3. Die klinische Prognose und ihre Probleme
- 4. Die Methode der idealtypisch-vergleichenden Einzelfallanalyse (MIVEA)
- IV. Übersicht zum Vorgehen bei der MIVEA-Fallbearbeitung
- V. Anwendungsfelder der Angewandten Kriminologie
- 137–166 § 8. Die Erhebungen 137–166
- I. Das Vorgehen bei den Erhebungen
- II. Informationsquellen
- 1. Allgemeine Gesichtspunkte
- 2. Das Gespräch mit dem Probanden
- 3. Aktenauswertung
- 4. Drittbefragungen
- III. Allgemeine Gesichtspunkte zu den geordneten Erhebungen
- IV. Das allgemeine Sozialverhalten des Probanden
- 1. Kindheit und Erziehung (Elternfamilie)
- 2. Aufenthaltsbereich
- 3. Leistungsbereich
- 4. Freizeitbereich
- 5. Kontaktbereich
- 6. Suchtverhalten
- 7. Anhang: Zur Krankheitsanamnese/Handicaps
- V. Delinquenzbereich
- VI. Zur Lebensorientierung
- 1. Zeitperspektive
- 2. Relevanzbezüge/Wertorientierung
- VII. Die Darstellung der geordneten Erhebungen
- 166–197 § 9. Analyse der Erhebungen 166–197
- I. Zum Vorgehen bei der Analyse
- II. Analyse des Lebenslängsschnitts
- 1. Das allgemeine Sozialverhalten
- 2. Delinquenzbereich
- III. Analyse des Lebensquerschnitts
- 1. Bestimmung des Querschnittintervalls und die kriminorelevanten Kriterien
- 2. Erläuterungen zu den K- und R-Kriterien
- IV. Zur Erfassung der Relevanzbezüge und der Wertorientierung
- 1. Relevanzbezüge
- 2. Wertorientierung
- 197–223 § 10. Kriminologische Diagnose 197–223
- I. Zum Vorgehen bei der kriminologischen Beurteilung
- II. Die Bezugskriterien der Kriminologischen Diagnose
- 1. Stellung der Tat im Lebenslängsschnitt
- 2. Kriminorelevante Konstellationen
- 3. Relevanzbezüge und Wertorientierung
- III. Die Delinquenz im Leben des „Täters in seinen sozialen Bezügen“
- 1. Die kontinuierliche Hinentwicklung zur Kriminalität mit frühem Beginn
- 2. Die kontinuierliche Hinentwicklung zur Kriminalität mit spätem Beginn
- 3. Die Kriminalität im Rahmen der Persönlichkeitsreifung
- 4. Die Kriminalität in Krisen
- 5. Die Kriminalität aus sozialer Unauffälligkeit
- 6. Der kriminelle Übersprung
- IV. „Besondere Aspekte“ im Leben des Täters, vor allem im Hinblick auf Prognose und Einwirkungen
- 223–232 § 11. Folgerungen 223–232
- I. Zur Prognose
- 1. Grundsätzliche Prognose
- 2. Individuelle Basisprognose
- 3. Interventionsprognose
- II. Interventionsaspekte
- 232–241 § 12. Besonderheiten bei längerer Inhaftierung 232–241
- I. Erhebungen zum Verhalten in der Haftanstalt
- II. Analyse des Haftverhaltens
- 1. Leistungsbereich
- 2. Freizeitbereich
- 3. Kontaktbereich
- 4. Aufenthalts- und Wohnbereich
- 5. Kritische Stellungnahme zur Bedeutung des Verhaltens in der Haft
- 241–256 § 13. Besonderheiten bei ausgewählten Tätergruppen 241–256
- I. Personen mit anderem kulturellem Hintergrund
- II. Besonderheiten bei Straftäterinnen
- 1. Formen der kontinuierlichen Hinentwicklung zur Kriminalität
- 2. Formen der Kriminalität aus sozialer Unauffälligkeit
- III. Besonderheiten bei Gewalttätern
- 1. Formen der Hinentwicklung zur (Gewalt-)Kriminalität
- 2. Gewaltkriminalität im Rahmen der Persönlichkeitsreifung
- 3. Gewaltkriminalität aus sozialer Unauffälligkeit oder als krimineller Übersprung
- IV. Besonderheiten bei Sexualstraftätern
- V. Besonderheiten bei Persönlichkeitsstörungen
- 1. Allgemeines zu Persönlichkeitsstörungen
- 2. Verbreitete Fehlvorstellungen
- 3. Zur kriminalprognostischen Relevanz von Persönlichkeitsstörungen
- 4. Allgemeine Aspekte der Kriminorelevanz von Persönlichkeitsstörungen
- 5. Zur Sonderstellung der antisozialen (dissozialen) Persönlichkeitsstörung und der Psychopathie
- 6. Kritische Stellungnahme
- 256–266 § 14. Zur Früherkennung krimineller Gefährdung 256–266
- I. Einführung
- II. Die Syndrome im Einzelnen
- 1. Sozioscolares Syndrom
- 2. Syndrom mangelnder beruflicher Angepasstheit (Leistungs-Syndrom)
- 3. Freizeit-Syndrom
- 4. Kontakt-Syndrom
- 5. Syndrom familiärer Belastungen
- III. Früherkennung bei sozialer Unauffälligkeit (School-Shooting)
- 266–292 4. Teil. Einwirkungsmöglichkeiten 266–292
- 266–273 § 15. Einführende Bemerkungen 266–273
- I. Grenzen der auf den einzelnen Straffälligen ausgerichteten Perspektive
- II. Verantwortung oder Verweigerung
- III. Zur Bedeutung der inneren Haltung
- IV. Zum Verhältnis von Diagnostik und Behandlung
- 273–277 § 16. Grundlegende Konzepte zum Umgang (auch) mit Straffälligen 273–277
- I. Respekt als Antwort und Prinzip (RAP)
- II. Das Konzept der positive peer culture
- III. Konfrontative Pädagogik
- 277–285 § 17. Einzelne Maßnahmen 277–285
- I. Soziales Training
- II. Anti-Aggressivitäts-Training (AAT)
- III. Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
- IV. Erlebnispädagogik und Sport
- V. Wohngruppenvollzug
- 285–292 § 18. Projekte aus der Praxis 285–292
- I. Der Rüsselsheimer Versuch
- II. Das Jugendhilfezentrum „Raphaelshaus“ in Dormagen
- III. Das Wohngruppenkonzept „KonTrakt“
- IV. Das Wiesbadener Partizipationsprojekt „Knast trotz Jugendhilfe?“
- 292–323 5. Teil. Kriminalität und Kriminalitätskontrolle 292–323
- 292–316 § 19. Reaktionen auf Kriminalität 292–316
- I. Vorklärungen
- 1. Kriminologie ohne Täter
- 2. Soziale Kontrolle und Verbrechenskontrolle
- 3. Die Kriminalstatistiken
- 4. Das Trichtermodell der Strafrechtspflege
- II. Dunkelfeldforschung
- 1. Themen und theoretischer Kontext
- 2. Methodische Probleme
- 3. Befunde
- III. Instanzenforschung
- 1. Theoretische Annahmen
- 2. Frühe programmatische Untersuchungen
- 3. Zur weiteren Entwicklung
- 4. Kritische Stellungnahme
- IV. Sanktionsforschung
- 1. Straftheoretischer Hintergrund
- 2. Klassische Untersuchungen
- 3. Untersuchungen mit Bezug zur Generalprävention
- 4. Kritische Stellungnahme
- V. Das Wiesbadener Verlaufsprojekt
- 1. Design und Methode
- 2. Besonderheiten im Verhältnis zur sonstigen Sanktionsforschung
- VI. Präventionsansätze
- 1. Der Wandel des Präventionsbegriffes
- 2. Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
- 3. Gründe für den Wandel des Präventionsbegriffes
- 4. Kritische Stellungnahme
- VII. Evidenzbasierte Kriminalpolitik
- 1. Zielsetzung
- 2. Methoden und Standards von Evaluation
- 3. Kritische Stellungnahme
- 316–323 § 20. Opferorientierte Konzepte und Forschungsrichtungen 316–323
- I. Kriminalpolitische Bezüge
- II. Begriff und Gegenstand der Viktimologie
- III. Theoretische Konzepte
- 1. Das Lebensstilkonzept
- 2. Der routine activity approach
- 3. Konzepte von Opferkarrieren
- IV. Opferbefragungen
- V. Forschungen zu Folgen des Opferwerdens
- VI. Kritische Stellungnahme
- 323–370 6. Teil. Forschungen zu Täter- und Deliktsgruppen 323–370
- 323–326 § 21. Vorklärungen zum Aussagegehalt 323–326
- I. Grenzen formaler Klassifizierungen
- II. Zwangslagen von empirischer Analyse und theoretischer Interpretation
- III. Weltanschauliche und ideologische Verstrickungen
- 326–329 § 22. Kriminalität im Zusammenhang mit Reifungsprozessen 326–329
- I. Die These von der Normalität der Jugendkriminalität
- II. Erklärungsversuche
- III. Gründe für die Zunahme
- 329–335 § 23. Kriminalität von Personen mit anderem kulturellem Hintergrund 329–335
- I. Vorklärungen
- II. Kriminalität der Aussiedler
- III. Kriminalität der Nichtdeutschen
- IV. Erklärungsversuche
- 335–341 § 24. Kriminalität aus hohem Status und Machtpositionen 335–341
- I. Kriminologischer Hintergrund
- II. Wirtschaftskriminalität als Beispiel
- III. Sozial- und Persönlichkeitsprofil der Täter
- IV. Das Leipziger Verlaufsmodell wirtschaftskriminellen Handelns
- V. Grenzen der Normgeltung
- 341–349 § 25. Rauschdrogen und Kriminalität 341–349
- I. Terminologische Vorklärungen
- II. Arten und Wirkungsweisen
- III. Illegale Rauschdrogen und Kriminalität
- 1. Systematik
- 2. Verlaufsaspekte
- 3. Umfang
- IV. Zur kriminologischen Bedeutung des Alkohols
- V. Neuere Entwicklungen
- 349–363 § 26. Gewaltkriminalität 349–363
- I. Begriffliche Vorklärungen
- II. Historischer und kriminalpolitischer Kontext
- III. Fremdenfeindliche Gewalt
- IV. Häusliche Gewalt
- 1. Erscheinungsformen
- 2. Zur geschlechtsspezifischen Verteilung
- 3. Eigendynamiken und Immunisierungsprozesse
- V. Gewalt in der Schule
- VI. Erklärungsversuche
- VII. Neuere Entwicklungen
- 363–370 § 27. Sexualkriminalität 363–370
- I. Begriff und Umfang der Sexualkriminalität
- II. Aggressive Sexualdelikte
- III. Sexueller Missbrauch
- V. Exhibitionismus
- V. Neuere Entwicklungen
- 370–375 Kriminologische Standardbibliothek 370–375
- 375–386 Sachverzeichnis 375–386
- 386–386 Impressum 386–386