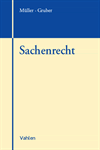Sachenrecht
Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
Dieses Lehrbuch richtet sich an Studenten und Referendare, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung mit dem Sachenrecht beschäftigen – sei es als Teilnehmer an einer einführenden Vorlesung in das Sachenrecht, sei es in der Phase der Examensvorbereitung. Es enthält eine Gesamtdarstellung des Sachenrechts, konzentriert sich dabei aber besonders auf die examensrelevanten Bereiche.
Zudem ist es auch für diejenigen gedacht, die in der Praxis – als Richter oder Rechtsanwälte – mit sachenrechtlichen Fragestellungen zu tun haben. Daher erfolgen an geeigneter Stelle Hinweise auf prozessuale Zusammenhänge.
Der Herausgeber
Prof. Dr. Urs Peter Gruber ist Inhaber eines Lehrstuhls für Zivilrecht und Zivilprozessrecht an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz. Begründet wurde das Werk von Prof. Dr. Klaus Müller, ebenfalls Johannes-Gutenberg Universität Mainz.
- I–XLIX Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XLIX
- 1–261 1. Teil. Grundsätze; allgemeine Vorschriften 1–261
- 1–19 1. Kapitel. Grundlegung des Sachenrechts 1–19
- § 1 Regelungsinhalt des Sachenrechts
- I. Zuordnung von Sachen im Wege der Einräumung von Herrschaftsrechten
- II. Eigentum
- III. Beschränkte dingliche Rechte
- IV. Begrenzte Zahl der dinglichen Rechte (numerus clausus)
- V. Absolutheit der dinglichen Rechte
- VI. Der Besitz als tatsächliche Herrschaft über eine Sache
- § 2 Die Sache als Gegenstand des Sachenrechts
- I. Begriff der Sache; Tiere
- II. Der Sachbestandteil als Objekt eines dinglichen Herrschaftsrechts
- III. Sache und Sachbestandteil als Objekt des Besitzes
- § 3 Unterteilung nach beweglichen und unbeweglichen Sachen
- I. Begriffliche Umschreibung
- II. Getrennte Regeln für Verfügungsgeschäfte
- III. Verschiedenartigkeit der beschränkten dinglichen Rechte
- § 4 Regelungsfragen des Sachenrechts
- I. Welche dinglichen Rechtspositionen gibt es?
- II. Welchen Inhalt hat die jeweilige dingliche Rechtsposition?
- III. Wie kann die dingliche Rechtsposition im Rechtsleben geltend gemacht und durchgesetzt werden?
- IV. Unter welchen tatbestandlichen Voraussetzungen entsteht, erlischt oder verändert sich die Rechtsposition?
- V. Welche Rangordnung besteht unter mehreren dinglichen Rechtspositionen an der gleichen Sache?
- § 5 Regelungsprinzipien der deutschen Sachenrechtsordnung
- I. Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
- II. Publizitätsprinzip
- III. Trennungs- und Abstraktionsprinzip
- IV. Spezialitätsprinzip
- V. Typenbegrenzung und Typenfixierung
- § 6 Verhältnis zwischen privatem Sachenrecht und öffentlichem Recht
- 20–41 2. Kapitel. Das Eigentum 20–41
- § 7 Die institutionelle Bedeutung des Eigentums im Rechtssystem
- § 8 Das Eigentum als Gegenstand des Art. 14 GG
- I. Bedeutung des Eigentums im Grundrechtssystem des GG
- II. Institutsgarantie
- III. Individualgarantie
- § 9 Das Eigentum als grundsätzliches Herrschaftsrecht über die Sache
- I. Überblick
- II. Befugnisse des Eigentümers
- III. Ansprüche aus Eigentum
- § 10 Privatrechtliche Eigentumsbeschränkungen
- I. Überblick
- II. Schikaneverbot (§ 226) und Redlichkeitsgebot
- III. Notwehr (§ 227)
- IV. Notstand
- V. Selbsthilfe (§ 229)
- VI. Nachbarrechtliche Duldungspflichten
- 42–104 3. Kapitel. Der Besitz 42–104
- § 11 Erscheinungsformen und Funktion des Besitzes im Sachenrecht
- I. Erscheinungsformen des Besitzes
- II. Überblick über die wichtigsten Funktionen des Besitzes
- § 12 Der Tatbestand des unmittelbaren Besitzes
- I. Besitz als tatsächliche Herrschaft über eine Sache
- II. Bestimmung der tatsächlichen Herrschaft über die Sache durch die Verkehrsauffassung
- III. Erkennbarkeit der Herrschaftsbeziehung als Merkmal des Besitzes
- IV. Räumliche Beziehung als Merkmal des Besitzes
- V. Zeitliches Moment der Herrschaftsbeziehung als Merkmal des Besitzes
- VI. Grundsätzliche Unbeachtlichkeit der Besitzberechtigung für den Tatbestand des Besitzes
- § 13 Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes
- I. Besitzerwerb nach § 854 Abs. 1
- II. Besitzerwerb nach § 854 Abs. 2
- § 14 Beendigung des unmittelbaren Besitzes
- § 15 Schutz des unmittelbaren Besitzes
- I. Überblick
- II. Besitzbeeinträchtigung
- III. Eigenmacht als Mittel der Besitzbeeinträchtigung
- IV. Ohne den Willen des Besitzers
- V. Gesetzliche Gestattung der Eigenmacht
- VI. Selbsthilferecht
- VII. Possessorischer Herausgabeanspruch
- VIII. Anspruch bei Besitzstörung
- IX. Besitzschutz aus § 1007 Abs. 1 und 2
- X. Deliktischer Schutz des Besitzes
- XI. Kondiktion des Besitzes
- § 16 Besitzdienerschaft
- I. Erscheinungsbild des Besitzdieners
- II. Tatbestand des § 855
- III. Wirkungen der Besitzdienerschaft
- § 17 Mittelbarer Besitz
- I. Regelungskonzeption
- II. Tatbestandsmerkmale des mittelbaren Besitzes
- III. Erwerb des mittelbaren Besitzes
- IV. Beendigung des mittelbaren Besitzes
- V. Mehrstufiger Besitz
- VI. Rechtliche Bedeutung des mittelbaren Besitzes
- § 18 Mitbesitz
- I. Überblick
- II. Formen des Mitbesitzes
- III. Wirkungen des Mitbesitzes
- § 19 Begriff des Eigenbesitzes
- I. Bedeutung des Begriffs
- II. Begriffsinhalt
- III. Erwerb des Eigenbesitzes
- IV. Beendigung des Eigenbesitzes
- § 20 Eigenbesitz an beweglichen Sachen als Anknüpfung der Eigentumsvermutung
- I. Vermutung für gegenwärtiges Eigentum
- II. Vermutung aus früherem Besitz
- § 21 Besitz der juristischen Person und der Gesellschaft
- I. Juristische Person
- II. Gesellschaft
- § 22 Besitz in der ehelichen Gemeinschaft und der eingetragenen Lebenspartnerschaft
- § 23 Der Besitz des Erben
- 105–124 4. Kapitel. Der Herausgabeanspruch aus Eigentum 105–124
- § 24 Voraussetzungen des § 985; Inhalt des Herausgabeanspruchs
- I. Überblick
- II. Eigentum
- III. Besitzer
- IV. Inhalt des Herausgabeanspruchs
- V. Verhältnis zu sonstigen Herausgabeansprüchen
- § 25 Besitzberechtigung als Einwendungstatbestand (§ 986)
- I. Regelungskonzeption
- II. Absolute Besitzrechte
- III. Besitzberechtigung aus einem Rechtsverhältnis zum Eigentümer
- IV. Besitzberechtigung aus einem Rechtsverhältnis mit einem Dritten
- V. Besitzberechtigung aus einem Rechtsverhältnis mit dem Rechtsvorgänger des Eigentümers
- § 26 Anwendbarkeit schuldrechtlicher Vorschriften auf den Herausgabeanspruch; Verjährung
- I. Maßstab der (entsprechenden) Anwendung
- II. Einwendungen und Einreden gegen den Herausgabeanspruch
- III. Anwendung der schuldrechtlichen Leistungsstörungsregeln
- § 27 Verhältnis von Herausgabeanspruch aus § 985 und Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO
- 125–216 5. Kapitel. Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 125–216
- § 28 Die Regelungskonzeption des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses
- I. Die Regelungsfrage
- II. Angemessenheit einer Sonderregelung
- III. Vindikationslage als Voraussetzung
- § 29 Die entscheidenden Regelungskriterien im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
- I. Gutgläubiger Besitzer
- II. Prozessbesitzer
- § 30 Herausgabe von Nutzungen
- I. Begriff der Nutzungen
- II. Begriff und Umfang der »Herausgabe« in den §§ 987 ff
- III. Herausgabepflicht des bösgläubigen Besitzers und des Prozessbesitzers
- IV. Die Herausgabepflicht des gutgläubigen und unverklagten Besitzers
- V. Konkurrierende Ansprüche
- § 31 Schadensersatz bei Untergang der Sache, Unmöglichkeit der Herausgabe und Verschlechterung
- I. Regelungskonzeption
- II. Die einzelnen Tatbestände der Beeinträchtigung der Vindikation
- III. Haftung des bösgläubigen Besitzers; Prozessbesitzers
- IV. Gutgläubiger und unverklagter Besitzer
- V. Deliktischer Besitzer (§ 992 iVm §§ 823 ff.)
- VI. Konkurrierende Ansprüche
- VII. Ergänzende Anwendung der schuldrechtlichen Leistungsstörungsregeln?
- § 32 Regelungskonzeption für den Ersatz von Verwendungen im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
- I. Regelungsinteressen
- II. Regelungskriterien
- III. Die von der Ersatzregelung erfassten Verwendungen
- § 33 Verwendungsersatz
- I. Verwendungsersatz des gutgläubigen und unverklagten Besitzers
- II. Bösgläubiger Besitzer und Prozessbesitzer
- § 34 Durchsetzung des Verwendungsersatzanspruchs
- I. Regelungskonzeption
- II. Klageweise Geltendmachung des Verwendungsersatzanspruchs
- III. Zurückbehaltungsrecht nach § 1000
- IV. Befriedigungsrecht des Besitzers nach § 1003
- V. Erlöschen des Verwendungsersatzanspruchs nach § 1002
- § 35 Verwendungsersatz bei Besitz- und Eigentumswechsel
- I. Besitzwechsel
- II. Verwendungsersatz bei Eigentümerwechsel
- § 36 Wegnahmerecht des Besitzers
- I. Regelungskonzeption
- II. Voraussetzungen
- III. Ausschluss des Wegnahme- und Aneignungsrechts
- IV. Inhalt des Wegnahme- und Aneignungsrechts
- V. Verhältnis zum Verwendungsersatzanspruch
- § 37 Verhältnis des Verwendungsersatzanspruchs zu anderen Ansprüchen
- I. Überblick
- II. Vertragliche Ansprüche
- III. Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag
- IV. Ansprüche aus Bereicherungsrecht
- 217–249 6. Kapitel. Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch des Eigentümers (insbesondere § 1004) 217–249
- § 38 Regelungskonzeption des § 1004
- § 39 Beeinträchtigung des Eigentums als Tatbestandsmerkmal des § 1004
- I. Regelungskonzeption
- II. Fallgestaltungen der Eigentumsbeeinträchtigung
- § 40 Gläubiger des Anspruchs
- § 41 Schuldner des Anspruchs
- I. Der Störer als Schuldner des Beseitigungsanspruchs
- II. Der Handlungsstörer
- III. Zustandsstörer
- § 42 Der Anspruch auf Beseitigung der Störung
- I. Eigentumsbeeinträchtigung als Gegenstand der Beseitigung
- II. Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1); faktische Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 2)
- III. Mitverursachung der Beeinträchtigung durch den Eigentümer
- IV. Verjährung
- V. Selbsthilfe des Eigentümers; Schadensersatz statt der Leistung
- § 43 Der Unterlassungsanspruch
- I. Regelungskonzeption
- II. Anspruchsvoraussetzung
- III. Inhalt des Anspruchs
- IV. Anspruchsverpflichteter
- V. Verjährung
- § 44 Ausschluss des Anspruchs infolge einer Duldungspflicht
- I. Überblick
- II. Vertragliche Duldungspflichten
- III. Beschränkt dingliche Rechte
- IV. Gesetzliche Duldungspflichten
- § 45 Schutz vor einem gefahrdrohenden Zustand des Nachbargrundstücks
- I. Überblick
- II. Schutz vor gefahrdrohenden Anlagen (§ 907)
- III. Schutz vor einsturzgefährdeten Gebäuden (§ 908)
- IV. Schutz vor gefährlichen Vertiefungen des Nachbargrundstücks (§ 909)
- § 46 Selbsthilferecht beim Überhang
- 250–261 7. Kapitel. Miteigentum 250–261
- § 47 Begriff und Entstehungsgründe des Miteigentums
- I. Bruchteilsgemeinschaft
- II. Entstehung von Miteigentum
- § 48 Verwaltungsberechtigung aus Miteigentum
- I. Begriff der Verwaltung
- II. Beteiligung der Miteigentümer an der Verwaltung
- § 49 Verfügung über den Miteigentumsanteil
- I. Unabdingbarkeit der Verfügungsmöglichkeit
- II. Übertragung des Anteils
- III. Bestellung von Sicherungsrechten
- IV. Verfügung über das ungeteilte Eigentum
- § 50 Beendigung des Miteigentums
- I. Gesetzliche Regelung
- II. Fälligkeit des Aufhebungsanspruchs; Einreden
- III. Aufhebungshindernisse
- IV. Abdingbarkeit der gesetzlichen Aufhebungsregelung
- 262–479 2. Teil. Mobiliarsachenrecht 262–479
- 262–350 8. Kapitel. Übereignung beweglicher Sachen 262–350
- § 51 Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen vom Berechtigten
- I. Überblick
- II. Die Einigung
- III. Übergabe bzw. Übergabesurrogate
- IV. Qualifikation des Veräußerers
- § 52 Gutgläubiger Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen vom Nichteigentümer
- I. Ersetzung des Eigentums durch den guten Glauben des Erwerbers
- II. Einzeltatbestände des gutgläubigen Erwerbs
- III. Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs bei abhanden gekommenen Sachen
- IV. Teleologische Reduktionen des Gutglaubenstatbestandes
- V. Der Rückerwerb der Sache durch den verfügenden Nichteigentümer
- § 53 Rechtliches Schicksal der beschränkten dinglichen Rechte
- § 54 Eigentumsvorbehalt
- I. Einführung
- II. Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts
- III. Übertragung und Belastung des Anwartschaftsrechts
- IV. Inhalt des Anwartschaftsrechts
- V. Wegfall und Veränderung des Anwartschaftsrechts
- VI. Erweiterter Eigentumsvorbehalt
- § 55 Sicherungsübereignung
- I. Grundstruktur und Zweck der Sicherungsübereignung
- II. Übereignungstatbestände im Einzelnen
- III. Inhalte der Sicherungsabrede im Einzelnen
- IV. Sittenwidrigkeit der Sicherungsübereignung
- V. Das Sicherungsgut in Zwangsvollstreckung und Insolvenz
- 351–404 9. Kapitel. Erwerb und Verlust von Eigentum außerhalb der Übereignung 351–404
- § 56 Ersitzung
- I. Regelungskonzeption
- II. Objekt der Ersitzung
- III. Zehnjähriger Eigenbesitz als Grundlage der Ersitzung
- IV. Gutgläubigkeit
- V. Eigentumserwerb; Kondizierbarkeit des Eigentumserwerbs
- VI. Lastenfreiheit des Eigentumserwerbs
- § 57 Verbindung; Vermischung; Verarbeitung
- I. Verbindung einer beweglichen Sachen mit einem Grundstück (§ 946)
- II. Verbindung mehrerer beweglicher Sachen (§ 947)
- III. Vermischung und Vermengung von beweglichen Sachen (§ 948)
- IV. Herstellung einer neuen Sache (§ 950)
- V. Eigentumserwerb durch den Stoffeigentümer
- VI. Bereicherungsausgleich bei einer dinglichen Rechtsänderung infolge Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung (§ 951 Abs. 1 S. 1 iVm §§ 812 ff.)
- VII. Sonstige Ansprüche und Wegnahmerechte aus Anlass eines Rechtsverlustes nach §§ 946 ff
- § 58 Dingliche Zuordnung von Schuldurkunden und Legitimationspapieren
- I. Regelungskonzeption des § 952
- II. Anwendungsbereich
- III. Regelungsinhalt
- § 59 Eigentumserwerb an von der Muttersache getrennten Bestandteilen
- I. Regelungskonzeption
- II. Grundsatz der Rechtskontinuität (§ 953)
- III. Eigentumserwerb kraft dinglichen Nutzungsrechts (§ 954)
- IV. Fruchterwerb des Eigenbesitzers (§ 955 Abs. 1)
- V. Fruchterwerb des unberechtigten Nutzungsbesitzers (§ 955 Abs. 2)
- VI. Eigentumserwerb kraft Aneignungsgestattung
- § 60 Eigentumsaufgabe
- I. Regelungskonzeption
- II. Aufgabeerklärung
- III. Besitzaufgabe
- IV. Rechtsfolge
- V. Dereliktionsverbote
- § 61 Aneignung beweglicher Sachen
- I. Regelungskonzeption
- II. Herrenlose Sachen
- III. Begründung des Eigenbesitzes
- IV. Fehlen eines Aneignungsverbots (§ 958 Abs. 2 Var. 1)
- V. Fehlen eines fremden Aneignungsrechts (§ 958 Abs. 2 Var. 2)
- VI. Rechtsfolgen der wirksamen Aneignung
- 405–420 10. Kapitel. Fundrecht 405–420
- § 62 Überblick
- § 63 Der Tatbestand des Fundes
- I. Eine verlorene Sache als Gegenstand des Fundes
- II. Ansichnehmen der Sache als Tatbestand des Findens
- § 64 Das gesetzliche Schuldverhältnis
- I. Die Parteien des gesetzlichen Schuldverhältnisses
- II. Der Inhalt des gesetzlichen Schuldverhältnisses
- § 65 Eigentumserwerb des Finders
- I. Regelungskonzeption
- II. Eigentumserwerb bei Unkenntnis des Empfangsberechtigten
- III. Eigentumserwerb bei Kenntnis des Empfangsberechtigten
- IV. Bereicherungsausgleich beim Eigentumserwerb durch den Finder
- § 66 Eigentumserwerb der Gemeinde
- I. Eigentumserwerb aufgrund eines Erwerbsverzichts des Finders
- II. Bereicherungsrechtlicher Ausgleich
- III. Eigentumserwerb der Gemeinde infolge Nichtabholung
- § 67 Verkehrsfund
- I. Überblick
- II. Der Fundort als Qualifikationsmerkmal des Verkehrsfundes
- III. Modifikationen der allgemeinen Regeln des Fundrechts
- IV. Rechtsstellung der Behörde oder Verkehrsanstalt
- V. Versteigerung
- VI. Gleichbehandlung öffentlich-rechtlicher Verwahrung mit dem Fund
- § 68 Schatzfund
- 421–431 11. Kapitel. Nießbrauch an beweglichen Sachen 421–431
- § 69 Begriff
- § 70 Begründung des Nießbrauchs
- I. Rechtsgeschäftliche Bestellung des Nießbrauchs
- II. Erwerb des Nießbrauchs durch Ersitzung
- § 71 Gegenstand des Nießbrauchs
- I. Bewegliche Sache als Gegenstand des Nießbrauchs
- II. Miteigentumsanteil als Gegenstand des Nießbrauchs
- § 72 Berechtigter des Nießbrauchs
- § 73 Inhalt des Nießbrauchs
- I. Nutzungsrecht
- II. Besitzrecht
- III. Erwerb des Eigentums an Sachfrüchten
- IV. Abschluss von überlassungsverträgen
- § 74 Rechtsverhältnis zwischen Nießbraucher und Eigentümer
- I. Parteien des Rechtsverhältnisses
- II. Überlassungspflicht des Eigentümers
- III. Verwaltungspflicht des Nießbrauchers
- IV. Außergewöhnliche Unterhaltungsmaßnahmen
- V. Anzeigepflicht
- VI. Lastentragung
- VII. Haftung des Nießbrauchers
- VIII. Gefährdung der Rechte des Eigentümers durch den Nießbraucher
- § 75 Schutz des Nießbrauchs
- I. Dinglicher Rechtsschutz
- II. Deliktsrechtlicher Schutz
- III. Possessorischer Schutz des Nießbrauchers als Besitzer der Sache
- § 76 Übergang des Nießbrauchs
- § 77 Der Nießbrauch als Gegenstand der Zwangsvollstreckung und des Insolvenzverfahrens
- § 78 Ende des Nießbrauchs
- I. Tod des Nießbrauchers; Erlöschen der juristischen Person
- II. Aufhebung durch Rechtsgeschäft
- III. Zusammentreffen von Eigentum und Nießbrauch
- IV. Rückgabepflicht
- 432–479 12. Kapitel. Pfandrecht an beweglichen Sachen 432–479
- § 79 Begriff des Pfandrechts
- § 80 Objekte des Pfandrechts
- I. Bewegliche Sache
- II. Unwesentliche Bestandteile einer Sache
- III. Miteigentumsanteil
- IV. Sachgesamtheiten
- V. Anwartschaftsrecht
- § 81 Gesicherte Forderung
- I. Inhalt der gesicherten Forderung
- II. Akzessorietät
- III. Umfang der Sicherung
- § 82 Entstehung des Pfandrechts durch rechtsgeschäftliche Bestellung
- I. Überblick
- II. Einigung und Besitzverschaffung
- III. Qualifikation des Pfandrechtsbestellers
- § 83 Übergang des Pfandrechts bei Übertragung der Forderung
- I. Übergang bei Bestehen des Pfandrechts
- II. Gutgläubiger Zweiterwerb des Pfandrechts?
- § 84 Gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Pfandgläubiger und Verpfänder; Übergang
- I. Parteien des gesetzlichen Schuldverhältnisses
- II. Verwahrungspflicht des Pfandgläubigers
- III. Verwendungsersatzansprüche
- § 85 Der Schutz des Pfandrechts
- I. Entsprechende Anwendung der Vorschriften über das Eigentum (§ 1227)
- II. Das Pfandrecht als sonstiges Recht iSd § 823 Abs. 1
- § 86 Befriedigung der gesicherten Forderung durch den Drittverpfänder oder durch sonstige Dritte
- I. Befriedigungsrecht des Drittverpfänders
- II. Ablösungsrecht eines dinglich Berechtigten
- § 87 Drohender Verderb der Pfandsache
- I. Überblick
- II. Drohender Verderb oder drohende Wertminderung der Pfandsache
- III. Rückgabeanspruch des Verpfänders
- IV. Benachrichtigungspflicht des Pfandgläubigers
- V. Verwertungsrecht des Pfandgläubigers
- VI. Verwertungspflicht des Pfandgläubigers
- § 88 Gegenstand des Pfandrechts
- I. Wesentliche und unwesentliche Bestandteile
- II. Fortbestand des Pfandrechts nach Trennung des Bestandteils von der Hauptsache
- III. Zubehör der Pfandsache
- IV. Mittelbare Früchte der Pfandsache
- V. Ersatzanspruch bei Verlust oder Untergang der Pfandsache
- § 89 Befriedigung durch Pfandverkauf
- I. Regelungskonzeption
- II. Pfandreife
- III. Die Verwertung der Pfandsache auf dem Wege des Verkaufes
- § 90 Mehrheit von Pfandsachen
- I. Regelung vor Pfandreife
- II. Regelung nach Pfandreife
- § 91 Nutzungspfand
- I. Das Nutzungspfandrecht als rechtsgeschäftlich begründetes Nutzungsrecht
- II. Pflicht zu ordnungsmäßiger Wirtschaftsführung
- III. Verrechnung der Nutzungen
- § 92 Erlöschen des Pfandrechts
- I. Erlöschen der Forderung
- II. Rückgabe der Pfandsache
- III. Anspruch auf Pfandrückgabe
- IV. Rechtsgeschäftliche Aufhebung des Pfandrechts
- V. Zusammentreffen von Pfandrecht und Eigentum
- VI. Abtretung der Forderung unter Ausschluss des Pfandrechtsübergangs
- § 93 Entstehung des Pfandrechts kraft Gesetzes
- I. Entstehungsvoraussetzungen
- II. Entsprechende Anwendung der Vorschriften über das Vertragspfandrecht
- § 94 Pfändungspfandrecht
- I. Überblick
- II. Rechtswirkung der Pfändung
- III. Verwertung
- IV. Entsprechende Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften
- 480–806 3. Teil. Immobiliarsachenrecht 480–806
- 480–485 13. Kapitel. Begriff des Grundstücks 480–485
- § 95 Die Bestimmung des Grundstücks durch das Grundbuch
- I. Begriff des Grundstücks
- II. Vereinigung von Grundstücken
- III. Zuschreibung eines Grundstücks
- IV. Teilung des Grundstücks
- § 96 Regelung zur Grundstücksgrenze
- I. Grenzabmarkung
- II. Grenzeinrichtungen
- 486–508 14. Kapitel. Formelles Grundbuchrecht; Grundbuchberichtigung und Widerspruch 486–508
- § 97 Unterscheidung zwischen formellem und materiellem Grundbuchrecht
- § 98 Die Gestaltung und der Inhalt des Grundbuchs
- I. Zuständigkeit des Amtsgerichts
- II. Gestaltung des Grundbuchs
- III. Eintragungsfähige Rechtspositionen
- § 99 Das Eintragungsverfahren
- I. Regelungskonzeption
- II. Antragsgrundsatz
- III. Bewilligungsgrundsatz
- IV. Voreintragungsgrundsatz
- V. Nachweis der Eintragungsunterlagen
- VI. Keine materielle Prüfkompetenz; Legalitätsprinzip
- § 100 Grundbuchberichtigung; Widerspruch
- I. Anspruch auf Abgabe der zur Grundbuchberichtigung erforderlichen Eintragungsbewilligung (§ 894)
- II. Widerspruch
- 509–605 15. Kapitel. Materielles Grundstücksrecht 509–605
- § 101 Rechtsgeschäftliche Änderung der dinglichen Rechtslage
- I. Regelungskonzeption
- II. Die in § 873 Abs. 1 erfassten Rechtsgeschäfte
- III. Die in § 877 erfassten Rechtsgeschäfte
- IV. Die in § 880 erfasste Rangänderung
- § 102 Die Einigung als tatbestandliche Voraussetzung für die rechtsgeschäftliche Änderung der dinglichen Rechtslage
- I. Die Einigung als Vertrag
- II. Inhalt der Einigung
- III. Die Vertragspartner der Einigung
- IV. Form der Einigung
- V. Bindung an die Einigung
- § 103 Einseitige Erklärung statt Einigung
- I. Rechtliche Ausnahmetatbestände
- II. Maßgebliche Regeln für die einseitige Erklärung
- III. Aufhebung einer dinglichen Rechtsposition durch einseitige Aufgabeerklärung
- IV. Aufgabe des Eigentums durch einseitige Erklärung
- V. Bestellung von Eigentümerrechten durch einseitige Erklärung anstelle einer Einigung
- § 104 Die Grundbucheintragung als Voraussetzung für die rechtsgeschäftliche Änderung der dinglichen Rechtslage
- I. Die Grundbucheintragung als konstitutive Voraussetzung der Rechtsänderung
- II. Inhalt der Eintragung
- III. Inhaltliche Übereinstimmung von Einigung und Eintragung
- IV. Zeitpunkt
- V. Bestandskraft der Einigung vor der Grundbucheintragung
- § 105 Die Anwartschaft des Erwerbsanwärters
- I. Einführung
- II. Vorliegen eines Anwartschaftsrechts
- III. Übertragung und Verpfändung des Anwartschaftsrechts
- IV. Pfändung des Anwartschaftsrechts
- V. Deliktsrechtlicher Schutz des Anwartschaftsrechts
- § 106 Zustimmungsbedürftigkeit der Aufhebung oder Änderung einer dinglichen Rechtsposition
- I. Regelungskonzeption
- II. Rechte Dritter
- III. Umfang des Zustimmungserfordernisses
- IV. Zustimmung
- V. Folgen der fehlenden Zustimmung
- § 107 Die Vermutung der Richtigkeit des Grundbuchs
- I. Regelungskonzeption
- II. Die positive Vermutung für eingetragene Rechte
- § 108 Der öffentliche Glaube des Grundbuchs
- I. Regelungskonzeption
- II. Geschützte Erwerbsvorgänge (§ 892) und sonstige Verfügungen (§ 893 Var. 2)
- III. Gegenstand des öffentlichen Glaubens
- IV. Ausschluss des Schutzes bei Kenntnis der Unrichtigkeit und Widerspruch
- V. Wirkungen des öffentlichen Glaubens
- VI. Verhältnis zu den Gutglaubenstatbeständen des Erbscheins
- VII. Teleologische Reduktionen des Gutglaubenstatbestandes
- VIII. Der Rückerwerb der Sache durch den verfügenden Nichteigentümer
- IX. Leistungen aufgrund einer vermeintlichen dinglichen Rechtsposition (§ 893 Var. 1)
- § 109 Vormerkung
- I. Regelungskonzeption
- II. Der durch eine Vormerkung sicherungsfähige Anspruch
- III. Begründung der Vormerkung
- IV. Wirkung der Vormerkung
- V. Weiterübertragung der Vormerkung
- VI. Erlöschen der Vormerkung
- § 110 Vorkaufsrecht
- I. Regelungskonzeption
- II. Begründung des dinglichen Vorkaufsrechts
- III. Berechtigter
- IV. Übertragung
- V. Umfang des Vorkaufsrechts
- VI. Vorkaufsfall
- VII. Abwicklung des Vorkaufsrechts
- VIII. Erlöschen des Vorkaufsrechts
- IX. Mehrheit von Vorkaufsrechten
- § 111 Der Rang der Grundstücksrechte
- I. Funktion des Ranges
- II. Gesetzliche Rangbestimmung
- III. Rechtsgeschäftliche Abweichungen von der gesetzlichen Rangbestimmung
- § 112 Ersitzung von Grundstückseigentum und beschränkten dinglichen Rechtspositionen
- I. Buchersitzung von Eigentum
- II. Ersitzung beschränkter dinglicher Rechte
- III. Ersitzung des Eigentums gegen die Buchlage
- IV. Erlöschen von beschränkten dinglichen Rechten
- 606–628 16. Kapitel. Nutzungsrechte als beschränkte dingliche Rechte an Grundstücken 606–628
- § 113 Der Nießbrauch
- I. Regelungskonzeption
- II. Bestellung des Nießbrauchs
- III. Inhalt des Nießbrauchs
- IV. Nießbrauch am Inventar
- § 114 Die Grunddienstbarkeit
- I. Regelungskonzeption
- II. Inhalt der Grunddienstbarkeit
- III. Berechtigter der Grunddienstbarkeit
- IV. Begründung der Grunddienstbarkeit
- V. Grunddienstbarkeit als Grundlage eines gesetzlichen Schuldverhältnisses
- VI. Schutz der Grunddienstbarkeit
- VII. Erlöschen der Grunddienstbarkeit
- § 115 Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit
- I. Regelungskonzeption
- II. Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
- III. Berechtigter der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
- IV. Begründung und Inhaltsveränderung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
- V. Dienstbarkeit als Grundlage eines gesetzlichen Schuldverhältnisses
- VI. Schutz der Dienstbarkeit
- VII. Erlöschen der Dienstbarkeit
- § 116 Das Wohnrecht
- I. Regelungskonzeption
- II. Inhalt des Wohnrechts
- III. Berechtigter
- IV. Bestellung
- V. Besitzrecht
- VI. Entgelt
- VII. Erlöschen des Wohnrechts
- 629–629 17. Kapitel. Grundpfandrechte 629–629
- 630–633 1. Abschnitt. Übersicht 630–633
- § 117 Definition
- § 118 Das Grundpfandrecht als Verwertungsrecht
- § 119 Arten der Grundpfandrechte
- I. Grundschuld
- II. Hypothek
- III. Rentenschuld
- § 120 Differenzierung der Grundpfandrechte in Buch- und Briefrechte
- § 121 Gesetzessystematik
- 634–732 2. Abschnitt. Hypothek 634–732
- § 122 Rechtsgeschäftliche Bestellung der Hypothek
- I. Überblick
- II. Entstehungsvoraussetzungen im Einzelnen
- III. Belastung eines Miteigentumsanteils
- IV. Sicherungsvertrag als Kausalverhältnis
- § 123 Entstehung einer Hypothek kraft Gesetzes und kraft Zwangsvollstreckung
- I. Entstehung nach § 1287 S. 2
- II. Entstehung der Hypothek nach § 848 Abs. 2 S. 2 ZPO
- III. Entstehung der Hypothek durch Zwangsvollstreckungsakt
- § 124 Umfang der Haftung
- I. Haftung für Forderung, Zinsen und Nebenleistungen
- II. Erweiterung der Haftung auf gesetzliche Zinsen
- III. Erweiterung der Haftung für Kosten der Kündigung
- IV. Erweiterung der Haftung für Kosten der Rechtsverfolgung
- V. Nachträgliche Erweiterung der Hypothek
- § 125 Gegenstand der Haftung
- I. Überblick
- II. Das Grundstück als Gegenstand der Hypothekenhaftung
- III. Die Bestandteile des Grundstücks als Gegenstände der Hypothekenhaftung
- IV. Zubehör
- V. Vom Grundstück getrennte Erzeugnisse und sonstige Bestandteile
- VI. Miet- und Pachtforderungen
- VII. Wiederkehrende Leistungen
- VIII. Versicherungsforderungen
- § 126 Übertragung der Hypothek
- I. Überblick
- II. Erwerb vom Berechtigten
- III. Gutgläubiger Erwerb
- IV. Wirkungen der Abtretung
- § 127 Pfändung und Verpfändung der Hypothekenforderung
- I. Verpfändung
- II. Pfändung der Hypothek
- § 128 Die Bedeutung des Hypothekenbriefs bei der Geltendmachung der Hypothek und der durch die Hypothek gesicherten Forderung
- I. Die Geltendmachung der Hypothek als Grundpfandrecht
- II. Geltendmachung der persönlichen Forderung
- § 129 Aufgebot des Hypothekenbriefs
- § 130 Rechte aus der Hypothek vor ihrer Fälligkeit
- I. Regelungskonzeption
- II. Abwehranspruch bei drohender Verschlechterung des Grundstücks
- III. Gefährdung der Sicherheit durch eine eingetretene Verschlechterung des Grundstücks
- IV. Verschlechterung oder wirtschaftswidrige Entfernung von Zubehör
- V. Deliktsrechtliche Schadensersatzansprüche bei Verschlechterung des Grundstücks oder einer Zubehörsache
- § 131 Abwicklung der hypothekarisch gesicherten Forderung ohne Inanspruchnahme des hypothekarischen Verwertungsrechts
- I. Befriedigung der Forderung durch den Eigentümer, der gleichzeitig persönlicher Schuldner ist
- II. Befriedigung durch den Eigentümer, der nicht persönlicher Schuldner ist
- III. Befriedigung durch Dritte
- IV. Befriedigung der Forderung durch den ersatzberechtigten persönlichen Schuldner
- § 132 Inanspruchnahme des hypothekarischen Verwertungsrechts
- I. Überblick
- II. Eigentumsfiktion für den Bucheigentümer
- III. Pfandreife
- IV. Vollstreckungstitel
- V. Zwangsvollstreckung
- VI. Erlöschen der Hypothek
- VII. Unzulässige Befriedigungsabreden
- § 133 Aufhebung der Hypothek als Grundpfandrecht; Verzicht
- I. Aufhebung (§§ 875, 1183)
- II. Verzicht auf die Hypothek
- § 134 Auswechslung der Forderung
- § 135 Ausschluss des unbekannten Gläubigers im Aufgebotsverfahren
- I. Ausschluss des unbekannten Gläubigers (§ 1170)
- II. Ausschluss des unbekannten Gläubigers aus dem Gesichtspunkt der Hinterlegung (§ 1171)
- § 136 Sonderarten der Hypothek
- I. Die Sicherungshypothek
- II. Die Wertpapierhypothek
- III. Die Höchstbetragshypothek
- IV. Die Gesamthypothek
- 733–770 3. Abschnitt. Grundschuld 733–770
- § 137 Überblick
- I. Fehlende Akzessorietät
- II. Verknüpfung von Grundschuld und Forderung durch Sicherungsvertrag
- § 138 Rechtsgeschäftliche Bestellung der Grundschuld
- I. Entstehung der Grundschuld als Grundpfandrecht
- II. Briefgrundschuld
- III. Erwerb der Grundschuld durch den Grundschuldinhaber
- IV. Kausalverhältnis
- V. Gutgläubiger Erwerb
- § 139 Umfang der Haftung
- § 140 Gegenstand der Haftung
- I. Haftung des Grundstücks
- II. Weitere Gegenstände der Grundschuldhaftung
- § 141 Übertragung der Grundschuld
- I. Überblick
- II. Übertragung der Briefgrundschuld
- III. Übertragung einer Buchgrundschuld
- IV. Wirkung der Übertragung
- V. Gutgläubiger Erwerb
- § 142 Pfändung und Verpfändung der Grundschuld
- I. Verpfändung der Grundschuld
- II. Pfändung der Grundschuld
- § 143 Die Bedeutung des Grundschuldbriefs bei der Geltendmachung der Grundschuld
- § 144 Aufgebot des Grundschuldbriefs
- § 145 Rechte aus der Grundschuld vor der Pfandreife
- § 146 Ablösung der Grundschuld
- I. Ablösung der Grundschuld durch den Eigentümer
- II. Ablösung der Grundschuld durch Dritte
- III. Öffentlicher Glaube
- § 147 Verwertungsrecht
- I. Grundsatz
- II. Eigentumsfiktion
- III. Pfandreife
- IV. Einreden aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Grundschuldinhaber
- V. Vollstreckungstitel
- VI. Zwangsvollstreckung
- VII. Erlöschen der Grundschuld
- VIII. Unzulässige Befriedigungsabreden
- § 148 Aufhebung der Grundschuld
- § 149 Verzicht auf die Grundschuld
- § 150 Ausschluss des unbekannten Grundschuldinhabers im Aufgebotsverfahren
- § 151 Gesamtgrundschuld
- I. Begründung
- II. Übertragung der Gesamtgrundschuld
- III. Verwertungsrecht des Grundschuldinhabers
- IV. Verteilungsbefugnis des Grundschuldinhabers
- V. Gemeinsame Ablösung der Gesamtgrundschuld durch die Eigentümer sämtlicher belasteter Grundstücke
- VI. Ablösung der Gesamtgrundschuld durch den Eigentümer eines Grundstücks
- VII. Rechtsnatur der Gemeinschaft bei der Eigentümergesamtgrundschuld
- VIII. Aufhebung und Auseinandersetzung der Gemeinschaft
- IX. Verzicht auf die Gesamtgrundschuld
- X. Befriedigung des Grundschuldinhabers aus einem Grundstück
- § 152 Sicherungsgrundschuld
- I. Verknüpfung von Forderung und Grundschuld durch Sicherungsvertrag
- II. Der Sicherungsvertrag
- III. Übertragung der Sicherungsgrundschuld
- IV. Verwertung der Sicherungsgrundschuld
- V. Sicherungsgrundschuld in der Insolvenz
- VI. Pfändung und Verpfändung der Sicherungsgrundschuld
- § 153 Eigentümergrundschuld
- I. Entstehung der Eigentümergrundschuld
- II. Inhalt der Eigentümergrundschuld
- III. Verwertungsrecht aus der Eigentümergrundschuld
- IV. Übertragung und Pfändung der Eigentümergrundschuld
- V. Übereignung des Grundstücks
- VI. Löschungsanspruch nach § 1179a
- § 154 Die Rentenschuld
- 771–774 4. Abschnitt. Reallast 771–774
- § 155 Regelungskonzeption
- § 156 Inhalt der Reallast
- § 157 Reallast als Verwertungsrecht
- § 158 Persönliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers
- § 159 Berechtigter der Reallast
- § 160 Begründung der Reallast
- § 161 Übertragung der Reallast und der sich aus ihr ergebenden Einzelansprüche
- I. Subjektiv dingliche Reallast
- II. Subjektiv persönliche Reallast
- 775–786 18. Kapitel. Das Erbbaurecht 775–786
- § 162 Regelungskonzeption des Erbbaurechts
- I. Begriff des Erbbaurechts
- II. Erbbaugrundbuch
- § 163 Begründung
- § 164 Inhalt des Erbbaurechts
- I. Belastungsgegenstand des Erbbaurechts
- II. Haben eines Bauwerkes als wesentlicher Inhalt des Erbbaurechts
- III. Dauer des Erbbaurechts
- IV. Errichtung und Erhaltung des Bauwerks als Inhalt des Erbbaurechts
- V. Verwendung des Bauwerks als Inhalt des Erbbaurechts
- VI. Versicherung des Bauwerks als Inhalt des Erbbaurechts
- VII. Öffentliche und privatrechtliche Lasten und Abgaben als Inhalt des Erbbaurechts
- VIII. Heimfallrecht als Inhalt des Erbbaurechts
- IX. Vertragsstrafe als Inhalt des Erbbaurechts
- X. Vorrecht auf Erneuerung des Erbbaurechts als Inhalt des Erbbaurechts
- XI. Ankaufsrecht als Inhalt des Erbbaurechts
- XII. Zustimmungsbedürftigkeit der Veräußerung und Belastung des Erbbaurechts als Inhalt des Erbbaurechts
- XIII. Der Erbbauzins
- § 165 Schutz des Erbbaurechts
- § 166 Übertragung des Erbbaurechts
- § 167 Belastung des Erbbaurechts
- § 168 Erlöschen des Erbbaurechts
- I. Erlöschen durch Zeitablauf
- II. Rechtsgeschäftliche Aufhebung des Erbbaurechts
- III. Zwangsvollstreckung in das Grundstück
- 787–806 19. Kapitel. Das Wohnungseigentum 787–806
- § 169 Regelungskonzeption des Wohnungseigentums
- I. Das Wohnungseigentumsgesetz als Sonderrecht
- II. Der dogmatische Ausgangspunkt des Wohnungseigentums
- § 170 Begründung des Wohnungseigentums
- I. Regelungskonzeption
- II. Vertragliche Begründung von Wohnungseigentum (§ 3 WEG)
- III. Begründung von Wohnungseigentum durch eine einseitige Teilungserklärung des Alleineigentümers des Grundstücks (§ 8 WEG)
- § 171 Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums
- I. Maßgeblichkeit der Teilungserklärung für den Gegenstand des Sondereigentums
- II. Gegenstand und Umfang des Sondereigentums
- III. Inhalt des Sondereigentums
- § 172 Inhalt und Umfang des Miteigentums
- I. Gegenstand des Miteigentums
- II. Inhalt des Miteigentums
- § 173 Die Eigentümergemeinschaft
- I. Die Mitgliedschaft in der Eigentümergemeinschaft als notwendiger Bestandteil des Wohnungseigentums
- II. Bedeutung der Mitgliedschaft in der Wohnungseigentümergemeinschaft
- III. Bindung des Sondereigentums
- IV. Inanspruchnahme des Gemeinschaftseigentums
- V. Erträge aus dem Gemeinschaftsvermögen
- VI. Kosten der Verwaltung des Gemeinschaftseigentums
- VII. Verwaltung der Gemeinschaft
- § 174 Verwaltungsbeirat
- § 175 Übertragung des Wohnungseigentums
- § 176 Belastung des Wohnungseigentums
- § 177 Änderung des Wohnungseigentums
- § 178 Aufhebung des Wohnungseigentums
- § 179 Gerichtliches Verfahren
- 807–815 Paragraphenregister 807–815
- 816–847 Sachverzeichnis 816–847
- 848–848 Impressum 848–848