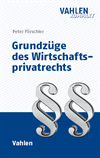Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts
Zusammenfassung
Dieses Buch vermittelt Studierenden der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften einen Überblick über alle Bereiche des Wirtschaftsprivatrechts. Grundlage sind die Regelungen des Bürgerlichen und des Handelsrechts zu allen Fragen des wirtschaftlichen Geschäftsverkehrs. Sie werden ergänzt durch spezifische Rechtsfragen der betrieblichen Funktionen Beschaffung, Finanzierung, Vertrieb und Unternehmensorganisation. Den Abschluss bilden prozessuale Fragen der Rechtsdurchsetzung. Dabei steht der Anwendungsbezug stets im Vordergrund, weshalb der gesamte Stoff durch praktische Beispiele verdeutlicht wird. Die Systematik rechtlicher Strukturen wird durch Grafiken optisch veranschaulicht. Über die Grundlagen hinausgehende Aspekte werden in Exkursen beleuchtet. Außerdem erleichtert das Buch mit Lernzielen, Übungen, Merksätzen und Kontrollfragen die Vorbereitung auf Rechtsprüfungen.
Aus dem Inhalt
Akteure des Wirtschaftslebens und ihre Rechtsgeschäfte, Vertragsgestaltung, Vertragsabwicklung und Komplikationen der Vertragserfüllung, unerlaubte Handlungen und Schadensersatz. Rechtsfragen der Beschaffung (Lieferantenbeziehungen, Kauf und Gewährleistung, UN-Kaufrecht, Handelskauf, Werkvertragsrecht, IPR), Rechtsfragen der Finanzierung (Darlehen, Leasing, Factoring, Sicherheiten), Rechtsfragen des Vertriebs (Kartellrecht, UWG-Lauterkeitsrecht, Vertriebsorgane, Direktvertrieb); Rechtsformen unternehmerischer Betätigung (Gesellschaftsrecht); Rechtsdurchsetzung (Forderungsmanagement, Mediation, Mahnverfahren, Zivilprozess).
Autor
Prof. Dr. Peter Förschler lehrt nach langjähriger Tätigkeit als Staatsanwalt und Richter seit 2001 als Professor für Wirtschaftsrecht und Corporate Compliance an der Hochschule Nürtingen-Geislingen sowie als Honorarprofessor an der Universität Hohenheim.
- I–XV Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XV
- 1–14 1. Rechtsordnung und Wirtschaftsprivatrecht 1–14
- 1.1 Die Rechtsordnung
- 1.1.1 Objektives und subjektives Recht mit seinen Rechtsquellen
- 1.1.1.1 Objektives Recht
- 1.1.1.2 Subjektives Recht
- 1.1.2 Privatrecht und öffentliches Recht
- 1.1.2.1 Privatrecht
- 1.1.2.2 Öffentliches Recht
- 1.2 Das Wirtschaftsprivatrecht und seine Rechtsquellen
- 1.2.1 Begriff des Wirtschaftsprivatrechts
- 1.2.1.1 Das Bürgerliche Recht
- 1.2.1.2 Das Handelsrecht
- 1.2.1.3 Das Gesellschaftsrecht
- 1.2.1.4 Das Wettbewerbsrecht
- 1.2.1.5 Wirtschaftsprivatrecht und Verfahrensrecht
- 1.3 Merksätze/Kontrollfragen
- 15–39 2. Personen und Gegenstände 15–39
- 2.1 Handelnde Personen und deren rechtliche Fähigkeiten: Rechtssubjekte
- 2.1.1 Natürliche Personen
- 2.1.1.1 Begriff
- 2.1.1.2 Rechtsfähigkeit des Menschen
- 2.1.1.3 Geschäftsfähigkeit des Menschen
- 2.1.1.4 Deliktsfähigkeit des Menschen
- 2.1.2 Juristische Personen
- 2.1.2.1 Rechtsformen und Zwecke
- 2.1.2.2 Charakteristika juristischer Personen
- 2.1.3 Personengesellschaften
- 2.1.4 Erscheinungsformen von Personen im Recht
- 2.1.4.1 Verbraucher und Unternehmer
- 2.1.4.2 Kaufleute
- 2.2 Gegenstände rechtlichen Handelns: Rechtsobjekte
- 2.2.1 Sachen
- 2.2.1.1 Bewegliche und unbewegliche Sachen
- 2.2.1.2 Einfache und wesentliche Bestandteile von Sachen
- 2.2.1.3 Zubehör und Nutzungen
- 2.2.2 Rechte
- 2.2.2.1 Relative und absolute Rechte
- 2.2.2.2 Sonstige subjektive Rechte
- 2.3 Merksätze/Kontrollfragen
- 40–67 3. Rechtsgeschäfte 40–67
- 3.1 Der Vertrag als Transaktionsgrundlage des Wirtschaftsrechts
- 3.2 Die Willenserklärung
- 3.2.1 Der Wille
- 3.2.2 Die Erklärung
- 3.2.3 Wirksamwerden von Willenserklärungen
- 3.2.3.1 Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen
- 3.2.3.2 Empfangsbedürftige Willenserklärungen
- 3.2.3.3 Bedingung und Befristung
- 3.2.4 Auslegung, bewusste und unbewusste Willensmängel
- 3.2.4.1 Auslegung von Willenserklärungen
- 3.2.4.2 Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Scherzerklärung
- 3.2.4.3 Irrtümer
- 3.2.4.4 Täuschung und Drohung
- 3.3 Der Vertrag
- 3.3.1 Die Vertragsanbahnung
- 3.3.1.1 Werbemaßnahmen (invitatio ad offenrendum)
- 3.3.1.2 Vertragsverhandlungen, Letter of Intent
- 3.3.1.3 Vorvertrag
- 3.3.1.4 Rahmenvertrag
- 3.3.2 Der Vertragsschluss
- 3.3.2.1 Der Vertragsantrag
- 3.3.2.2 Die Vertragsannahme
- 3.3.2.3 Das Zustandekommen des Vertrags
- 3.3.3 Der Vertragsschluss im Handelsverkehr
- 3.3.3.1 Schweigen im Handelsverkehr
- 3.3.3.2 Handelsbräuche, insbesondere das kaufmännische Bestätigungsschreiben
- 3.3.4 Der Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr
- 3.3.4.1 Zustandekommen des Vertrags
- 3.3.4.2 Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr
- 3.3.5 Rechtsfolgen des Vertrags
- 3.4 Merksätze/Kontrollfragen
- 68–89 4. Vertragsgestaltung 68–89
- 4.1 Vertragsfreiheit und ihre Grenzen
- 4.1.1 Die Abschlussfreiheit
- 4.1.1.1 Grundsatz
- 4.1.1.2 Grenzen: Abschlussverbote und Abschlusszwang
- 4.1.2 Die Formfreiheit
- 4.1.2.1 Grundsatz
- 4.1.2.2 Formtypen
- 4.1.2.3 Grenzen: Formzwang
- 4.1.2.4 Folgen von Formmängeln
- 4.1.3 Die Inhaltsfreiheit
- 4.1.3.1 Grundsatz
- 4.1.3.2 Grenzen: Zwingendes Recht, gute Sitten, gesetzliche Verbote
- 4.2 Vertragsgestaltung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 4.2.1 Wesen, Vor- und Nachteile Allgemeiner Geschäftsbedingungen
- 4.2.2 Formale Einbeziehung von AGB in Verträge
- 4.2.3 Inhaltskontrolle
- 4.2.3.1 Generalklausel und Klauselverbote
- 4.2.3.2 Überraschende Klauseln und Unklarheiten
- 4.2.4 Rechtsfolgen
- 4.2.5 Besonderheiten bei AGB im unternehmerischen Geschäftsverkehr
- 4.2.5.1 Einbeziehung von AGB gegenüber Unternehmern
- 4.2.5.2 Inhaltskontrolle bei Unternehmerkunden
- 4.2.5.3 Kollision von AGB zwischen Unternehmern
- 4.2.5.4 Handelsklauseln
- 4.3 Merksätze/Kontrollfragen
- 90–104 5. Stellvertretung 90–104
- 5.1 Wesen und Arten der Stellvertretung
- 5.2 Gesetzliche Vertretung
- 5.3 Gewillkürte Vertretung
- 5.3.1 Die Vertretungsmacht
- 5.3.1.1 Wesen der Vollmacht
- 5.3.1.2 Erteilung der Vollmacht
- 5.3.1.3 Erlöschen der Vollmacht
- 5.3.1.4 Rechtsscheinvollmachten
- 5.3.1.5 Der Vertreter ohne Vertretungsmacht
- 5.3.2 Der Offenlegungsgrundsatz
- 5.3.3 Handelsrechtliche Vollmachten
- 5.3.3.1 Die Prokura
- 5.3.3.2 Die Handlungsvollmacht
- 5.4 Merksätze/Kontrollfragen
- 105–118 6. Vertragsabwicklung 105–118
- 6.1 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte
- 6.2 Leistungspflichten
- 6.2.1 Hauptleistungspflichten
- 6.2.2 Nebenleistungspflichten
- 6.3 Art und Weise der Leistungserbringung
- 6.3.1 Leistung durch Schuldner oder Dritten
- 6.3.2 Leistung an Gläubiger oder Dritten
- 6.3.3 Leistung im richtigen Umfang
- 6.3.4 Leistung am richtigen Ort
- 6.3.5 Rechtzeitige Leistung
- 6.4 Leistungsverweigerungsrechte
- 6.5 Varianten und Folgen der Vertragserfüllung
- 6.6 Merksätze/Kontrollfragen
- 119–142 7. Sachenrecht 119–142
- 7.1 Eigentum und Besitz
- 7.1.1 Das Eigentum
- 7.1.2 Der Besitz
- 7.1.3 Der Eigentumserwerb
- 7.1.3.1 Rechtsgeschäftlicher Erwerb bewegliche Sachen
- 7.1.3.2 Rechtsgeschäftlicher Grundstückserwerb
- 7.1.3.3 Gutgläubiger rechtgeschäftlicher Eigentumserwerb
- 7.1.3.4 Gesetzlicher Eigentumsübergang
- 7.1.3.5 Schutz des Eigentums
- 7.2 Dingliche Rechte
- 7.2.1 Beschränkt dingliche Nutzungsrechte
- 7.2.2 Beschränkt dingliche Verwertungsrechte
- 7.2.3 Beschränkt dingliche Erwerbsrechte
- 7.3 Sachenrechtliche Grundsätze
- 7.4 Die Forderungsabtretung
- 7.5 Merksätze/Kontrollfragen
- 143–174 8. Komplikationen bei der Leistungserbringung 143–174
- 8.1 Allgemeines zu Rechtsverletzungen und Leistungsstörungen
- 8.1.1 Pflichtverletzungen und Leistungshindernisse
- 8.1.2 Die Rechtsfolgen der Pflichtverletzungen
- 8.2 Das System des vertraglichen Schadensersatzes
- 8.2.1 Die Anspruchsgrundlage § 280 Abs. 1 BGB
- 8.2.2 Schadensersatzarten
- 8.2.2.1 Schadensersatz neben der Leistung
- 8.2.2.2 Schadensersatz statt der Leistung
- 8.3 Die Verzögerung
- 8.3.1 Begriff der Verzögerung und ihre Rechtsfolgen
- 8.3.2 Der Schuldnerverzug und seine Rechtsfolgen
- 8.3.2.1 Voraussetzungen des Schuldnerverzugs
- 8.3.2.2 Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs
- 8.3.3 Der Gläubigerverzug
- 8.4 Die Unmöglichkeit
- 8.4.1 Begriff und Erscheinungsformen
- 8.4.2 Die Rechtsfolgen der nachträglichen Unmöglichkeit
- 8.4.3 Besonderheiten der anfänglichen Unmöglichkeit
- 8.5 Die Rücksichtnahmepflichtverletzung
- 8.5.1 Gebot der Rücksichtnahme auf Rechtspositionen und Interessen
- 8.5.1.1 Schuldverhältnis
- 8.5.1.2 Rücksichtnahmepflichten
- 8.5.2 Rechtsfolgen der Rücksichtnahmepflichtverletzung
- 8.6 Der Mangel
- 8.7 Störung und Wegfall der Geschäftsgrundlage
- 8.8 Verjährung
- 8.8.1 Wesen und Rechtsfolgen
- 8.8.2 Die Verjährungsfrist
- 8.8.3 Der Verjährungsfristbeginn
- 8.8.4 Hemmung und Neubeginn
- 8.9 Merksätze/Kontrollfragen
- 175–194 9. Unerlaubte Handlungen und Schadensrecht 175–194
- 9.1 Einführung in das deliktische Schadensersatzrecht
- 9.2 Deliktshaftung aus unerlaubter Handlung bei nachzuweisendem Verschulden
- 9.2.1 Rechtsgutverletzungen nach § 823 Abs. 1 BGB
- 9.2.1.1 Verletzungshandlung
- 9.2.1.2 Rechtsgutverletzung
- 9.2.1.3 Rechtswidrigkeit
- 9.2.1.4 Verschulden
- 9.2.2 Verletzung von Schutzgesetzen nach § 823 Abs. 2 BGB
- 9.2.3 Vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB
- 9.3 Deliktshaftung aus unerlaubter Handlung bei vermutetem Verschulden
- 9.4 Gefährdungshaftung ohne Verschulden
- 9.4.1 Die Haftung des Kfz-Halters nach § 7 StVG
- 9.4.2 Die Produkthaftung
- 9.5 Schadensersatzrecht
- 9.5.1 Der ersatzfähige Schaden
- 9.5.1.1 Schadensarten
- 9.5.1.2 Schadensursächlichkeit
- 9.5.2 Schadenspositionen
- 9.5.3 Art und Umfang der Ersatzleistung
- 9.5.3.1 Naturalrestitution
- 9.5.3.2 Schadensminderung
- 9.6 Merksätze/Kontrollfragen
- 195–242 10. Rechtsfragen der Beschaffung von Material und Betriebsmitteln 195–242
- 10.1 Lieferantenbeziehungen
- 10.1.1 Due Diligence
- 10.1.2 Rahmenvertrag
- 10.1.3 Single Sourcing
- 10.1.4 Just-in-Time-Belieferung
- 10.2 Der Kaufvertrag
- 10.2.1 Wesen
- 10.2.2 Kauf unter Eigentumsvorbehalt
- 10.2.2.1 Der einfache Eigentumsvorbehalt
- 10.2.2.2 Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
- 10.2.2.3 Verlängerter Eigentumsvorbehalt und Globalzession
- 10.2.2.4 Der erweiterte Eigentumsvorbehalt
- 10.2.3 Mangelgewährleistung im Kauf
- 10.2.3.1 Sach- und Rechtsmängel
- 10.2.3.2 Gewährleistungsrechte
- 10.2.3.3 Verjährung von Gewährleistungsrechten
- 10.2.3.4 Haftungsbeschränkungen und Garantien
- 10.2.4 Der Verbrauchsgüterkauf
- 10.2.4.1 Begriff
- 10.2.4.2 Verbot verbraucherfeindlicher Vereinbarungen
- 10.2.4.3 Verbraucherspezifische Regelungen
- 10.2.4.4 Unternehmerregress
- 10.2.5 Der Handelskauf
- 10.2.5.1 Das Handelsgeschäft
- 10.2.5.2 Besonderheiten beim Handelskauf
- 10.2.6 Das UN-Kaufrecht
- 10.2.6.1 Anwendungsbereich
- 10.2.6.2 Regelungsinhalte
- 10.3 Internationale Liefergeschäfte und IPR
- 10.3.1 Nationales Recht und nationales Kollisionsrecht
- 10.3.2 Rechtswahl im internationalen Verkehr
- 10.3.3 Vertragsstatut bei fehlender Rechtswahl
- 10.3.4 Internationale Gerichtszuständigkeit
- 10.4 Der Werkvertrag
- 10.4.1 Wesen des Werkvertrags und Abgrenzungen
- 10.4.2 Werkvertragliche Pflichten
- 10.4.2.1 Verpflichtung zur Werkerstellung und Abgrenzung zum Lieferungskauf
- 10.4.2.2 Vergütungsverpflichtung des Bestellers
- 10.4.2.3 Sicherung des Werklohnanspruchs
- 10.4.3 Mangelgewährleistung
- 10.4.4 Beendigung des Werkvertrages
- 10.4.5 Der VOB-Bauvertrag
- 10.5 Gebrauchsüberlassungsverträge
- 10.5.1 Abgrenzungen
- 10.5.2 Einzelheiten zur Miete
- 10.5.2.1 Gegenstand der Miete
- 10.5.2.2 Form des Mietvertrags
- 10.5.2.3 Pflichten von Vermieter und Mieter
- 10.6 Merksätze/Kontrollfragen
- 243–262 11. Rechtsfragen der Finanzierung 243–262
- 11.1 Kreditgewährung
- 11.2 Gelddarlehen und Verbraucherdarlehen
- 11.2.1 Das Gelddarlehen
- 11.2.2 Der Verbraucherdarlehensvertrag
- 11.2.3 Begriffe und Anwendungsbereich
- 11.2.4 Vorvertragliche Pflichten des Unternehmers
- 11.2.5 Vertragsform und Inhalte
- 11.2.6 Laufende Pflichten
- 11.2.7 Kündigungsrechte
- 11.2.8 Verbundene Verträge
- 11.3 Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern
- 11.3.1 Finanzierungshilfen
- 11.3.2 Ratenlieferungsverträge
- 11.4 Finanzierungs-Leasing
- 11.4.1 Wesen
- 11.4.2 Rechtsbeziehungen im Leasingverhältnis
- 11.4.3 Übliche Vertragsinhalte
- 11.5 Factoring
- 11.5.1 Wesen und Funktionen
- 11.5.2 Varianten
- 11.6 Lieferantenkredit
- 11.7 Kreditsicherung
- 11.7.1 Personalsicherheiten
- 11.7.2 Realsicherheiten
- 11.8 Merksätze/Kontrollfragen
- 263–298 12. Rechtsfragen des Vertriebs 263–298
- 12.1 Übersicht über die Aspekte des Marketing- und Vertriebsrechts
- 12.1.1 Produktpolitik
- 12.1.2 Preispolitik
- 12.1.3 Kommunikationspolitik
- 12.1.4 Vertriebspolitik
- 12.1.5 Marketinginformationen
- 12.2 Rechtliche Grenzen der Preispolitik durch deutsches und europäisches Kartellrecht
- 12.2.1 Überblick
- 12.2.2 Auswirkungsprinzip und Vorrang europäischen Kartellrechts
- 12.2.3 Kartellrechtliche Regelungsbereiche
- 12.2.4 Preiskartelle
- 12.2.4.1 Horizontale Wettbewerbsbeschränkungen
- 12.2.4.2 Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
- 12.2.5 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- 12.3 Rechtliche Grenzen der Kommunikationspolitik durch das UWG-Lauterkeitsrecht
- 12.3.1 Zweck des Wettbewerbsrechts und Begriffe
- 12.3.2 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen
- 12.3.2.1 Generalklausel, schwarze Liste, § 3 UWG
- 12.3.2.2 Unlauterkeit durch Rechtsbruch, § 3a UWG
- 12.3.2.3 Mitbewerberschutz, § 4 UWG
- 12.3.3 Aggressive geschäftliche Handlungen, § 4a UWG
- 12.3.4 Irreführende geschäftliche Handlungen
- 12.3.5 Vergleichende Werbung
- 12.3.6 Unzumutbare Belästigung
- 12.3.7 Rechtsfolgen und Verfahren
- 12.4 Vertrieb durch externe Vertriebsorgane als Absatzmittler und Absatzhelfer
- 12.4.1 Überblick und Abgrenzungen
- 12.4.2 Absatzmittler
- 12.4.2.1 Der Vertragshändler
- 12.4.2.2 Der Franchisenehmer
- 12.4.3 Absatzhelfer
- 12.4.3.1 Der Handelsvertreter
- 12.4.3.2 Der Handelsmakler
- 12.4.3.3 Der Kommissionär
- 12.5 Rechtliche Anforderungen an den Direktvertrieb
- 12.5.1 Rechtlicher Verbraucherschutz
- 12.5.2 Verbraucherverträge und allgemeine Pflichten des Unternehmers
- 12.5.2.1 Eingeschränkter Anwendungsbereich
- 12.5.2.2 Vollanwendungsbereich
- 12.5.3 Besondere Vertriebsformen
- 12.5.3.1 Ausgangssituation
- 12.5.3.2 Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge
- 12.5.3.3 Fernabsatzverträge
- 12.5.3.4 Informationspflichten bei AGV und FAG
- 12.5.3.5 Widerrufsrecht bei AGV und FAG
- 12.5.3.6 Elektronischer Geschäftsverkehr
- 12.6 Merksätze/Kontrollfragen
- 299–330 13. Rechtsformen unternehmerischer Betätigung 299–330
- 13.1 Abgrenzungen
- 13.2 Einzelunternehmer
- 13.2.1 Unternehmer
- 13.2.2 Kaufleute
- 13.2.2.1 Der Istkaufmann
- 13.2.2.2 Der Kannkaufmann
- 13.2.2.3 Andere Kaufmannsarten
- 13.2.3 Firma
- 13.3 Personengesellschaften
- 13.3.1 Wesen und Gesellschaftszwecke
- 13.3.1.1 Der Gesellschaftsvertrag
- 13.3.1.2 Der gemeinsame Zweck
- 13.3.2 Die Rechtspersönlichkeit
- 13.3.3 Das Gesellschaftsvermögen
- 13.3.4 Rechte und Pflichten der Gesellschafter
- 13.3.4.1 Beitragspflicht
- 13.3.4.2 Allgemeine Treuepflicht
- 13.3.4.3 Pflicht / Recht zur Geschäftsführung nach innen
- 13.3.4.4 Vertretungsrecht nach außen
- 13.3.4.5 Recht auf Gewinnbeteiligung
- 13.3.5 Haftung
- 13.3.6 Beendigung der Gesellschaft
- 13.4 Körperschaften
- 13.4.1 Der Verein
- 13.4.2 Die GmbH
- 13.4.2.1 Wesen und Zweck
- 13.4.2.2 Rechtspersönlichkeit
- 13.4.2.3 Gründung
- 13.4.2.4 Haftung während der Gründungsphasen
- 13.4.2.5 Geschäftsführung und Vertretung
- 13.4.2.6 Gesellschafterversammlung
- 13.4.2.7 Aufsichtsrat
- 13.4.3 Die Aktiengesellschaft
- 13.4.3.1 Wesen und Rechtspersönlichkeit
- 13.4.3.2 Entstehung der AG
- 13.4.3.3 Vorstand: Geschäftsführung und Vertretung
- 13.4.3.4 Aufsichtsrat: Kontrolle
- 13.4.3.5 Aktionärs-Hauptversammlung
- 13.5 Merksätze/Kontrollfragen
- 331–352 14. Rechtsdurchsetzung: Forderungsmanagement 331–352
- 14.1 Forderungsmanagement im Unternehmen und Rechtsdurchsetzung
- 14.2 Das Kaufmännische Mahnverfahren
- 14.2.1 Die Mahnung und der Verzug
- 14.2.2 Externes Mahnwesen
- 14.2.3 Kosten
- 14.2.4 Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten
- 14.3 Außergerichtliches Konfliktmanagement
- 14.3.1 Der Vergleich
- 14.3.2 Die Schlichtung
- 14.3.3 Die Mediation
- 14.4 Gerichtliche Verfahren
- 14.4.1 Das Schiedsgerichtsverfahren
- 14.4.2 Das gerichtliche Mahnverfahren
- 14.4.2.1 Wesen des Verfahrens
- 14.4.2.2 Verfahrensablauf
- 14.4.2.3 Kosten
- 14.4.2.4 Das Europäische Mahnverfahren
- 14.4.3 Der Zivilprozess
- 14.4.3.1 Prozessvorbereitung
- 14.4.3.2 Zuständiges Gericht
- 14.4.3.3 Die Klageerhebung
- 14.4.3.4 Der Verhandlungstermin
- 14.4.3.5 Der Verhandlungstermin in besonderen Fällen
- 14.4.3.6 Die Entscheidung
- 14.4.3.7 Die Zwangsvollstreckung
- 14.5 Merksätze/Kontrollfragen
- 353–353 Weiterführende Literaturhinweise 353–353
- 354–361 Stichwortverzeichnis 354–361
- 362–362 Impressum 362–362