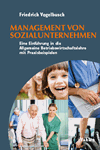Management von Sozialunternehmen
Eine Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Abbildungen und Praxisbeispielen
Zusammenfassung
Dieses Buch ist eine praxisorientierte Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Unternehmen der Gesundheitsbranche und Pflege. Es richtet sich sowohl an Betriebswirte als auch an Nicht-Ökonomen, die in der Sozialwirtschaft in das Management von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen gesundheitswirtschaftlichen Unternehmen einsteigen oder bereits in verantwortlichen Positionen tätig sind und das betriebswirtschaftliche Instrumentarium in ihrer Praxis benötigen. Es ist ebenfalls Lehrbuch für Pflegemanagement-Studiengänge.
Aus dem Inhalt:
- Unternehmensgründung, Standortwahl und Rechtsformen
- Sozialwirtschaftlicher Rahmen
- Wirtschaftsprivatrecht, Gesellschafts- und Steuerrecht
- Finanzierung
- Organisation (Struktur und Abläufe, Prozesse, Projekte), Organisationsentwicklung
- Marketing
- Unternehmensführung und Personalmanagement
- Corporate Governance, Corporate Compliance, Corporate Social Responsibility (CSR)
- Analyse ausgewählter Jahresabschlüsse, Sozialunternehmen in der Statistik
WP/StB Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch ist Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf, Honorarprofessor an der Evangelischen Hochschule in Dresden und Lehrbeauftragter an der Dresden International University (DIU).
- I–XXVIII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXVIII
- 1–22 1 Einführung 1–22
- 1.1 Management
- 1.2 Einordnung und Abgrenzung der betriebswirtschaftlichen Managementlehre für Sozialunternehmen
- 1.2.1 Historischer Überblick über die Betriebswirtschaftslehre
- 1.2.2 Abgrenzung zur Volkswirtschaftslehre (VWL)
- 1.2.3 Abgrenzung zur Finanzwissenschaft
- 1.3 Gegenstand der betriebswirtschaftlichen Managementlehre für Sozialunternehmen – Besonderheiten der Dienstleistungsbranche
- 1.4 Gegenstand der BWL für Sozialunternehmen – sich wandelnde Rahmenbedingungen
- 23–35 2 Akteure des Wirtschaftslebens 23–35
- 2.1 Staat
- 2.2 Private und öffentliche Haushalte
- 2.3 Betriebe und Unternehmen
- 2.3.1 Gewerbliche Unternehmen
- 2.3.2 Dienstleistungsunternehmen
- 2.3.3 Sozialunternehmen
- 2.3.4 Gemeinnützige Unternehmen
- 37–71 3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen 37–71
- 3.1 Betrieblicher Leistungsprozess
- Besonderheiten der Erstellung der sozialen Dienstleistungen
- 3.2 Der Leistungserstellungsprozess
- 3.2.1 Betriebliche Produktionsfaktoren
- 3.2.2 Der Leistungserstellungsprozess als Wertschöpfungskette
- 3.3 Wirkungen der betrieblichen Leistungserstellung
- Fazit: Output oder Outcome als Maßstäbe für die Erfolgsmessung eines Sozialunternehmens
- 3.4 Die betriebliche Produktion im Rechnungswesen
- 3.4.1 Ziele des Wirtschaftens im Betrieb
- 3.5 Wertschöpfung und ökonomisches Prinzip
- 3.5.1 Wertschöpfung
- 3.5.2 Ökonomisches Prinzip
- 3.6 Messung des Erfolges
- 3.6.1 Vermögen und Kapital (Bestandsgrößen)
- 3.6.2 Ertrag und Aufwand, Einnahmen und Ausgaben, Leistungen und Kosten (Flussgrößen)
- 3.6.3 Kennzahlen zur Beurteilung/Bestimmungsgrößen des Leistungserstellungsprozesses
- 73–149 4 Zivilrechtlicher Rahmen 73–149
- 4.1 Privatautonomie
- 4.2 Rechtsformen
- 4.2.1 Übersicht
- 4.2.2 Private Rechtsformen
- 4.2.3 Mischformen
- 4.2.4 Öffentliche Rechts- und Betriebsformen
- 4.2.5 Konzern und Holding-Organisation
- 4.2.6 Mehrgliedrige Strukturen
- 4.2.7 Wahl der Rechtsform
- 4.2.8 Wechsel der Rechtsform
- 4.2.9 Ausgliederung, Verschmelzung, Spaltung
- 4.3 Regelungen des Sozialstaats
- 151–161 5 Sozialwirtschaftlicher Rahmen 151–161
- 5.1 Unterteilung des sozialwirtschaftlichen Rahmens in drei Ebenen
- 5.2 Wandel der Betätigung kommunaler Unternehmen im Bereich der Sozialwirtschaft
- 5.3 Wandlung der Bedeutung von Sozialunternehmen des Dritten Sektors
- 163–210 6 Steuerrechtlicher Rahmen 163–210
- 6.1 Allgemeiner Überblick
- 6.1.1 Überblick über die Steuerarten
- 6.1.2 Verfahrensrecht
- 6.1.3 Steuerrechtliche Pflichten für das Management
- 6.2 Überblick über das Gemeinnützigkeitsrecht
- 6.2.1 Mechanik der Steuerbegünstigung
- 6.2.2 Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit i. w. S.
- 6.2.3 Handlungsmaximen und Grundsätze für die Betätigung
- 6.2.4 Verfahren der Anerkennung
- 6.2.5 Mustersatzung
- 6.2.6 Betätigungsbereiche
- 6.2.7 Auswirkungen auf die Besteuerung der gemeinnützigen Körperschaft
- 6.3 FAQ der Besteuerung gemeinnütziger Körperschaften
- 6.3.1 Darf eine gemeinnützige Körperschaft Gewinne erzielen?
- 6.3.2 Darf sich eine gemeinnützige Körperschaft gewerblich betätigen?
- 6.3.3 Wie kann eine gemeinnützige Körperschaft die strengen Nachweispflichten der Mildtätigkeit erfüllen?
- 6.3.4 Wie kann der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung eingehalten werden?
- 6.3.5 Welche Mittel stehen zur Gründung einer gemeinnützigen und einer gewerblichen Tochtergesellschaft zur Verfügung?
- 6.3.6 Welche Mittel stehen zur Gründung einer gemeinnützigen Stiftung zur Verfügung?
- 6.3.7 Sind Ausschüttungen an gemeinnützige Anteilseigner zulässig?
- 6.3.8 Wie werden Verluste eingestuft?
- 6.3.9 Unter welchen Bedingungen dürfen Darlehen von einer gemeinnützigen Körperschaft vergeben werden?
- 6.3.10 Was sind typische Beispiele für wirtschaftliche Betätigungen?
- 6.3.11 Was passiert, wenn sich mehrere gemeinnützige Träger zu einem Projekt zusammenschließen?
- 6.3.12 Welche Rahmenbedingungen gelten für das Sponsoring?
- 6.3.13 Welche Besonderheiten gelten bei Zuwendungsbescheinigungen?
- 6.3.14 Wie hoch dürfen Verwaltungsausgaben einer gemeinnützigen Körperschaft sein?
- 6.3.15 Was ist bei Berichten der Geschäftsführung gemeinnütziger Körperschaften zu beachten?
- 6.3.16 Welche Besonderheiten gelten für Zweckbetriebe der Wohlfahrtspflege?
- 211–225 7 Unternehmensgründung und Standortwahl 211–225
- 7.1 Unternehmensgründung
- 7.2 Standortwahl
- 7.2.1 Übersicht
- 7.2.2 Gütereinsatzseite
- 7.2.3 Güterabsatzseite
- 7.3 Fazit: Unternehmensgründung und Standortwahl von Sozialunternehmen
- 227–405 8 Betriebliche Funktionen 227–405
- 8.1 Marketing
- 8.1.1 Begriff und Abgrenzung
- 8.1.2 Entwicklung des Marketings
- 8.1.3 Was heißt Marketing in der gewerblichen Wirtschaft?
- 8.1.4 Instrumente des Marketing-Mix
- 8.1.5 Was bedeutet Marketing für Dienstleistungsunternehmen?
- 8.1.6 Was bedeutet Marketing für Sozialunternehmen?
- 8.1.7 Vertiefung und Verbreiterung des Marketingansatzes
- 8.1.8 Marketingpolitik für Sozialunternehmen im Einzelnen
- 8.1.9 Fazit: Marketing für Sozialunternehmen
- 8.2 Finanzierung
- 8.2.1 Begriffe, Abgrenzung und Überblick
- 8.2.2 Zuschüsse als Sonderform der Finanzierung
- 8.2.3 Finanzplanung und Finanzverantwortliche im Management
- 8.2.4 Finanzierungsregeln für eine optimalen Finanzierung
- 8.2.5 Sozialwirtschaftliche Finanzierung
- 8.2.6 Finanzierung von Sozialunternehmen aus Gegenleistungen
- 8.2.7 Investitionszuschüsse in der Sozialwirtschaft
- 8.2.8 Finanzierung von Sozialunternehmen ohne Gegenleistungen
- 8.2.9 Finanzierungsstrategien im Laufe des Lebens eines Sozialunternehmens
- 8.2.10 Empirisches Bild zur Finanzierung von Sozialunternehmen
- 8.2.11 Ausweis der sozialwirtschaftlichen Finanzierung in der Gewinn- und Verlustrechnung
- 8.2.12 Fazit: Finanzierung Sozialunternehmen
- 8.3 Organisation
- 8.3.1 Überblick zu verschiedenen Organisationsansätzen
- 8.3.2 Grundbegriffe
- 8.3.3 Gestaltung der Aufbauorganisation
- 8.3.4 Gestaltung der Ablauforganisation
- 8.3.5 Organisationsentwicklung
- 8.3.6 Fazit: Organisation von Sozialunternehmen
- 8.3.7 Projektmanagement als Instrument in der Sozialwirtschaft
- 8.4 Personal
- 8.4.1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Personalmanagements
- 8.4.2 Ziele des Personalmanagements
- 8.4.3 Personalwirtschaftliche Instrumente
- 8.4.4 Aufgaben des Personalmanagements
- 8.4.5 Personalverwaltung
- 8.4.6 Personalmanagement
- 8.4.6 Fazit: Personalmanagement bei Sozialunternehmen
- 8.5 Prozessmanagement
- 8.5.1 Das Konzept der Wert(schöpfungs)ketten (Supply Chain Management)
- 8.5.2 Business Reengineering in Industrieunternehmen
- 8.5.3 Weitere Konzepte des Prozessmanagements
- 8.5.4 Prozesse in Sozialunternehmen
- 8.5.5 Fazit: Prozessmanagement bei Sozialunternehmen
- 8.6 Controlling
- 8.6.1 Historische Entwicklung des Controllings in den Vereinigten Staaten von Amerika
- 8.6.2 Historische Entwicklung des Controllings in Deutschland
- 8.6.3 Definition, Funktionen und Aufgaben des Controllings
- 8.6.4 Phasen des Controllings
- 8.6.5 Dimensionen des Controllings
- 8.6.6 Einbindung des Controllings in die Unternehmensorganisation
- 8.6.7 Besonderheiten des Controllings bei Sozialunternehmen
- 8.6.8 Controlling der Wirkungen (Outcome, Effects)
- 8.7 Qualitätsmanagement
- 8.7.1 Entwicklung des Qualitätsmanagements
- 8.7.2 Bedeutung des Qualitätsmanagements für Sozialunternehmen
- 407–462 9 Unternehmensführung und Beaufsichtigung 407–462
- 9.1 Grundlagen und Begriffe: Management
- 9.2 Entwicklung der Managementlehre
- 9.3 Modelle für das strategische Management eines Unternehmens
- 9.4 Corporate Governance: Gute Geschäftsführung und Beaufsichtigung
- 9.5 Besonderheiten des Managements für Sozialunternehmen
- 9.5.1 Managementmodelle für Sozialunternehmen
- 9.5.2 Untersuchungen zum strategischen Management von Sozialunternehmen
- 463–572 10 Managementinstrumente des Rechnungswesens 463–572
- 10.1 Überblick
- 10.2 Externe und interne Instrumente des Rechnungswesens
- 10.2.1 Externe Instrumente des Rechnungswesens
- 10.2.2 Interne Instrumente des Rechnungswesens
- 10.2.3 Instrumente des Rechnungswesens, die sowohl für externe als auch für interne Zwecke verwendet werden
- 10.3 Im Laufe des Lebens eines Unternehmens eingesetzte Instrumente des Rechnungswesens („Von der Wiege bis zur Bahre“)
- 10.3.1 Businessplan
- 10.3.2 Finanz- und Lohnbuchhaltung als Grundlage
- 10.3.3 Internes Kontrollsystem
- 10.3.4 Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- 10.3.5 Jahresabschluss und Lagebericht
- 10.3.6 Reporting (Kostenrechnung, Budgetierung und Controlling)
- 10.3.7 Umfassende Controlling- und Reporting-Instrumente
- 10.3.8 Zwischenfazit zu den Instrumenten des Rechnungswesens – gegliedert nach Entwicklungsstufen des Rechnungswesens
- 10.3.9 Investitionsrechnung
- 10.3.10 Kalkulation und weitere kostenrechnerische Entscheidungen
- 10.3.11 Insolvenzprophylaxe (Überschuldungsstatus und Fortführungsprognose)
- 10.4 Fazit zu den Managementinstrumenten in Sozialunternehmen
- 573–597 11 Analyse des Jahresabschlusses/Betriebsvergleich/Benchmarking 573–597
- 11.1 Überblick zur Analyse des Jahresabschlusses
- 11.2 Kennzahlenanalyse
- 11.3 Betriebsvergleich und Benchmarking
- 11.3.1 Betriebsvergleich
- 11.3.1 Benchmarking
- 11.4 Exemplarische Analyse der Jahresabschlüsse von Sozialunternehmen
- 11.4.1 Analyse ausgewählter Jahresabschlüsse von Sozialunternehmen
- 11.4.2 Abschließende Hinweise zur Vorgehensweise bei der Analyse eines Jahresabschlusses (quick and dirty)
- 599–615 12 Ausblick 599–615
- Anhang 1: Bestandsaufnahme der Sozialunternehmen in der Statistik
- Anhang 2: Übersicht über Management-Ansätze
- 617–636 Literaturverzeichnis 617–636
- 637–641 Stichwortverzeichnis 637–641
- 642–642 Impressum 642–642