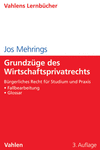- doi.org/10.15358/9783800649419
- ISBN print: 978-3-8006-4940-2
- ISBN online: 978-3-8006-4941-9
- C.H.BECK, München C.H.BECK, München
- BibTeX
Zusammenfassung
Zum Inhalt:
Wirtschaftsprivatrecht, insbesondere Bürgerliches Recht
„Three in one“ lautet das Motto dieses Buchs: Es beginnt mit einer ausführlichen Einführung in das BGB mit Exkursen in andere Rechtsgebiete, insbesondere ins Handels- und ins Gesellschaftsrecht. Alle Sachverhalte werden zunächst in einer verständlichen Sprache erläutert, danach werden die Probleme anhand von Beispielen verdeutlicht. Zahlreiche Klausur- und Praktikertipps begleiten den Leser, eingestreute Übungsaufgaben und „Merksätze“ fordern zum aktiven Lernen auf. Ein modernes Layout unter Verwendung von Icons bietet höchsten Lesekomfort. Der zweite Teil enthält eine ausführliche Anleitung zur Bearbeitung von Klausuren samt zehn Klausuren mit Musterlösungen. Ein Glossar mit 150 wichtigen Begriffen dient der gezielten Klausurvorbereitung. Ein ausführliches Sachregister macht das Buch zu einem Nachschlagewerk, insbesondere für Praktiker.
Aus Rezensionen zur 1. Auflage:
„Geniale Prüfungs- und Praxistipps machen Recht spannend und einfach“.
„Klar verständlich, prägnant und dabei humorvoll bringt Mehrings die z. T. trockene Materie auf den Punkt.“
„Dieses Buch ist Unternehmern zu empfehlen, da die Praxishinweise sehr wertvolle Tipps und Tricks aus jahrelanger Richtertätigkeit enthalten. Tolles Preis/ Leistungsverhältnis.“
Zum Autor:
Jos Mehrings ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Münster. Davor lehrte er an der Universität Oldenburg und war fünf Jahre als Richter am Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht tätig.
- 1–20 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–20
- 21–39 Einleitung 21–39
- 39–186 1. Teil Vertragsschluss und weitere Grundlagen 39–186
- 39–74 Kapitel 1 Der Abschluss von Verträgen 39–74
- 39–53 1.1 Angebot 39–53
- 53–59 1.2 Annahme 53–59
- 59–66 1.3 Schweigen als Annahme 59–66
- 66–70 1.4 Zugang von Willenserklärungen 66–70
- 70–74 1.5 Vorvertrag, Option, Letter of Intent 70–74
- 74–94 Kapitel 2 Die Privatautonomie 74–94
- 74–86 2.1 Die Vertragsfreiheit 74–86
- 86–92 2.2 Die Testierfreiheit 86–92
- 92–94 2.3 Die Vereinsfreiheit 92–94
- 94–124 Kapitel 3 Verbraucherschutz, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen 94–124
- 94–97 3.1 Verbraucher, Unternehmer, Kaufmann 94–97
- 97–101 3.2 Verbraucherschützende Regelungen 97–101
- 101–124 3.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen 101–124
- 124–135 Kapitel 4 Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Deliktsfähigkeit 124–135
- 124–129 4.1 Rechtsfähigkeit 124–129
- 129–132 4.2 Geschäftsfähigkeit 129–132
- 132–135 4.3 Deliktsfähigkeit 132–135
- 135–148 Kapitel 5 Gestaltungsrechte, insbesondere Anfechtung 135–148
- 135–136 5.1 Begriffe 135–136
- 136–139 5.2 Gestaltungsrechte 136–139
- 139–148 5.3 Anfechtung 139–148
- 148–170 Kapitel 6 Das Recht der Stellvertretung 148–170
- 148–150 6.1 Grundlagen des Vertretungsrechts 148–150
- 150–161 6.2 Voraussetzungen der Stellvertretung 150–161
- 161–164 6.3 Vertreter ohne Vertretungsmacht 161–164
- 164–166 6.4 Exkurs: Vertretung bei Personengesellschaften 164–166
- 166–168 6.5 Exkurs: Vertretung bei Kapitalgesellschaften 166–168
- 168–170 6.6 Selbstkontrahieren 168–170
- 170–177 Kapitel 7 Formvorschriften 170–177
- 170–171 7.1 Grundlagen der Formbedürftigkeit 170–171
- 171–171 7.2 Funktionen von Formvorschriften 171–171
- 171–174 7.3 Formarten des BGB 171–174
- 174–177 7.4 Rechtsfolgen von Formmängeln 174–177
- 177–186 Kapitel 8 Verjährung 177–186
- 177–178 8.1 Grundlagen 177–178
- 178–183 8.2 Verjährungsfristen 178–183
- 183–186 8.3 Neubeginn und Hemmung der Verjährung 183–186
- 186–359 2. Teil Vertragliche Schuldverhältnisse 186–359
- 186–214 Kapitel 9 Vertragliche Schuldverhältnisse 186–214
- 186–188 9.1 Zustandekommen eines vertraglichen Schuldverhältnisses 186–188
- 188–190 9.2 Inhalte des Schuldverhältnisses 188–190
- 190–192 9.3 Vorvertragliche Schuldverhältnisse 190–192
- 192–206 9.4 Art und Zeit der Leistungserbringung 192–206
- 206–207 9.5 Leistung in Person oder durch einen Dritten 206–207
- 207–210 9.6 Abtretung von Forderungen 207–210
- 210–214 9.7 Gesamtschuld 210–214
- 214–220 Kapitel 10 Erlöschen von Schuldverhältnissen 214–220
- 214–215 10.1 Erlöschen durch Leistung 214–215
- 215–216 10.2 Annahme an Erfüllungs statt 215–216
- 216–218 10.3 Aufrechnung 216–218
- 218–220 10.4 Hinterlegung 218–220
- 220–228 Kapitel 11 Vergleich 220–228
- 220–220 11.1 Grundlagen 220–220
- 220–221 11.2 Außergerichtlicher Vergleich 220–221
- 221–228 11.3 Gerichtlicher Vergleich 221–228
- 228–244 Kapitel 12 Leistungsstörungen (Einführung) 228–244
- 228–230 12.1 Grundlagen 228–230
- 230–239 12.2 Die Grundvorschrift des § 280 Abs. 1 BGB 230–239
- 239–244 12.3 Anspruch aus § 280 Abs. 1 BGB (allein) 239–244
- 244–271 Kapitel 13 Verzögerung der Leistung (Verzug) 244–271
- 244–253 13.1 Grundlagen 244–253
- 253–254 13.2 Rechtsfolgen des Verzugs (Überblick) 253–254
- 254–258 13.3 Schadensersatz neben der Leistung 254–258
- 258–263 13.4 Schadensersatz statt der Leistung 258–263
- 263–264 13.5 Rücktritt vom Vertrag 263–264
- 264–265 13.6 Zusammenfassung zum Verzug 264–265
- 265–271 13.7 Vertragsstrafe und pauschalierter Schadensersatz 265–271
- 271–332 Kapitel 14 Schlechtleistung im Kaufrecht 271–332
- 271–273 14.1 Grundlagen 271–273
- 273–310 14.2 Voraussetzungen der Nacherfüllung 273–310
- 310–317 14.3 Rücktritt vom Vertrag 310–317
- 317–317 14.4 Minderung des Kaufpreises 317–317
- 317–319 14.5 Rückgriff des Unternehmers 317–319
- 319–328 14.6 Schadensersatz 319–328
- 328–332 14.7 Die Herstellergarantie 328–332
- 332–344 Kapitel 15 Exkurs: Die Produkthaftung (Produzentenhaftung) 332–344
- 332–335 15.1 Vorbemerkung 332–335
- 335–337 15.2 Produkthaftung nach § 823 Abs. 1 BGB 335–337
- 337–344 15.3 Produkthaftung nach dem ProdHaftG 337–344
- 344–359 Kapitel 16 Weitere Leistungsstörungen 344–359
- 344–356 16.1 Unmöglichkeit 344–356
- 356–359 16.2 Störung der Geschäftsgrundlage 356–359
- 359–429 3. Teil Einzelne vertragliche Schuldverhältnisse 359–429
- 359–381 Kapitel 17 Werkvertrag 359–381
- 359–361 17.1 Grundlagen 359–361
- 361–365 17.2 Abgrenzung zu anderen Verträgen 361–365
- 365–371 17.3 Einzelheiten zum Werkvertrag 365–371
- 371–375 17.4 Ansprüche des Bestellers bei Mängeln 371–375
- 375–376 17.5 Verjährung der Mängelansprüche 375–376
- 376–378 17.6 Sicherung der Werklohnforderung 376–378
- 378–379 17.7 Der Kostenanschlag 378–379
- 379–381 17.8 Kündigungsrecht des Bestellers 379–381
- 381–389 Kapitel 18 Dienstvertrag 381–389
- 381–382 18.1 Grundlagen 381–382
- 382–382 18.2 Abschluss des Dienstvertrags 382–382
- 382–383 18.3 Vertragspflichten 382–383
- 383–384 18.4 Ansprüche wegen mangelhafter Dienstleistungen 383–384
- 384–389 18.5 Beendigung 384–389
- 389–423 Kapitel 19 Mietvertrag 389–423
- 389–390 19.1 Grundlagen 389–390
- 390–391 19.2 Abgrenzung zu anderen Verträgen 390–391
- 391–395 19.3 Abschluss des Mietvertrags 391–395
- 395–403 19.4 Pflichten der Parteien 395–403
- 403–406 19.5 Haftung für Mängel 403–406
- 406–415 19.6 Beendigung des Mietverhältnisses 406–415
- 415–416 19.7 Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit 415–416
- 416–421 19.8 Nachmieter, Untervermietung 416–421
- 421–423 19.9 Rechtslage nach Beendigung des Mietverhältnisses 421–423
- 423–429 Kapitel 20 Weitere Vertragstypen 423–429
- 423–424 20.1 Der Darlehensvertrag 423–424
- 424–426 20.2 Der Leasingvertrag 424–426
- 426–427 20.3 Der Factoringvertrag 426–427
- 427–428 20.4 Der Franchisevertrag 427–428
- 428–429 20.5 Der Lizenzvertrag 428–429
- 429–486 4. Teil Gesetzliche Schuldverhältnisse 429–486
- 429–433 Kapitel 21 Überblick zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen 429–433
- 433–467 Kapitel 22 Unerlaubte Handlungen 433–467
- 433–434 22.1 Grundlagen 433–434
- 434–452 22.2 Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB 434–452
- 452–454 22.3 § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem Schutzgesetz 452–454
- 454–456 22.4 Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB) 454–456
- 456–467 22.5 Haftung für den Verrichtungsgehilfen (§ 831 BGB) 456–467
- 467–479 Kapitel 23 Allgemeines Schadensrecht 467–479
- 467–468 23.1 Grundlagen 467–468
- 468–470 23.2 Sondervorschriften (§§ 842 ff. BGB) 468–470
- 470–479 23.3 Allgemeine Regelungen (§§ 249 ff. BGB) 470–479
- 479–486 Kapitel 24 Ungerechtfertigte Bereicherung 479–486
- 479–480 24.1 Grundlagen 479–480
- 480–484 24.2 Voraussetzungen 480–484
- 484–485 24.3 Umfang des Herausgabeanspruchs 484–485
- 485–486 24.4 Verfügung eines Nichtberechtigten 485–486
- 486–548 5. Teil Sachenrecht 486–548
- 486–501 Kapitel 25 Grundlagen des Sachenrechts 486–501
- 486–488 25.1 Einführung 486–488
- 488–489 25.2 Eigentum 488–489
- 489–492 25.3 Besitz 489–492
- 492–494 25.4 Weitere Begriffe aus dem Sachenrecht 492–494
- 494–497 25.5 Das Trennungsprinzip (Abstraktionsprinzip) 494–497
- 497–501 25.6 Anspruchsgrundlagen im Sachenrecht 497–501
- 501–524 Kapitel 26 Der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 501–524
- 501–502 26.1 Grundlagen 501–502
- 502–510 26.2 Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 502–510
- 510–524 26.3 Der gutgläubige Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 510–524
- 524–538 Kapitel 27 Der gesetzliche Eigentumserwerb 524–538
- 524–530 27.1 Grundlagen 524–530
- 530–532 27.2 Verbindung mit einem Grundstück: § 946 BGB 530–532
- 532–533 27.3 Verbindung beweglicher Sachen: § 947 BGB 532–533
- 533–537 27.4 Verarbeitung: § 950 BGB 533–537
- 537–538 27.5 Rechtsfolge: § 951 BGB 537–538
- 538–548 Kapitel 28 Recht der unbeweglichen Sachen 538–548
- 538–539 28.1 Grundlagen 538–539
- 539–541 28.2 Auflassung 539–541
- 541–542 28.3 Auflassungsvormerkung 541–542
- 542–542 28.4 Gutgläubiger Erwerb 542–542
- 542–543 28.5 Das Grundbuch 542–543
- 543–545 28.6 Erbbaurecht 543–545
- 545–548 28.7 Wohnungseigentumsrecht 545–548
- 548–591 6. Teil Kreditsicherungsrecht 548–591
- Kapitel 29 Kreditsicherungsrecht
- 548–550 29.1 Grundlagen 548–550
- 550–563 29.2 Bürgschaft 550–563
- 563–566 29.3 Schuldbeitritt (kumulative Schuld(mit)übernahme) 563–566
- 566–567 29.4 Patronatserklärung 566–567
- 567–572 29.5 Garantievertrag 567–572
- 572–578 29.6 Eigentumsvorbehalt 572–578
- 578–583 29.7 Sicherungsübereignung 578–583
- 583–591 29.8 Pfandrechte 583–591
- 591–677 7. Teil Grundlagen der Fallbearbeitung 591–677
- 591–620 Kapitel 30 Anleitung zur Lösung von Rechtsfällen 591–620
- 591–594 30.1 Schritte zur Fallbearbeitung 591–594
- 594–600 30.2 Bestimmung der Anspruchsgrundlage 594–600
- 600–607 30.3 Wichtige Anspruchsgrundlagen 600–607
- 607–614 30.4 Der Anspruchsaufbau 607–614
- 614–616 30.5 Prüfungsreihenfolge 614–616
- 616–620 30.6 Andere Aufgabenstellungen 616–620
- 620–677 Kapitel 31 Beispiele von Fallbearbeitungen 620–677
- 620–627 Fall 1: Damenmäntel 620–627
- 627–631 Fall 2: Vertrag oder nicht Vertrag, nur das ist hier die Frage 627–631
- 631–640 Fall 3: Computerbildschirme 631–640
- 640–645 Fall 4: Der rote Golf 640–645
- 645–648 Fall 5: Gammelfleisch 645–648
- 648–655 Fall 6: Außer Spesen noch was gewesen 648–655
- 655–659 Fall 7: Fahrt zur Schwarzwaldklinik 655–659
- 659–667 Fall 8: Der enttäuschte Camper 659–667
- 667–672 Fall 9: Der unwesentliche Motor 667–672
- 672–677 Fall 10: Dachpfannen 672–677
- 677–748 8. Teil Glossar 677–748
- 677–727 Glossar 677–727
- 727–728 Literaturverzeichnis 727–728
- 728–748 Sachregister 728–748
- 748–748 Impressum 748–748