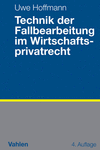Technik der Fallbearbeitung im Wirtschaftsprivatrecht
Zusammenfassung
Technik der Fallbearbeitung im Wirtschaftsprivatrecht
Die Niederschrift eines Gutachtens ist „Übungssache“, die sich trainieren lässt. Dieses Buch gibt Studierenden das tech-nische Rüstzeug an die Hand, das sie befähigt, sich in der Prüfungssituation um die Probleme des zu lösenden Falls zu kümmern und nicht unnötig Zeit mit Überlegungen hinsichtlich Sprachstil, gutach-terliche Aufbaukonzeptionen, Prüfungsschemata und Methodenlehre zu verlieren.
Leitlinie bei den Lösungen der thematisch geordneten Fälle ist die Praxis der Zivil-gerichte. Zitierte Literaturstimmen und Rechtsprechungsnachweise ermöglichen darüber hinaus die Vertiefung einzelner Probleme durch weiterführende Lektüre.
Einprägsame und übersichtliche Prüfungsschemata ergänzen die Darstellung und dienen der Lernkontrolle.
Der Autor
Dr. jur. Uwe Hoffmann unterrichtet und prüft Wirtschaftsprivatrecht an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist außerdem als Dozent und Prüfer an der Fachhochschule Bochum und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Südöstliches Westfalen tätig gewesen.
- 1–17 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–17
- 18–39 A. Die Fallbearbeitungstechnik 18–39
- 18–22 I. Das Wirtschaftsprivatrecht 18–22
- 18–19 1. Bürgerliches Recht und Sonderprivatrecht 18–19
- 19–20 2. Die Gesetzgebungstechnik 19–20
- 20–21 3. Der Rechtsfolgebegriff und seine Voraussetzungen 20–21
- 21–22 4. Natürlich und juristische Personen sowie Personengesellschaften 21–22
- 22–22 II. Die Aufgabe – Sinn und Zweck 22–22
- 22–23 III. Der Fall und die Fallfrage 22–23
- 23–28 IV. Gutachten und Anspruchsaufbau 23–28
- 23–24 1. Sinn und Unsinn von Prüfungsschemata 23–24
- 24–24 2. Das Gutachten 24–24
- 24–26 3. Der Anspruch 24–26
- 26–28 4. Insbesondere der vertragliche Anspruch 26–28
- 28–32 V. Der Gutachtenstil 28–32
- 28–28 1. Abgrenzung – Der Urteilsstil 28–28
- 2. Merkmale des Gutachtenstils
- 32–36 VI. Besonderheiten bei der Bearbeitung einer Hausarbeit 32–36
- 32–33 1. Titelblatt 32–33
- 33–33 2. Sachverhalt 33–33
- 33–34 3. Gliederung 33–34
- 34–35 4. Literaturverzeichnis 34–35
- 35–35 5. Abkürzungsverzeichnis 35–35
- 35–36 6. Gutachten 35–36
- 36–36 7. Versicherung 36–36
- 36–39 VII. Kurzklausuren und Fragenklausuren 36–39
- 39–227 B. Bürgerliches Recht 39–227
- 39–94 I. Allgemeiner Teil des BGB 39–94
- 39–44 § 1 Willenserklärung, Einigung und Auslegung 39–44
- 44–56 § 2 Das Zustandekommen von Verträgen; Angebot und Annahme 44–56
- 56–66 § 3 Anfechtung der Willenserklärung wegen Irrtums 56–66
- 66–69 § 4 Trennung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften 66–69
- 69–77 § 5 Willenserklärungen nicht oder beschränktgeschäftsfähiger Personen 69–77
- 77–94 § 6 Botenschaft und Stellvertretung 77–94
- 94–124 II. Schuldrecht AT 94–124
- 94–97 § 7 Besonderer Verbraucherschutz beim Zustandekommen von Verträgen 94–97
- 97–103 § 8 Generelle Pflichtverletzungen; Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte (VSD) 97–103
- 103–109 § 9 Der Schuldnerverzug; Schadensersatz statt Leistung nach Fristsetzung 103–109
- 109–119 § 10 Die Unmöglichkeit der Leistung 109–119
- 119–124 § 11 Der Gläubigerverzug (Annahmeverzug) 119–124
- 124–165 III. Schuldrecht BT – vertragliche Schuldverhältnisse 124–165
- 124–137 § 12 Kaufvertrag 124–137
- 137–143 § 13 Mietvertrag und Leasing 137–143
- 143–148 § 14 Werkvertrag 143–148
- 148–165 § 15 Personalkredit 148–165
- 165–189 IV. Schuldrecht BT – gesetzliche Schuldverhältnisse 165–189
- 165–169 § 16 Die Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) 165–169
- 169–179 § 17 Unerlaubte Handlung 169–179
- 179–181 § 18 Negatorische Ansprüche 179–181
- 181–189 § 19 Bereicherungsrecht 181–189
- 189–210 V. Sachenrecht – Eigentum 189–210
- 189–204 § 20 Eigentum, Besitz und Anwartschaftsrecht (AWR) 189–204
- 204–210 § 21 Eigentümer-Besitzerverhältnis (EBV) 204–210
- 210–227 VI. Sachenrecht – beschränkt dingliche Rechte 210–227
- 210–212 § 22 Pfandrechte an beweglichen Sachen 210–212
- 212–224 § 23 Beschränkt dingliche Rechte an Immobilien – Grundpfandrechte 212–224
- 224–227 § 24 Beschränkt dingliche Rechte an Immobilien – Nutzungsrechte 224–227
- 227–295 C. Handelsrecht 227–295
- 227–237 I. Gewerbebegriff und Kaufmannseigenschaft 227–237
- 227–232 § 25 Das Handelsgewerbe 227–232
- 232–237 § 26 Die Kaufmannseigenschaft 232–237
- 237–251 II. Die Firma 237–251
- 237–244 § 27 Die Firmenbildung 237–244
- 244–251 § 28 Firmenfortführung und Haftung 244–251
- 251–261 III. Das Handelsregister 251–261
- § 29 Publizitätswirkungen
- 261–277 IV. Handelsgeschäfte 261–277
- 261–268 § 30 Der Handelskauf 261–268
- 268–274 § 31 Guter Glaube an Verfügungsbefugnis des Kaufmanns 268–274
- 274–277 § 32 Kaufmännisches Bestätigungsschreiben; Geschäftsbesorgungsverträge 274–277
- 277–295 V. Hilfspersonen des Kaufmanns 277–295
- 277–284 § 33 Unselbständige Hilfspersonen 277–284
- 284–293 § 34 Selbständige Hilfspersonen 284–293
- 293–295 § 35 Transport- und Lagergeschäfte 293–295
- 295–351 D. Gesellschaftsrecht 295–351
- 295–310 I. BGB-Gesellschaft und Partnerschaft 295–310
- 295–305 § 36 Geschäftsführung und Haftung bei der GbR 295–305
- 305–307 § 37 Haftungsbeschränkung bei der BGB-Gesellschaft 305–307
- 307–310 § 38 Die fehlerhafte Gesellschaft 307–310
- 310–320 II. Die OHG 310–320
- 310–318 § 39 Geschäftsführung und Haftung bei der OHG 310–318
- 318–320 § 40 Wettbewerbsverbote 318–320
- 320–328 III. Die KG 320–328
- 320–326 § 41 Haftung bei der KG 320–326
- 326–328 § 42 Erwerb der Kommanditistenstellung 326–328
- 328–342 IV. Die GmbH 328–342
- 328–331 § 43 Organe der GmbH 328–331
- 331–340 § 44 Gründungsphasen und Haftung bei der GmbH 331–340
- 340–342 § 45 Sicherung des Stammkapitals 340–342
- 342–351 V. Die AG 342–351
- 342–347 § 46 Organe der AG 342–347
- 347–351 § 47 Personalkredit in Konzernbeziehungen 347–351
- 351–353 Literaturhinweise 351–353
- 353–359 Stichwortverzeichnis 353–359
- 359–359 Impressum 359–359