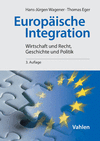Europäische Integration
Wirtschaft und Recht, Geschichte und Politik
Zusammenfassung
Dieses erfolgreiche Lehrbuch stellt die Ökonomie in der Europäischen Union im Kontext der rechtlichen, sozialen, politischen und geschichtlichen Zusammenhänge dar. Die Autoren erschließen damit die Komplexität eines historisch einmaligen Projekts – der Europäischen Integration.
Die Neuauflage ist vollständig überarbeitet. Sie geht auf die Krise der Währungsunion ein, die erste ernsthafte Prüfung des europäischen Finanzsystems und damit auch der Euro-Staaten, sowie auf die Bemühungen die Währungsunion zu reformieren. Sie berücksichtigt außerdem die institutionellen Veränderungen und Neuerungen der letzten Jahre. Der Text ist substantiell gekürzt, um den Strukturen und gestrafften Lehrplänen der Bachelor- und Master-Studiengänge entgegenzukommen.
Inhalt
• Integrationstheorie
• Evolution der Europäischen Union
• Prinzipien der Integration: Wirtschaftsordnung und Entscheidungsstrukturen
• Der Gemeinsame Markt und seine politische und rechtliche Unterstützung
• Die EU als Umverteilungsmechanismus
• Die Währungsunion und ihre Reformen
Professor em. Dr. Hans-Jürgen Wagener hat Volkswirtschaftslehre an der Rijksuniversiteit Groningen und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gelehrt.
Professor Dr. Thomas Eger lehrt Recht und Ökonomie an der Universität Hamburg.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–42 Kapitel 1 Europa und Integration: Davon handelt das Buch 13–42
- 13–22 1.1 Europa – ein Kontinent, eine Geschichte, eine Kultur? 13–22
- 22–42 1.2 Integration – Einheit und Vielfalt 22–42
- 42–82 Kapitel 2 Die Evolution der Europäischen Integration 42–82
- 42–65 2.1 Modelle und Etappen der Europäischen Integration 42–65
- 65–82 2.2 Erweiterungen: Wer ist drin und wer steht draußen? 65–82
- 82–116 Kapitel 3 Prinzipien der Integration: Verfassung und Wirtschaftsordnung 82–116
- 82–85 3.1 Der politische Charakter der EU 82–85
- 85–96 3.2 Primäres Gemeinschaftsrecht: die Verträge 85–96
- 96–98 3.3 Sekundäres Gemeinschaftsrecht und die integrationsfördernde Rolle des Europäischen Gerichtshofs 96–98
- 98–102 3.4 Grundlegende EuGH-Entscheidungen zur Reichweite des Gemeinschaftsrechts 98–102
- 102–107 3.5 Zuständigkeit der Gemeinschaft – wie der Ökonom sie gern hätte 102–107
- 107–112 3.6 Zuständigkeiten der Gemeinschaft – wie sie sich tatsächlich entwickeln 107–112
- 112–116 3.7 Wie aktiv ist die EU-Wirtschaftspolitik? 112–116
- 116–142 Kapitel 4 Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse: die Institutionen der Union 116–142
- 116–118 4.1 Institutions matter 116–118
- 118–140 4.2 Die Organe im einzelnen 118–140
- 140–142 4.3 Gute Regierung – schlechte Regierung 140–142
- 142–183 Kapitel 5 Der Gemeinsame Markt: Güter und Dienstleistungen 142–183
- 142–149 5.1 Zur Theorie der Zollunion 142–149
- 149–151 5.2 Der Binnenmarkt in der Praxis: Die vier Grundfreiheiten 149–151
- 151–165 5.3 Der freie Warenverkehr 151–165
- 165–183 5.4 Dienstleistungsfreiheit 165–183
- 183–229 Kapitel 6 Der Gemeinsame Markt: Produktionsfaktoren (unter Mitarbeit von Herbert Brücker) 183–229
- 183–184 6.1 Freier Güterverkehr und freier Verkehr der Produktionsfaktoren 183–184
- 184–207 6.2 Der freizügige Personenverkehr 184–207
- 207–229 6.3 Kapitalverkehrsfreiheit 207–229
- 229–269 Kapitel 7 Wettbewerbspolitik – der Ordnungshüter 229–269
- 229–232 7.1 Wettbewerbspolitik – braucht man so etwas? 229–232
- 232–240 7.2 Kartellverbot (Art. 101 AEUV) 232–240
- 240–246 7.3 Missbrauchsaufsicht (Art. 102 AEUV) 240–246
- 246–253 7.4 Fusionskontrolle 246–253
- 253–261 7.5 Öffentliche Unternehmen und „Daseinsvorsorge“ (Art. 106 AEUV) 253–261
- 261–269 7.6 Beihilfenkontrolle (Art. 107 – 109 AEUV) 261–269
- 269–302 Kapitel 8 Welche Politik braucht der Gemeinsame Markt? 269–302
- 269–272 8.1 Nationale Wirtschaftspolitik – Europäische Wirtschaftspolitik 269–272
- 272–280 8.2 Handelspolitik: Europa in der Welt 272–280
- 280–290 8.3 Industriepolitik 280–290
- 290–294 8.4 Transportpolitik – wenn es denn unbedingt sein muss 290–294
- 294–302 8.5 Auch die Umwelt ist ein Gemeinschaftsziel 294–302
- 302–363 Kapitel 9 Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union 302–363
- 302–304 9.1 EU-Finanzpolitik 302–304
- 304–316 9.2 Der Haushalt der Union: Was kostet Brüssel und was bietet es? 304–316
- 316–335 9.3 Agrarpolitik – eine Altlast? 316–335
- 335–354 9.4 Die soziale Dimension Europas 335–354
- 354–363 9.5 Strukturpolitik 354–363
- 363–394 Kapitel 10 Von der D-Mark zum Euro: Währungsintegration 363–394
- 363–367 10.1 Elementare Zusammenhänge: Währungssystem, Zahlungsbilanz und ökonomische Aktivität 363–367
- 367–369 10.2 Alles oder nichts: die Anfänge europäischer Währungsintegration 367–369
- 369–376 10.3 Das Europäische Währungssystem (EWS) und seine Entwicklung 369–376
- 376–380 10.4 Die Theorie des optimalen Währungsraums 376–380
- 380–386 10.5 Die Währungsunion à la Maastricht 380–386
- 386–390 10.6 Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) 386–390
- 390–394 10.7 Der Euro und die Welt 390–394
- 394–435 Kapitel 11 Wirtschaftspolitik für die Währungsunion 394–435
- 394–398 11.1 Wirtschaftsunion: Gipfel der ökonomischen Integration oder Begleiterscheinung der Währungsunion? 394–398
- 398–407 11.2 Wirtschaftspolitik in der Wirtschafts- und Währungsunion 398–407
- 407–415 11.3 Die Politik der Europäischen Zentralbank 407–415
- 415–422 11.4 Fiskalpolitik in der Währungsunion 415–422
- 422–425 11.5 Angebotspolitik in der EWWU 422–425
- 425–432 11.6 Reformen der Währungsunion 425–432
- 432–435 11.7 Die Wirtschafts- und Währungsunion – eine Erfolgsstory? 432–435
- 435–445 Kapitel 12 Ausblicke 435–445
- 435–437 12.1 Denkpause oder Ende der Vorstellung? 435–437
- 437–440 12.2 Integration – wie weit? 437–440
- 440–445 12.3 Anspruch und Wirklichkeit 440–445
- 445–460 Literaturverzeichnis 445–460
- 460–467 Sachverzeichnis 460–467
- 467–467 Impressum 467–467