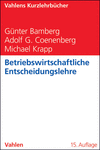Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre
Zusammenfassung
Vorteile
- Ein Lehr- und Lernbuch für einen einführenden Kurs in die Entscheidungstheorie
- Mit zahlreichen Aufgaben und Lösungen
Zum Werk
In Unternehmen werden und müssen Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen zum Teil große Konsequenzen auf die eigene Geschäftstätigkeit haben können.
Dieses Lehrbuch führt den Leser in die Entscheidungstheorie ein und stellt Entscheidungen bei Sicherheit, Risiko und Unsicherheit ausführlich dar. Es erläutert die Grundbegriffe der Spieltheorie ebenso wie die der dynamischen Programmierung.
Autoren
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Günter Bamberg war Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Universität Augsburg.
Prof. em. Dr. Dres. h.c. Adolf G. Coenenberg war Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung und Controlling, an der Universität Augsburg.
Prof. Dr. Michael Krapp ist Extraordinarius für Quantitative Methoden an der Universität Augsburg.
Zielgruppe
Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien.
- 1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
- 13–25 1. Erkenntnisziele der Entscheidungstheorie 13–25
- 13–17 1.1 Präskriptive Entscheidungstheorie 13–17
- 17–23 1.2 Deskriptive Entscheidungstheorie 17–23
- 23–25 1.3 Die Entscheidungstheorie als Grundlage der Betriebswirtschaftslehre 23–25
- 25–53 2. Das Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre 25–53
- 25–27 2.1 Modellbegriff 25–27
- 27–44 2.2 Das Entscheidungsfeld 27–44
- 44–50 2.4 Messtheoretische Aspekte und Rationalitätspostulate 44–50
- 50–53 2.5 Klassifikation von Entscheidungsmodellen 50–53
- 53–78 3. Entscheidungen bei Sicherheit 53–78
- 53–54 3.1 Sicherheitssituationen 53–54
- 54–57 3.2 Entscheidungen bei einer Zielsetzung 54–57
- 57–64 3.3 Entscheidungen bei mehreren Zielsetzungen 57–64
- 64–69 3.4 Spezielle Entscheidungsregeln für multikriterielle Entscheidungsprobleme 64–69
- 69–75 3.5 Sonstige Lösungsmöglichkeiten für multikriterielle Probleme 69–75
- 75–78 3.6 Aufgaben 75–78
- 78–120 4. Entscheidungen bei Risiko 78–120
- 78–80 4.1 Risikosituationen 78–80
- 80–82 4.2 Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Umfeldzustände 80–82
- 82–90 4.3 Das Bernoulli-Prinzip 82–90
- 90–92 4.4 Empirische Ermittlung des Bernoulli-Nutzens 90–92
- 92–95 4.5 Diskussion einiger Nutzenfunktionen 92–95
- 95–98 4.6 Risikoprämien und Arrow-Pratt-Maß für die Risikoaversion 95–98
- 98–102 4.7 Begründung des Bernoulli-Prinzips 98–102
- 102–108 4.8 Klassische Entscheidungsprinzipien 102–108
- 108–111 4.9 Welche Präferenzen berücksichtigt das Bernoulli-Prinzip? 108–111
- 111–115 4.10 Stochastische Dominanz 111–115
- 115–117 4.11 Kritische Zusammenfassung 115–117
- 117–120 4.12 Aufgaben 117–120
- 120–134 5. Entscheidungen bei Ungewissheit 120–134
- 120–121 5.1 Ungewissheitssituationen 120–121
- 121–123 5.2 Möglichkeiten zur Lösung von Ungewissheitssituationen 121–123
- 123–129 5.3 Spezielle Entscheidungsregeln 123–129
- 129–132 5.4 Kritische Zusammenfassung 129–132
- 132–134 5.5 Aufgaben 132–134
- 134–166 6. Entscheidungen bei variabler Informationsstruktur 134–166
- 134–139 6.1 Entscheidungsregeln; LPI-Modelle 134–139
- 139–143 6.2 Informationsbeschaffungsaktionen bei vollkommenen Informationssystemen 139–143
- 143–147 6.3 Informationsbeschaffungsaktionen bei unvollkommenen Informationssystemen; Information durch Stichproben 143–147
- 147–152 6.4 Bayes-Analyse 147–152
- 152–154 6.5 Die allgemeine Entscheidungssituation bei Informationsbeschaffungsmöglichkeiten 152–154
- 154–162 6.6 Informations-Asymmetrie und Prinzipal-Agent-Ansätze 154–162
- 162–166 6.7 Aufgaben 162–166
- 166–221 7. Entscheidungen bei bewusst handelnden Gegenspielern 166–221
- 166–167 7.1 Spielsituationen 166–167
- 167–179 7.2 Klassifikation und grundlegende Definitionen 167–179
- 179–189 7.3 Zweipersonennullsummenspiele 179–189
- 189–202 7.4 Allgemeine nichtkooperative Zweipersonenspiele 189–202
- 202–210 7.5 Allgemeine kooperative Zweipersonenspiele 202–210
- 210–217 7.6 Kooperative N-Personenspiele 210–217
- 217–218 7.7 Kritische Zusammenfassung 217–218
- 218–221 7.8 Aufgaben 218–221
- 221–242 8. Entscheidungen durch Entscheidungsgremien 221–242
- 221–226 8.1 Probleme einer gerechten Aggregation individueller Präferenzen 221–226
- 226–229 8.2 Das Unmöglichkeitstheorem von Arrow 226–229
- 229–233 8.3 Modifizierung der Forderungen des Unmöglichkeitstheorems 229–233
- 233–236 8.4 Traditionelle Entscheidungsverfahren 233–236
- 236–239 8.5 Strategisches Verhalten 236–239
- 239–242 8.6 Aufgaben 239–242
- 242–266 9. Mehrstufige Entscheidungen 242–266
- 242–243 9.1 Mehrstufige Entscheidungen 242–243
- 243–247 9.2 Klassifikation und grundlegende Definitionen 243–247
- 247–254 9.3 Mehrstufige Entscheidungen bei Sicherheit 247–254
- 254–261 9.4 Mehrstufige Entscheidungen bei Risiko 254–261
- 261–266 9.5 Aufgaben 261–266
- 266–290 Lösungen zu den Aufgaben 266–290
- 290–314 Literaturverzeichnis 290–314
- 314–318 Stichwortverzeichnis 314–318
- 318–318 Impressum 318–318