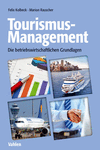Tourismus-Management
Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen
Zusammenfassung
Vorteile
- Umfassendes Grundlagenwerk zur touristischen Betriebswirtschaftslehre
- Im deutschsprachigen Bereich ohne Beispiel
- Abdeckung aller wesentlichen Funktionsbereiche des Tourismus-Managements
- Eignung für Studierende und Praktiker
- Zahlreiche Praxis-Kurzbeiträge von Führungskräften
Zum Werk
Die Tourismusbranche gehört zu den am stärksten wachsenden, aber auch komplexesten Wirtschaftsbereichen.
Dieses Werk vermittelt erstmalig ein umfassendes betriebswirtschaftliches Grundwissen für die Tourismusbranche für Studium und Praxis, das alle wesentlichen Bereiche der Betriebswirtschaftslehre abdeckt. Es unterstützt Studierende und Praktiker bei der Entwicklung einer betriebswirtschaftlichen Denkhaltung, die sinnvolles aktives Handeln („Management“) im touristischen Geschäft ermöglicht.
Das Buch beschreibt auf der Basis eines integrierten Management-Modells Investition und Finanzierung, Beschaffung, Produktion und Marketing sowie die Managementprozesse Planung, Steuerung, Personalmanagement und Organisation. Den Abschluss bilden langfristige Überlegungen zur strategischen Unternehmensführung sowie zum nachhaltigen Tourismusmanagement.
Zahlreiche Experten-Statements von Führungskräften aus der Branche illustrieren die Praxisrelevanz.
Autoren
Prof. Dr. Felix Kolbeck und Prof. Dr. Marion Rauscher, Fakultät für Tourismus, Hochschule München
Zielgruppe
- Studierende der Bachelor-Studiengänge Tourismusmanagement, Masterstudiengänge, Weiterbildungsangebote (IHK, MBA, …) und Tourismusunternehmen.
- 1–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–18
- 19–87 1. Grundlagen: Betriebswirtschaftslehre und Tourismus 19–87
- 19–29 1.1 Betriebswirtschaftslehre: Kaufmännisches Denken und Handeln lernen 19–29
- 19–22 1.1.1 Kurze Geschichte der Betriebswirtschaftslehre 19–22
- 22–23 1.1.2 Abgrenzung zur Volkswirtschaftslehre 22–23
- 23–24 1.1.3 Einordnung der Managementlehre 23–24
- 24–26 1.1.4 Wie „lernt man BWL" im Studium? 24–26
- 26–29 1.1.5 Stimmen aus dem Studium 26–29
- 29–39 1.2 Tourismus: Die Sehnsucht nach Traumstränden und -renditen 29–39
- 29–32 1.2.1 Der Wunsch nach Erholung und Erlebnis: Tourismusnachfrage 29–32
- 32–37 1.2.2 Das Geschäft mit der Erholung und dem Erlebnis: Tourismus-Angebot 32–37
- 37–39 1.2.3 Tourismusmärkte 37–39
- 39–50 1.3 Tourismusmanagement: Handlungsfelder einer Betriebswirtschaftslehre des Tourismus 39–50
- 39–41 1.3.1 Betriebswirtschaftliches Denken im touristischen Alltag 39–41
- 41–45 1.3.2 Ein integrierter Ansatz für das Tourismusmanagement 41–45
- 45–47 1.3.3 Tourismusmanagement und Tourismusökonomie 45–47
- 47–50 1.3.4 Betriebswirtschaft und Tourismusmanagement in der Lehre 47–50
- 50–63 1.4 Ordnungspolitischer Rahmen: Wirtschaftsordnung und Tourismuspolitik 50–63
- 50–52 1.4.1 Fallbeispiel: Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) 50–52
- 52–54 1.4.2 Allgemeine Tourismuspolitik 52–54
- 54–61 1.4.3 Spezielle Tourismuspolitik 54–61
- 61–63 1.4.4 Stimmen aus der Praxis 61–63
- 63–87 1.5 Unternehmen im Wettbewerb 63–87
- 63–65 1.5.1 Fallbeispiel: Deutsche Bahn AG 63–65
- 65–79 1.5.2 Unternehmen 65–79
- 79–84 1.5.3 Wirtschaftliches Handeln 79–84
- 84–87 1.5.4 Wettbewerbsvorteile 84–87
- 87–195 2. Funktionsbereiche: Kernelemente touristischer Wertschöpfung 87–195
- 87–116 2.1 Investition und Finanzierung 87–116
- 87–91 2.1.1 Fallbeispiel: Deutsche Lufthansa (1) 87–91
- 91–94 2.1.2 Die betriebliche Finanzwirtschaft 91–94
- 94–103 2.1.3 Investitionsrechnung 94–103
- 103–110 2.1.4 Finanzierung 103–110
- 110–113 2.1.5 Kennzahlen der finanzwirtschaftlichen Analyse 110–113
- 113–116 2.1.6 Stimmen aus der Praxis: Achim von der Lahr, UniCredit Bank AG; Dieter Semmelroth, TUI AG 113–116
- 116–142 2.2 Beschaffung 116–142
- 116–118 2.2.1 Fallbeispiel: Deutsche Lufthansa (2) 116–118
- 118–120 2.2.2 Überblick: Zu beschaffende Güter und Dienstleistungen im Tourismus 118–120
- 120–121 2.2.3 Investitionsgüterbeschaffung 120–121
- 121–129 2.2.4 Materialbeschaffung und Wareneinkauf 121–129
- 129–131 2.2.5 Dienstleistungsbeschaffung 129–131
- 131–133 2.2.6 Touristischer Leistungsträgereinkauf 131–133
- 133–139 2.2.7 Eine zentrale Frage im Tourismus: Selber produzieren oder fremd beziehen? 133–139
- 139–142 2.2.8 Stimmen aus der Praxis: Heike Pabst, FTI Touristik GmbH 139–142
- 142–169 2.3 Produktion 142–169
- 142–145 2.3.1 Fallbeispiel: Touropa – TUI – Touropa 142–145
- 145–155 2.3.2 Produktionsprozesse 145–155
- 155–163 2.3.3 Grundlegende Elemente der Produktionstheorie 155–163
- 163–165 2.3.4 Produktionsstandorte im Tourismus 163–165
- 165–169 2.3.5 Stimmen aus der Praxis: Marcus Minzlaff, TUI Deutschland GmbH 165–169
- 169–195 2.4 Marketing 169–195
- 169–172 2.4.1 Fallbeispiel: weg.de 169–172
- 172–175 2.4.2 Grundlagen des Marketing 172–175
- 175–182 2.4.3 Der Marketing-Prozess 175–182
- 182–193 2.4.4 Der Marketing-Mix 182–193
- 193–195 2.4.5 Stimmen aus der Praxis: Katrin Köhler, Comvel GmbH; Burkhard von Freyberg, Zarges von Freyberg Hotel Consulting 193–195
- 195–295 3. Managementprozesse: Lenken und Entscheiden im Tourismus 195–295
- 195–220 3.1 Planung 195–220
- 195–200 3.1.1 Fallbeispiel: Carnival Corporation & plc 195–200
- 200–202 3.1.2 Grundlegende Begriffe zur Planung 200–202
- 202–210 3.1.3 Strategische Planung 202–210
- 210–215 3.1.4 Operative Planung 210–215
- 215–216 3.1.5 Grenzen der Planung im Tourismus 215–216
- 216–220 3.1.6 Stimmen aus der Praxis: Dr. Michael Frenzel, TUI AG 216–220
- 220–249 3.2 Rechnungswesen und Controlling 220–249
- 220–222 3.2.1 Fallbeispiel: airberlin 220–222
- 222–225 3.2.2 Überblick: Financial Management 222–225
- 225–233 3.2.3 Elemente der externen Rechnungslegung 225–233
- 233–242 3.2.4 Elemente des internen Rechnungswesens 233–242
- 242–245 3.2.5 Kennzahlen der bilanziellen und erfolgswirtschaftlichen Analyse 242–245
- 245–249 3.2.6 Stimmen aus der Praxis: Susanne Wübbeling, Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 245–249
- 249–274 3.3 Personalmanagement 249–274
- 249–251 3.3.1 Fallbeispiel: Schindlerhof 249–251
- 251–252 3.3.2 Begriffsabgrenzung und Zieldefinition 251–252
- 252–265 3.3.3 Aufgaben der Personalwirtschaft 252–265
- 265–271 3.3.4 Personalführung 265–271
- 271–274 3.3.5 Stimmen aus der Praxis: Andreas Graeber-Stuch, Eckelmann Hotels KG 271–274
- 274–295 3.4 Organisation 274–295
- 274–277 3.4.1 Fallbeispiel: Best Western 274–277
- 277–282 3.4.2 Organisationsbegriff und Elemente der Organisation 277–282
- 282–291 3.4.3 Organisationsformen 282–291
- 291–293 3.4.4 Weitergehende Organisationstheorien 291–293
- 293–295 3.4.5 Stimmen aus der Praxis: Philipp Bessler, Treugast Unternehmensberatung 293–295
- 295–339 4. Werte und Strategien: Fragen nach Sinn, Wegen und Verantwortung im Tourismus 295–339
- 295–310 4.1 Unternehmensidentität und Unternehmenspolitik 295–310
- 295–300 4.1.1 Grundlage: Normatives Management 295–300
- 300–305 4.1.2 Unternehmensidentität 300–305
- 305–310 4.1.3 Unternehmenspolitik 305–310
- 310–325 4.2 Strategisches Management 310–325
- 310–312 4.2.1 Instrumentalcharakter und Ebenen von Strategien 310–312
- 312–319 4.2.2 Grundlegende Strategietypen 312–319
- 319–325 4.2.3 Wachstumsstrategien 319–325
- 325–339 4.3 Nachhaltiges Tourismusmanagement 325–339
- 325–328 4.3.1 Begriffe im Kontext unternehmerischer Nachhaltigkeit 325–328
- 328–329 4.3.2 Nachhaltiges Management 328–329
- 329–334 4.3.3 Nachhaltigkeit im Kontext des Tourismus 329–334
- 334–335 4.3.4 Elemente eines nachhaltigen Tourismusmanagements 334–335
- 335–339 4.3.5 Stimmen aus der Praxis: Peter-Mario Kubsch, Studiosus Reisen München GmbH 335–339
- 339–349 Stichwortverzeichnis 339–349
- 349–349 Impressum 349–349