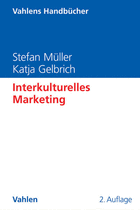Interkulturelles Marketing
Zusammenfassung
Vorteil
- Konzentration auf das Wesentliche
- Einsatz der Marketing-Instrumente in den verschiedenen Kulturkreisen
- »absolut empfehlens- und lesenswert« Thexis, zur 1. Auflage
Zum Werk
Menschen in aller Welt tragen Kleidung von Benetton, telefonieren mit iPhones, hören Musik aus MP3-Playern von Sony, kaufen Ikea-Möbel, trinken Kaffee bei Starbucks oder fliegen mit Singapore Airlines zum Urlaub in ein Shangri-La-Resort. Trotz der globalen Marken ist jedoch der kosmopolitische Konsument ein Trugbild. Denn Angehörige unterschiedlicher Kulturen unterscheiden sich darin, wie sie Produkte nutzen, wie viel sie dafür zu zahlen bereit sind, wie sie sich informieren, wo sie gerne einkaufen und warum sie ein Produkt kaufen.
Die Unterschiede liegen in der jeweiligen Landeskultur, die grundlegende Werte und damit auch das Kaufverhalten bestimmt. Die Autoren stellen diese Unterschiede in zwei Kapiteln (Verhaltensgrundlagen und Konsumentenverhalten) systematisch dar und erläutern, wie Unternehmen ihren Marketing-Mix anpassen müssen, um Produkte und Dienstleistungen in unterschiedlichen Kulturen erfolgreich verkaufen zu können (= Strategisches Marketing). Es folgen interkulturelle Marktforschung sowie die interkulturelle Produkt-, Kommunikations-, Distributions- und Preispolitik.
Zur Neuauflage
Die Neuauflage behandelt neben dem Strategischen Marketing (Kapitel C der 1. Auflage) den Marketing-Mix aus interkultureller Sicht (Kapitel D der 1. Auflage).
Im Vergleich zur ersten Auflage ist der Grundlagenteil wesentlich gestrafft und um zwei Kulturkonzepte erweitert, die in der kulturvergleichenden Forschung eine zunehmend wichtige Rolle spielen: die Schwartz Value Survey sowie die GLOBE-Studie. Grundlegend überarbeitet wurde auch das Kapitel interkulturelle Marktforschung. Den Schwerpunkt der zweiten Auflage bilden jedoch die vier Marketing-Instrumente.
Autoren
Prof. em. Dr. Stefan Müller, Dresden, und Prof. Dr. Katja Gelbrich, Eichstätt-Ingolstadt
Zielgruppe
Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen.
- I–XXIII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXIII
- 2–74 Teil A Marketing, Globalisierung & Kultur 2–74
- 2–28 1 Einführung 2–28
- 1.1 Anmerkungen zum Verhältnis von Marketing & Kultur
- 1.2 Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen
- 1.2.1 Entwicklungsphasen des Welthandels
- 1.2.2 Erfolgsgeschichte des „Made in Germany“
- 1.2.2.1. Überblick
- 1.2.2.2. Geographische Lage
- 1.2.2.3. Global Player & Hidden Champions
- 1.2.3 Allgemeine Distanzhypothese
- 1.2.4 Globales Paradoxon
- 1.3 Erscheinungsformen von Kultur
- 1.3.1 Kultur
- 1.3.2 Interkultur
- 1.3.3 Weitere Abgrenzungen
- 1.3.3.1. Überblick
- 1.3.3.2. Multiple Kultur
- 1.3.3.3. Relationale Kultur
- 1.3.3.4. Subjektive Kultur
- 1.4 Von der Schwierigkeit, das Konstrukt „Kultur“ zu definieren
- 1.4.1 Wissenschaftstheoretische Überlegungen
- 1.4.2 Natur vs. Kultur
- 1.4.3 Deskriptive vs. explikative Definitionen
- 1.4.4 Landeskultur
- 1.4.5 Enkulturation vs. Akkulturation
- 1.5 Überblick über das Buch
- 27–36 2 Vorläufer des Interkulturellen Marketing & verwandte Wissenschaften 27–36
- 2.1 Sozialwissenschaftliche Vorläufer & verwandte Wissenschaften
- 2.2 Kulturwissenschaftliche Vorläufer & verwandte Wissenschaften
- 2.2.1 Überblick
- 2.2.2 Forschungsstrategien
- 2.3 Wirtschaftswissenschaftliche Vorläufer & verwandte Wissenschaften
- 2.3.1 Exportwirtschaftslehre
- 2.3.2 Exportmarketing
- 2.3.3 Internationales Marketing
- 2.3.4 Globales Marketing
- 36–43 3 Phasen & Formen der Auseinandersetzung der Betriebswirtschaftslehre mit dem Phänomen „Kultur“ 36–43
- 3.1 Phase der Kulturignoranz
- 3.2 Phase der großen Debatten
- 3.2.1 Kulturalismus/Universalismus-Debatte
- 3.2.2 Standardisierungs/Differenzierungs-Debatte
- 3.3 Phase des Kulturschocks
- 3.4 Phase der Akzeptanz & Koexistenz
- 3.4.1 Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen
- 3.4.2 Paradigmenwechsel
- 3.4.3 Forschungsfelder
- 43–63 4 Kultursensibles Marketing: ein Überblick 43–63
- 4.1 Zur Verhaltensrelevanz des kulturellen Umfeldes
- 4.1.1 Entscheidungen & Verhalten von Managern
- 4.1.2 Entscheidungen & Verhalten von Konsumenten
- 4.2 Interkulturelles Marketing
- 4.2.1 Globales Dorf
- 4.2.2 Differenzierte Standardisierung: ein Ausweg aus dem Standardisierungs/Differenzierungsdilemma
- 4.2.3 Erkenntnistheoretisches Anliegen
- 4.3 Intrakulturelles Marketing
- 4.3.1 Überblick
- 4.3.2 Interregionales Marketing
- 4.3.3 Ethno-Marketing
- 4.3.3.1. Ethnische Heterogenität
- 4.3.3.2. Ethno-Marketing in Deutschland
- 4.3.4 Subkulturen-Marketing
- 63–68 5 Interkulturelles Management 63–68
- 5.1 Überblick
- 5.2 Unternehmenskultur
- 5.3 Branchenkultur
- 5.4 Third Culture
- 68–74 6 Subjektive Kultur: Individualisierung der kulturvergleichenden Forschung 68–74
- 6.1 Ein Kurzschluss
- 6.2 Forschungsstrategien des empirischen Kulturvergleichs im Überblick
- 6.3 Ein Beispiel
- 6.3.1 Analyseeinheit Individuum
- 6.3.2 Analyseeinheit Land
- 6.3.3 Analyseebene Land & Individuum
- 75–193 Teil B Theorien & Messkonzepte 75–193
- 75–90 1 Einführung 75–90
- 1.1 Überblick
- 1.2 Qualitative Erklärungsansätze
- 1.2.1 Orientierungen
- 1.2.2 Schichtenmodelle
- 1.2.2.1. Kulturzwiebel, Kultureisberg & andere Schichtenmodelle
- 1.2.2.2. Concepta/Percepta-Modell
- 1.2.2.3. Implizite vs. explizite Kultur
- 1.2.3 Modell der Kulturstandards
- 1.3 Quantitative Erklärungsansätze
- 1.3.1 Konzept der Kulturdimensionen
- 1.3.2 Kritische Würdigung
- 89–156 2 Hofstede-Studie 89–156
- 2.1 Konzeption & theoretischer Hintergrund
- 2.1.1 Ursprungsstudie
- 2.1.1.1. Theoretischer Hintergrund
- 2.1.1.2. Operationalisierung & Studiendesign
- 2.1.1.3. Analyse
- 2.1.2 Folgestudien
- 2.2 Hofstedes Kulturdimensionen im Überblick
- 2.2.1 Individualismus vs. Kollektivismus
- 2.2.1.1. Sonderstellung innerhalb der kulturvergleichenden Forschung
- 2.2.1.2. Ideengeschichte
- 2.2.2 Akzeptanz von Machtdistanz
- 2.2.2.1. Grundlagen
- 2.2.2.2. Regionale & nationale Unterschiede
- 2.2.3 Ungewissheitsvermeidung
- 2.2.3.1. Grundlagen
- 2.2.3.2. Regionale & nationale Unterschiede
- 2.2.4 Feminine vs. maskuline Orientierung
- 2.2.4.1. Grundlagen
- 2.2.4.2. Regionale & nationale Unterschiede
- 2.2.4.3. Jantes Gesetz
- 2.2.5 Fünfte Kulturdimension
- 2.2.5.1. Konfuzianische Dynamik
- 2.2.5.2. Langfristige vs. kurzfristige Orientierung
- 2.2.5.3. Pragmatische vs. normative Orientierung
- 2.2.6 Genussorientierung vs. Selbstbeherrschung
- 2.2.7 Deutschlands Kulturprofil
- 2.3 Auswirkungen der Landeskultur auf das Arbeits- & Sozialleben
- 2.3.1 Überblick
- 2.3.2 Auswirkungen von Individualismus & Kollektivismus
- 2.3.2.1. Bedeutung für das soziale Leben
- 2.3.2.2. Bedeutung für das Arbeitsleben
- 2.3.3 Auswirkungen der Akzeptanz von Machtdistanz
- 2.3.3.1. Bedeutung für das soziale Leben
- 2.3.3.2. Bedeutung für das Arbeitsleben
- 2.3.4 Auswirkungen der Tendenz zur Ungewissheitsvermeidung
- 2.3.4.1. Bedeutung für das soziale Leben
- 2.3.4.2. Bedeutung für das Arbeitsleben
- 2.3.5 Auswirkungen von Feminität vs. Maskulinität
- 2.3.5.1. Bedeutung für das soziale Leben
- 2.3.5.2. Bedeutung für das Arbeitsleben
- 2.4 Kritische Würdigung
- 2.4.1 Grundsätzliche Bedeutung des Hofstede-Kulturmodells
- 2.4.2 Stärken & Schwächen der ersten Auflage von „Culture’s Consequences“
- 2.4.2.1. Zitationsanalysen
- 2.4.2.2. Rezensionen
- 2.4.2.3. Methodenkritik
- 2.4.3 Stärken & Schwächen der zweiten Auflage von „Culture’s Consequences“
- 2.4.3.1. Stärken
- 2.4.3.2. Schwächen
- 2.4.4 Dritte Auflage von „Cultures and Organizations“
- 2.4.5 Überprüfung & Reformulierung des Hofstede-Konzepts
- 2.4.5.1. Interdependenzen einzelner Kulturdimensionen
- 2.4.5.2. Reskalierung der Kulturdimensionen
- 2.4.6 Eine Ehrenrettung
- 2.5 Horizontaler vs. vertikaler Individualismus-Kollektivismus: Weiterentwicklung des Individualismus/Kollektivismus-Konzepts
- 2.5.1 Abhängiges vs. unabhängiges Selbstkonzept
- 2.5.2 Horizontale vs. vertikale Gesellschaftsstruktur
- 156–163 3 Theorie der universellen kulturellen Werte nach Schwartz 156–163
- 3.1 Grundlagen
- 3.2 Modell der zehn universellen Wertetypen
- 3.2.1 Ursprünglicher Wertekreis
- 3.2.2 Validierung
- 3.3 Modell der sieben universellen Werte
- 3.3.1 Revidierter Wertekreis
- 3.3.2 Validierung
- 163–181 4 GLOBE-Kulturstudie 163–181
- 4.1 Überblick & theoretische Grundlagen
- 4.2 Untersuchungsdesign & Datenerhebung
- 4.3 Kulturdimensionen
- 4.4 Kritische Würdigung
- 4.4.1 Werte & Praktiken
- 4.4.2 Unabhängigkeit der Dimensionen
- 4.4.3 Vergleich der Hofstede-Studie mit der GLOBE- Studie
- 4.4.3.1. Konzeptualisierung von Kultur
- 4.4.3.2. Methodische Unterschiede
- 4.4.3.3. Unterschiedliche dimensionale Struktur
- 4.4.3.4. Unterschiedliche empirische Befunde
- 181–193 5 Individuelle Kultur 181–193
- 5.1 Kollektive vs. individuelle Kultur
- 5.2 Idiozentriker vs. Allozentriker
- 5.2.1 Konzeptionalisierung
- 5.2.2 Validierung
- 5.3 Theorie & Operationalisierung
- 5.3.1 Theoretische Grundlagen
- 5.3.1.1. Marketingperspektive
- 5.3.1.2. Wissenschaftstheoretische Perspektive
- 5.3.2 Messansätze
- 5.3.2.1. Eindimensionale Skalen
- 5.3.2.2. Mehrdimensionale Skalen
- 194–280 Teil C Strategisches Marketing 194–280
- 194–220 1 Standardisierung vs. Differenzierung 194–220
- 1.1 Einführung
- 1.2 Internationale Wettbewerbsstrategien
- 1.2.1 Überblick
- 1.2.2 Kostenführerschaft vs. Qualitätsführerschaft
- 1.2.2.1. Überblick
- 1.2.2.2. Einfluss der Landeskultur
- 1.2.3 Standardisierung vs. Differenzierung
- 1.2.3.1. Standardisierungsstrategie
- 1.2.3.2. Differenzierungsstrategie
- 1.2.4 Kritische Anmerkungen zur S/D-Debatte
- 1.2.4.1. Unterschiedliche Ebenen der Argumentation
- 1.2.4.2. Unzureichende theoretische Fundierung
- 1.2.4.3. Methodologische Schwachstellen
- 1.3 Vom S/D-Paradigma zum Global Marketing
- 1.3.1 Ausgangssituation
- 1.3.2 Schlüsselthesen des Global Marketing
- 1.3.2.1. Konvergenz des Nachfrageverhaltens
- 1.3.2.2. Standardisierung des Marketing
- 1.3.2.3. Zentralisation der Geschäftstätigkeit
- 1.3.2.4. Kosten- & Preisvorteil
- 1.3.3 Kritische Würdigung
- 1.3.3.1. Theoretisch begründbare Kritik
- 1.3.3.2. Reale Fehlschläge
- 1.3.3.3. Ursachen der Fehlschläge
- 219–227 2 Kontingenzansatz 219–227
- 2.1 Grundidee
- 2.2 Arten von Kontingenzvariablen
- 2.2.1 Makroökonomische Variablen
- 2.2.2 Mikroökonomische Variablen
- 2.2.3 Unternehmensinterne Variablen
- 2.2.4 Produktmerkmale
- 2.3 Zentrale Bedeutung der Kontingenzvariable „Kultur“
- 2.3.1 Überblick
- 2.3.2 Messbarkeit & Kontrollierbarkeit der Kontingenzvariablen
- 2.3.3 Stabilität
- 227–280 3 Strategie der Differenzierten Standardisierung 227–280
- 3.1 Vorgehensweise
- 3.1.1 Identifikation geeigneter Zielgruppen
- 3.1.1.1. Homogene Kulturcluster
- 3.1.1.2. Transnationale Zielgruppen
- 3.1.2 Standardisierung & Differenzierung des Marketingmix
- 3.2 Identifikation homogener Cluster
- 3.2.1 A Priori-Cluster: der qualitative Ansatz
- 3.2.1.1. Geographische Segmentierung
- 3.2.1.2. Soziokulturelle Segmentierung
- 3.2.2 Ex Post-Cluster: der quantitative Ansatz
- 3.2.2.1. Segmentierungsmethoden
- 3.2.2.2. Traditionelle Segmentierungskriterien
- 3.2.3 Kulturcluster
- 3.2.3.1. Kulturcluster auf der Basis von Hofstede
- 3.2.3.2. Kulturcluster auf der Basis von GLOBE
- 3.2.3.3. Religions-, Konfessions- & Kulturcluster
- 3.3 Identifikation transnationaler Zielgruppen
- 3.3.1 Besonderheiten transnationaler Zielgruppen
- 3.3.2 Segmentierungsmethoden
- 3.3.2.1. Soziodemographische Segmentierung
- 3.3.2.2. Psychographische Segmentierung
- 3.3.2.3. Verhaltensorientierte Segmentierung
- 3.3.2.4. Benefit-Segmentierung
- 3.3.2.5. Means End-Segmentierung
- 281–388 Teil D Produktpolitik 281–388
- 281–288 1 Besonderheiten der Produktpolitik im interkulturellen Kontext 281–288
- 1.1 Einfluss des Produktnutzens
- 1.2 Einfluss der Zeitwahrnehmung
- 1.3 Einfluss von Konfession & Religiosität
- 1.3.1 Religiosität
- 1.3.2 Konfession
- 287–303 2 Standardisierung vs. Differenzierung 287–303
- 2.1 Stand der Forschung
- 2.2 Kulturabhängige vs. kulturfreie Produkte
- 2.2.1 Kulturelle Zentralität
- 2.2.2 Homogenität der Bedürfnisse
- 2.2.3 Tradition
- 2.2.4 Produktkategorie
- 2.2.5 Konsumkontext
- 2.3 Globale vs. lokale Industriezweige
- 2.3.1 Kriterien der Globalität
- 2.3.2 Mythos Globalität
- 2.4 Differenzierte Standardisierung
- 303–320 3 Produktentwicklung & Produktgestaltung 303–320
- 3.1 Forschung + Entwicklung
- 3.1.1 Grundlagen
- 3.1.2 Einfluss der Landeskultur
- 3.2 Produktentwicklung
- 3.2.1 Bedürfnisorientierte Produktentwicklung
- 3.2.1.1. Überblick
- 3.2.1.2. Image/Kongruenz-Hypothese
- 3.2.2 Einfluss der Landeskultur
- 3.3 Gestaltung des Produktumfeldes
- 3.3.1 Farbgestaltung
- 3.3.2 Gebrauchsanleitungen
- 3.3.3 Produktverpackung
- 3.3.3.1. Grundlagen
- 3.3.3.2. Einfluss von Landeskultur bzw. Nationalität
- 3.4 Akzeptanz von Produktinnovationen
- 3.5 Markenpiraterie & Produktpiraterie
- 3.5.1 Grundlagen
- 3.5.2 Erklärungsansätze
- 3.5.3 Einfluss der Landeskultur
- 320–326 4 Produkteinführung & Diffusion 320–326
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Weltoffenheit & Informationsfluss
- 4.3 Einfluss der Landeskultur
- 4.3.1 Kontextabhängigkeit
- 4.3.2 Individualismus vs. Kollektivismus
- 4.3.3 Akzeptanz von Machtdistanz
- 4.3.4 Ungewissheitsvermeidung
- 4.3.5 Maskulinität
- 4.3.6 Kurzfrist- vs. Langfristorientierung
- 4.3.7 Kulturelle Distanz
- 326–386 5 Markierung 326–386
- 5.1 Grundlagen
- 5.1.1 Funktionen der Markierung
- 5.1.2 Funktionen von Marken
- 5.1.2.1. Allgemeine Funktionen
- 5.1.2.2. Kulturspezifische Funktionen
- 5.2 Markentypen
- 5.2.1 Globale Marken
- 5.2.1.1. Funktionen
- 5.2.1.2. Typologie globaler Marken
- 5.2.2 Mega-Marken
- 5.2.3 Kulturelle Marken
- 5.2.4 Handelsmarken
- 5.2.4.1. Grundlagen
- 5.2.4.2. Akzeptanz & Marktanteil
- 5.3 Markenpersönlichkeit
- 5.3.1 Grundlagen
- 5.3.2 Maße der Markenpersönlichkeit
- 5.4 Markenführung
- 5.4.1 Positionierung von Marken
- 5.4.1.1. Einfluss der Produktkategorie
- 5.4.1.2. Einfluss der Zielgruppe
- 5.4.1.3. Einfluss der Konsumsituation
- 5.4.1.4. Einfluss der Konsumbedürfnisse
- 5.4.2 Markenportfolio-Management
- 5.4.2.1. Beitrag des Controlling
- 5.4.2.2. Beitrag des Marketing
- 5.4.3 Markenherkunft
- 5.4.3.1. Country of Origin
- 5.4.3.2. Foreign Branding
- 5.4.4 Markencommitment
- 5.5 Gestaltung des Markennamens
- 5.5.1 Grundlagen
- 5.5.1.1. Informations- & Kommunikationsfunktion
- 5.5.1.2. Konditionierbarkeit von Markennamen
- 5.5.2 Typen von Markennamen
- 5.5.3 Entscheidungskriterien
- 5.5.3.1. Juristische Kriterien
- 5.5.3.2. Marketingkriterien
- 5.5.3.3. Linguistische Kriterien
- 5.5.4 Wirkung von Markennamen
- 5.5.4.1. Grundlagen
- 5.5.4.2. Fremdheit vs. Vertrautheit
- 5.5.4.3. Künstliche vs. sinnhafte Markennamen
- 5.6 Internationalisierung bzw. Globalisierung von Markennamen
- 5.6.1 Handlungsmöglichkeiten
- 5.6.2 Übernahme des originalen Markennamens
- 5.6.3 Übersetzungsstrategien
- 5.6.3.1. Semantische Übersetzung
- 5.6.3.2. Transliteration
- 5.6.3.3. Kreation
- 5.6.4 Verfahrensweise der Unternehmen
- 5.6.5 Erfolgskontrolle
- 5.6.6 Entwicklung globaler Markennamen
- 5.6.7 Einfluss der Landeskultur
- 386–388 6 Sortimentspolitik 386–388
- 389–428 Teil E Dienstleistungspolitik 389–428
- 389–395 1 Überblick 389–395
- 1.1 Bedeutung von Dienstleistungen
- 1.2 Merkmale von Dienstleistungen
- 1.2.1 Überblick
- 1.2.2 Dienstleistungen vs. Produkte
- 1.3 Besonderheiten von Dienstleistungen im inter kulturellen Umfeld
- 1.3.1 Dienstleistungsmentalität
- 1.3.2 Leistungsspezifische Besonderheiten
- 394–400 2 Standardisierung vs. Differenzierung 394–400
- 2.1 Standardisierbarkeit von Dienstleistungen
- 2.2 Besonderheiten des Einzelhandels
- 400–407 3 Servicequalität 400–407
- 3.1 Überblick
- 3.2 Wahrgenommene Servicequalität
- 3.3 Kulturelles Umfeld & wahrgenommene Servicequalität
- 3.3.1 Erwartungen & Bedürfnisse
- 3.3.2 Kontrollüberzeugung & Kontrollierbarkeit der Situation
- 3.4 Servicequalität & Kundenzufriedenheit
- 407–411 4 Bereitschaft zur Belohnung von Dienstleistungen 407–411
- 4.1 Überblick
- 4.2 Einfluss der Landeskultur
- 411–428 5 Beschwerdemanagement 411–428
- 5.1 Verhalten vor der Beschwerde
- 5.1.1 Servicefehler
- 5.1.2 Attribution des Servicefehlers
- 5.1.3 Beschwerdeanlass
- 5.1.4 Beschwerdebereitschaft
- 5.1.4.1. Überblick
- 5.1.4.2. Einfluss der Zeitwahrnehmung
- 5.1.4.3. Einfluss von Kollektivismus-Individualismus & Machtdistanz
- 5.1.5 Öffentliche, private & institutionelle Beschwerden
- 5.1.6 Elektronische Beschwerden
- 5.2 Verhalten nach der Beschwerde
- 5.2.1 Überblick
- 5.2.2 Beschwerdebehandlung
- 5.2.2.1. Auswirkungen einer Beschwerdekultur
- 5.2.2.2. Auswirkungen einer Entschuldigung
- 5.2.2.3. Auswirkungen einer Kompensation
- 5.2.3 Antezedenzen von Beschwerdezufriedenheit
- 5.2.3.1. Emotionale Reaktionen
- 5.2.3.2. Wahrgenommene Gerechtigkeit
- 429–576 Teil F Distributionspolitik 429–576
- 429–431 1 Besonderheiten der Distribution im interkulturellen Kontext 429–431
- 430–430 2 Standardisierung vs. Differenzierung 430–430
- 430–500 3 Erschließung ausländischer Märkte 430–500
- 3.1 Überblick
- 3.2 Auswahl geeigneter Ländermärkte
- 3.2.1 Heuristische Marktauswahlverfahren
- 3.2.1.1. Checklist-Verfahren
- 3.2.1.2. Filterverfahren
- 3.2.1.3. Portfolio-Verfahren
- 3.2.2 Analytische Verfahren
- 3.2.3 Subjektive Einflussfaktoren
- 3.3 Markteintrittsbarrieren
- 3.3.1 Distanz zwischen Herkunftsland & Auslandsmarkt
- 3.3.1.1. Strömungen der Distanzforschung
- 3.3.1.2. Distanzmaße
- 3.3.1.3. Validität
- 3.3.2 Kulturelle Feindseligkeit
- 3.3.3 Protektionismus
- 3.3.3.1. Erscheinungsformen
- 3.3.3.2. Ursachen des Protektionismus
- 3.3.4 Rechtsunsicherheit
- 3.3.4.1. Ungenügendes Rechtssystem
- 3.3.4.2. Unvertrautes Rechtssystem
- 3.3.4.3. Administrative Handelshemmnisse
- 3.4 Markteintrittsstrategien
- 3.4.1 Überblick
- 3.4.2 Export
- 3.4.2.1. Indirekter Export
- 3.4.2.2. Direkter Export
- 3.4.3 Kooperation
- 3.4.3.1. Theoretische Grundlagen
- 3.4.3.2. Kooperative Markterschließungsstrategien
- 3.4.4 Direktinvestitionen
- 3.4.5 Unternehmenszusammenschlüsse
- 3.4.5.1. Fusionen
- 3.4.5.2. Unternehmenskauf
- 3.5 Präferenz des Managements für bestimmte Markteintrittsstrategien
- 3.5.1 Einfluss des Herkunftslandes des Unternehmens
- 3.5.2 Einfluss der Landeskultur
- 3.5.2.1. Unsicherheitsvermeidung
- 3.5.2.2. Akzeptanz von Machtdistanz
- 3.5.2.3. Einfluss der kulturellen Distanz
- 3.5.3 Einfluss der sprachlichen Distanz
- 3.6 Timing des Markteintritts
- 3.5.1 Basisstrategien
- 3.5.1.1. Wasserfallstrategie
- 3.5.1.2. Sprinklerstrategie
- 3.5.2 Hybride Timing-Strategien
- 3.5.2.1. Brückenkopfstrategie
- 3.5.2.2. Near Market-Strategie
- 3.7 Erfolg des Markteintritts
- 3.7.1 Exportstrategie
- 3.7.1.1. Einfluss des Distributionskanals
- 3.7.1.2. Einfluss der psychischen Distanz
- 3.7.1.3. Einfluss der Marketingstrategie
- 3.7.1.4. Einfluss der Unternehmenskultur
- 3.7.2 Kooperationsstrategie
- 3.7.2.1. Joint Venture
- 3.7.2.2. Strategische Allianz
- 3.7.3 Direktinvestitionen
- 3.7.4 Unternehmenszusammenschlüsse
- 3.7.4.1. Wunsch & Wirklichkeit
- 3.7.4.2. Erfolg & Misserfolg
- 3.8 Besonderheit der Markteintrittsentscheidung von Industriegüterherstellern
- 500–528 4 Distributionsmanagement 500–528
- 4.1 Auswahl des Distributionskanals
- 4.1.1 Überblick
- 4.1.2 Direktvertrieb
- 4.1.2.1. Persönlicher Verkauf
- 4.1.2.2. Fabrikverkauf
- 4.1.2.3. Versandhandel
- 4.1.2.4. E-Commerce
- 4.1.3 Indirekter Vertrieb & Auswahl von Handelspartnern
- 4.2 Kulturintegration
- 4.2.1 Anliegen
- 4.2.2 Cultural Due Diligence
- 4.2.2.1. Grundlagen
- 4.2.2.2. Kultureller Misfit
- 4.2.3 Post Merger-Integration
- 4.2.3.1. Einfluss der Landeskultur
- 4.2.3.2. Einfluss des Weltbildes
- 4.2.4 Dekulturation
- 4.3 Gestaltung des Distributionskanals
- 4.3.1 Ladengestaltung
- 4.3.1.1. Gestaltung realer Einkaufsstätten
- 4.3.1.2. Gestaltung virtueller Einkaufsstätten
- 4.3.2 Sortimentspolitik
- 4.3.3 Einkaufsstättenimage
- 4.4 Gestaltung der Anreize für Handelspartner & Außendienstmitarbeiter
- 4.4.1 Verkaufsförderung als Reaktion auf die gewachsene Handelsmacht
- 4.4.2 Einfluss der Landeskultur
- 4.4.2.1. Generelle Wirkung von Anreizen
- 4.4.2.2. Kulturspezifische Einflüsse
- 4.5 Kundenmanagement
- 4.5.1 Einkaufsorientierung
- 4.5.2 Einkaufsstättentreue
- 528–576 5 Beziehungsmanagement 528–576
- 5.1 Aufgaben- vs. Beziehungsorientierung
- 5.1.1 Beziehungsorientierung nach individualistischer Art
- 5.1.2 Beziehungsorientierung nach kollektivistischer Art
- 5.1.2.1. Grundlagen von Guanxi
- 5.1.2.2. Struktur & Funktion von Guanxi
- 5.1.2.3. Wirkung von Guanxi
- 5.1.2.4. Kritische Würdigung
- 5.2 Kultursensibles Beziehungsmanagement
- 5.2.1 Kulturelle Vielfalt
- 5.2.2 Kulturschock
- 5.2.3 Interkulturelle Kompetenz
- 5.2.3.1. Grundlagen
- 5.2.3.2. Dimensionen interkultureller Kompetenz
- 5.2.3.3. Paradoxon der interkulturellen Kompetenz
- 5.2.3.4. Validierung
- 5.2.4 Multikulturelle Teams
- 5.2.4.1. Grundlagen
- 5.2.4.2. Beispiele bikultureller Teams
- 5.2.5 Interkulturelles Training
- 5.2.5.1. Grundlagen
- 5.2.5.2. Überblick
- 5.2.5.3. Trainingsformen
- 5.2.5.4. Trainingsziele
- 5.3 Beziehungsmanagement & Vertragsgestaltung
- 5.3.1 Ziel- vs. beziehungsorientierter Ansatz
- 5.3.2 Eintritt in das Netzwerk
- 5.3.3 Beziehungsaufbau
- 5.3.4 Informationsaustausch
- 5.3.5 Vertragsverhandlung
- 5.3.5.1. Einfluss von Individualismus & Kollektivismus
- 5.3.5.2. Einfluss der Akzeptanz von Machtdistanz
- 5.3.5.3. Einfluss der Tendenz zur Ungewissheitsvermeidung
- 5.3.5.4. Einfluss von Maskulinität & Feminität
- 5.3.6 Vertragsabschluss
- 577–702 Teil G Kommunikationspolitik 577–702
- 577–581 1 Bedeutung der Kommunikation im interkulturellen Kontext 577–581
- 1.1 Kommunikationsziele & Zielgruppen
- 1.2 Einfluss kulturspezifischer Wertvorstellungen
- 580–598 2 Standardisierung vs. Differenzierung 580–598
- 2.1 Ein Beispiel aus der Praxis
- 2.2 Grundzüge der Debatte
- 2.2.1 Standardisierungsthese
- 2.2.1.1. Ausgangsüberlegung
- 2.2.1.2. Abgrenzungsprobleme
- 2.2.1.3. Forschungsergebnisse
- 2.2.2 Differenzierungsthese
- 2.2.2.1. Gesetzliche Vorgaben
- 2.2.2.2. Produktlebenszyklus
- 2.2.2.3. Bedürfnisse
- 2.2.2.4. Menschenbild
- 2.2.2.5. Religiöse Überzeugungen
- 2.2.2.6. Sprache & Schrift
- 2.2.2.7. Landeskultur
- 2.2.3 Glokalisierungsthese
- 2.2.3.1. Ausgangsüberlegung
- 2.2.3.2. Beispiele aus der Praxis
- 2.3 Forschungsergebnisse
- 2.3.1 Subjektiver Ansatz
- 2.3.2 Objektiver Ansatz
- 2.3.3 Normativer Ansatz
- 598–610 3 Kommunikations-Mix 598–610
- 3.1 Struktur & Dynamik der Werbeindustrie
- 3.1.1 Gesamtbetrachtung
- 3.1.2 Differenzierte Betrachtung
- 3.1.3 Einfluss der Landeskultur
- 3.2 Verbreitung & Nutzung von Medien
- 3.2.1 Klassische Medien
- 3.2.2 Online-Medien
- 3.3 Struktur der Kommunikationsinstrumente
- 3.3.1 Dominanz von Print-Werbung & TV-Werbung
- 3.3.1.1. Paradoxon der Kommunikationspolitik
- 3.3.1.2. Internationale Unterschiede
- 3.3.2 Besonderheiten alternativer Kommunikationsinstrumente
- 3.3.3 Einfluss des kulturellen Umfeldes
- 610–655 4 Print-Werbung & TV-Werbung 610–655
- 4.1 Gesellschaftliches Umfeld
- 4.1.1 Akzeptanz von Werbung
- 4.1.1.1. Operationalisierung
- 4.1.1.2. Ursachen der Akzeptanzunterschiede
- 4.1.1.3. Konsequenzen der Akzeptanzunterschiede
- 4.1.2 Präferenz für einen bestimmten Kommunikationsstil
- 4.1.2.1. Tonalität der Ansprache
- 4.1.2.2. Aktualisiert Werte
- 4.1.2.3. Geschlechterrolle
- 4.2 Werbebotschaften
- 4.2.1 Grundlagen
- 4.2.2 Reichweite der Werbebotschaft
- 4.2.3 Kontroverse & kulturkonträre Botschaften
- 4.2.3.1. Grundlagen
- 4.2.3.2. Beispiele aus der Praxis
- 4.2.3.3. Wirkung
- 4.2.3.4. Konsequenzen für die Praxis
- 4.2.4 Informative Werbebotschaften
- 4.2.5 Emotionale Werbebotschaften
- 4.2.5.1. Humorvolle Werbebotschaften
- 4.2.5.2. Furchterregende Werbebotschaften
- 4.2.5.3. Erotische Werbebotschaften
- 4.2.6 Fremdsprachige Werbebotschaften
- 4.2.7 Absurde Werbebotschaften
- 4.2.8 Utilitaristische vs. hedonistische Werbebotschaften
- 4.3 Werbemittelgestaltung
- 655–673 5 Public Relations 655–673
- 5.1 Prinzip & Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit
- 5.1.1 Grundlagen
- 5.1.2 Manipulierbarer vs. investigativer Journalismus
- 5.1.3 Formen & Bedeutung von Öffentlichkeit
- 5.1.4 Formen moderner Öffentlichkeitsarbeit
- 5.2 Einflussnahme auf die öffentliche Meinung
- 5.2.1 Vertrauen & Misstrauen
- 5.2.2 Grundlegende Beeinflussungsstrategien im Überblick
- 5.2.3 Rolle der Medien
- 673–677 6 Verkaufsförderung 673–677
- 6.1 Prinzip & Nutzen der Verkaufsförderung
- 6.2 Nationale & interkulturelle Unterschiede
- 6.2.1 Einfluss des Rechtssystems
- 6.2.2 Akzeptanz von Verkaufsförderung
- 6.2.3 Wirkung von Verkaufsförderung
- 677–682 7 Sponsoring 677–682
- 7.1 Prinzip & Nutzen des Sponsoring
- 7.2 Abschluss eines Sponsoringvertrages im Ausland
- 7.2.1 Übersicht
- 7.2.2 Analyse der eigenen Ressourcen: „Erfahrung mit Sponsoring“ & „Vertrautheit mit dem Zielmarkt“
- 7.2.3 Analyse des Auslandsmarktes
- 7.2.4 Auswahl geeigneter Sponsornehmer
- 682–684 8 Produktplatzierung 682–684
- 8.1 Grundlagen
- 8.2 Einfluss der Landeskultur
- 684–688 9 Vergleichende Werbung 684–688
- 9.1 Grundlagen
- 9.2 Einfluss der Landeskultur
- 9.2.1 Erinnerung & Persuasion
- 9.2.2 Gewöhnung & Abnutzung
- 9.2.3 Kommunikationskontext & Selbstverständnis
- 688–693 10 Direktmarketing 688–693
- 10.1 Grundlagen
- 10.2 Nationale Unterschiede
- 10.2.1 Intensität des Direktmarketing
- 10.2.2 Hemmnisse
- 10.2.3 Wirkungen von Direktmarketing
- 693–697 11 Online-Kommunikation 693–697
- 11.1 Grundlagen
- 11.2 Akzeptanz kommerzieller Online-Kommunikation
- 11.3 Corporate Website
- 11.4 Public Relations
- 11.5 Online-Werbung
- 11.5.1 Grundlagen
- 11.5.2 Einfluss der Landeskultur
- 697–702 12 Interpersonelle Kommunikation 697–702
- 12.1 Grundlagen
- 12.2 Einfluss der Landeskultur
- 12.2.1 Traditionelles WoM
- 12.2.2 eWOM
- 703–754 Teil H Preispolitik 703–754
- 703–706 1 Bedeutung des Preises im interkulturellen Kontext 703–706
- 1.1 Interkulturelle Preispolitik vs. internationale Preispolitik
- 1.2 Einfluss von Nationalität & Landeskultur
- 705–710 2 Standardisierung vs. Differenzierung 705–710
- 2.1 Reale Marktdaten
- 2.1.1 Preisspreizung
- 2.1.2 Umfeld der Preispolitik
- 2.2 Befragungsergebnisse
- 2.2.1 Preispolitik multinationaler Unternehmen
- 2.2.2 Preispolitik von Exportunternehmen
- 2.3 Operationalisierungsprobleme
- 710–714 3 Einstellung zum Geld 710–714
- 3.1 Einfluss der Landeskultur
- 3.2 Kult des Preisvorteils
- 3.2.1 Verhalten der Kunden
- 3.2.2 Preisstrategien des Handels
- 714–720 4 Preiswahrnehmung 714–720
- 4.1 Grundlagen der Preiswahrnehmung
- 4.1.1 Monetärer vs. nicht-monetärer Preis
- 4.1.2 Preis/Qualitätswahrnehmung
- 4.2 Einfluss der Landeskultur
- 4.3 Beeinflussbarkeit der Preiswahrnehmung
- 4.3.1 Preisfigur
- 4.3.2 Preisoptik
- 720–721 5 Preiswissen 720–721
- 721–723 6 Preisbewusstsein 721–723
- 6.1 Grundlagen
- 6.2 Einfluss der Landeskultur
- 6.3 Einfluss von Konfession & Religiosität
- 723–730 7 Zahlungsbereitschaft 723–730
- 7.1 Grundlagen
- 7.2 Einfluss der Landeskultur
- 7.3 Einfluss der Konfession
- 7.4 Emotionale Nähe & Zahlungsbereitschaft
- 7.5 Wertvorstellungen & Zahlungsbereitschaft
- 7.5.1 Lebensfreude
- 7.5.2 Umweltbewusstsein
- 7.6 Zeitwahrnehmung & Zahlungsbereitschaft
- 730–740 8 Preisdurchsetzung 730–740
- 8.1 Akzeptanz von Preisänderungen
- 8.1.1 Preissteigerung
- 8.1.2 Preissenkung
- 8.2 Preisverhandlungen
- 8.2.1 Verbindlichkeit von Preisen
- 8.2.2 Verhandlungsstil
- 8.2.3 Feilschen
- 8.2.4 Kulturspezifische Vorstellungen von Fairness in Preisverhandlungen
- 8.3 Zahlungsmoral
- 740–754 9 Korruption 740–754
- 9.1 Herkunft & Bedeutungswandel des Begriffs
- 9.2 Korruption in ausgewählten Ländern
- 9.3 Korruptionsmaße
- 9.3.1 Überblick
- 9.3.2 Corruption Perception Index
- 9.3.3 Global Corruption Barometer
- 9.3.4 Bribe Payers Index
- 9.3.5 Kritische Würdigung
- 9.4 Ursachen von Korruption
- 9.4.1 Theoretische Erklärungsansätze
- 9.4.2 Befunde der empirischen Wirtschaftsforschung
- 9.4.3 Befunde der kulturvergleichenden Forschung
- 9.5 Konsequenzen von Korruption
- 9.5.1 Grundlagen
- 9.5.2 Befunde der Korruptionsforschung
- 754–769 Stichwortverzeichnis 754–769
- 769–769 Impressum 769–769