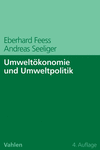Umweltökonomie und Umweltpolitik
Zusammenfassung
Umweltökonomie – neue Aspekte
Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die insbesondere die anwendungsorientierten Abschnitte betreffen. Hier wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-Nutzen-Analyse sowie die internationalen Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus enthält das Kapitel zur Ressourcenökonomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene Diskussion.
Umweltökonomie – die Schwerpunkte
- Spieltheoretische Grundlagen
- Theorie externer Effekte
- Auflagen
- Steuern und Abgaben
- Zertifikate
- Verhandlungslösungen
- Umwelthaftung
- Umwelttechnischer Fortschritt
- Internationale Aspekte des Umweltproblems
- Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Ressourcenökonomie
Zielgruppe
Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung
Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2008 Professor für Managerial Economics an der Frankfurt School of Finance and Management. Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt und der RWTH Aachen.
Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011 Volks- und Energiewirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor war er bei Frontier Economics, der Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln beschäftigt.
- 1–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–14
- 15–22 1 Einführung 15–22
- 15–18 1.1 Gegenstand und Aufgaben der Umweltökonomie 15–18
- 18–22 1.2 Überblick 18–22
- 22–48 2 Einige spieltheoretische Grundlagen der Analyse 22–48
- 22–24 2.1 Zielsetzung und Überblick 22–24
- 24–26 2.2 Eine einfache Taxonomie spieltheoretischer Entscheidungssituationen 24–26
- 26–29 2.3 Gleichgewichte in dominanten Strategien 26–29
- 29–41 2.4 Nash- Gleichgewichte 29–41
- 29–29 2.4.1 Überblick 29–29
- 29–31 2.4.2 Diskrete Entscheidungssituationen 29–31
- 31–41 2.4.3 Stetige Entscheidungssituationen und Anwendung auf die Oligopolpreisbildung 31–41
- 41–44 2.5 Dynamische Spiele und das Lösungskonzept des teilspielperfekten Gleichgewichts 41–44
- 41–43 2.5.1 Grundgedanke 41–43
- 43–44 2.5.2 Ein dynamischer Mengenwettbewerb im Oligopol 43–44
- 44–47 2.6 Bewertung von Gleichgewichten: Das Konzept der Pareto-Effizienz 44–47
- 47–48 2.7 Ausblick 47–48
- 48–69 3 Theorie externer Effekte 48–69
- 48–48 3.1 Überblick 48–48
- 48–52 3.2 Eigenschaften und Effizienzbedingungen öffentlicher Güter 48–52
- 52–54 3.3 Externe Effekte: Klassifikation und Effizienzbedingungen 52–54
- 54–57 3.4 Die Ineffizienz der Ressourcenallokation bei externen Effekten 54–57
- 57–59 3.5 Moral als Möglichkeit zur Lösung des Umweltproblems? 57–59
- 59–62 3.6 Umweltpolitische Instrumente zur Internalisierung externer Effekte: Überblick und Kriterien zur Beurteilung 59–62
- 62–69 3.7 Exkurs: Eine formalere Darstellung der Effizienzbedingungen bei externen Effekten 62–69
- 69–81 4 Auflagen 69–81
- 69–70 4.1 Grundgedanke und Überblick 69–70
- 70–72 4.2 Grundmodell der ökonomischen Analyse 70–72
- 72–73 4.3 Pareto-Effizienz 72–73
- 73–74 4.4 Ökologische Treffsicherheit 73–74
- 74–77 4.5 Kosteneffizienz 74–77
- 77–79 4.6 Das Beispiel der deutschen Luftreinhaltepolitik 77–79
- 79–81 4.7 Schlussfolgerungen 79–81
- 81–130 5 Steuern und Abgaben (Preislösungen) 81–130
- 81–82 5.1 Grundgedanken und Überblick 81–82
- 82–84 5.2 Grundmodell der ökonomischen Analyse 82–84
- 84–87 5.3 Kosteneffizienz 84–87
- 87–88 5.4 Pareto-Effizienz 87–88
- 88–89 5.5 Ökologische Treffsicherheit 88–89
- 89–94 5.6 Ein Beispiel für die Kostensenkungspotentiale durch Preislösungen: SO2-Verminderung in Westeuropa 89–94
- 94–99 5.7 Das Beispiel der Abwasserabgabe in der Bundesrepublik Deutschland 94–99
- 99–104 5.8 Von Umweltabgaben zur ökologischen Umgestaltung des Steuersystems? 99–104
- 99–100 5.8.1 Überblick 99–100
- 100–101 5.8.2 Einige Begriffsunterscheidungen 100–101
- 101–104 5.8.3 Kriterien zur Beurteilung von Steuersystemen und das Grundkonzept einer ökologischen Steuerreform 101–104
- 104–112 5.9 Probleme von Preislösungen 104–112
- 104–107 5.9.1 Die Wettbewerbssituation innovativer und nicht-innovativer Unternehmen 104–107
- 107–108 5.9.2 Internationale Konkurrenzfähigkeit I 107–108
- 108–109 5.9.3 Internationale Konkurrenzfähigkeit II 108–109
- 109–110 5.9.4 Räumliche Verlagerung von Emissionen und Immissionen 109–110
- 110–110 5.9.5 Preisaufschlag auf Produkte 110–110
- 110–112 5.9.6 Politische Durchsetzbarkeit 110–112
- 112–120 5.10 Die Ökologische Steuerreform in Deutschland 112–120
- 112–112 5.10.1 Einführung 112–112
- 112–116 5.10.2 Gesetzliche Regelungen 112–116
- 116–120 5.10.3 Politische Diskussion 116–120
- 120–128 5.11 Preislösungen bei unvollständiger Konkurrenz 120–128
- 120–122 5.11.1 Der Grundgedanke: Die Berücksichtigung von Produktionsmengen 120–122
- 122–128 5.11.2 Ein ökonomisches Grundmodell 122–128
- 128–130 5.12 Zusammenfassende Schlussfolgerungen 128–130
- 130–152 6 Zertifikate 130–152
- 130–131 6.1 Grundgedanke und Überblick 130–131
- 131–132 6.2 Erstausgabemechanismen 131–132
- 132–133 6.3 Kosteneffizienz 132–133
- 133–134 6.4 Ökologische Treffsicherheit 133–134
- 134–134 6.5 Pareto-Effizienz 134–134
- 134–140 6.6 Zertifikate in der Praxis I: Das Beispiel des US-amerikanischen Clean Air Acts (CAA) 134–140
- 134–135 6.6.1 Anwendungsbereiche 134–135
- 135–137 6.6.2 Entwicklung des gesetzlichen Regelwerks 135–137
- 137–138 6.6.3 Erstausgabe der Zertifikate 137–138
- 138–140 6.6.4 Evaluation der Maßnahmen 138–140
- 140–148 6.7 Zertifikate in der Praxis II: Das CO2-Handelssystem der EU 140–148
- 140–140 6.7.1 Überblick 140–140
- 140–144 6.7.2 Einige grundlegende Überlegungen 140–144
- 144–148 6.7.3 Der Emissionshandel in der Europäischen Union 144–148
- 148–152 6.8 Zusammenfassende Beurteilung von Zertifikaten 148–152
- 152–165 7 Verhandlungslösungen 152–165
- 152–153 7.1 Überblick 152–153
- 153–157 7.2 Das Coase-Theorem in der ursprünglichen Fassung 153–157
- 157–158 7.3 Die Coasesche Kritik der Steuerlösung 157–158
- 158–164 7.4 Integration des Coase-Theorems in die moderne Verhandlungstheorie 158–164
- 158–160 7.4.1 Grundgedanke 158–160
- 160–164 7.4.2 Verhandlungen bei vollständiger Information 160–164
- 164–165 7.5 Zusammenfassende Beurteilung des Coase-Theorems 164–165
- 165–197 8 Umwelthaftung 165–197
- 165–167 8.1 Grundgedanken der Ökonomischen Theorie des (Haftungs-)Rechts 165–167
- 167–172 8.2 Das deutsche Umwelthaftungsgesetz 167–172
- 167–170 8.2.1 Beschreibung der gesetzlichen Regelungen 167–170
- 170–172 8.2.2 Auswirkungen des Umwelthaftungsgesetzes 170–172
- 172–173 8.3 Die Unterscheidung verschiedener Kausalitätsformen als Voraussetzung der ökonomischen Analyse 172–173
- 173–178 8.4 Gefährdungs- und Verschuldenshaftung bei monokausalen Schäden 173–178
- 173–174 8.4.1 Effizienzbedingungen bei Monokausalität 173–174
- 174–174 8.4.2 Gefährdungshaftung 174–174
- 174–178 8.4.3 Verschuldenshaftung 174–178
- 178–186 8.5 Haftungsregeln bei alternativer Kausalität 178–186
- 178–178 8.5.1 Überblick 178–178
- 178–184 8.5.2 Das Umwelthaftungsgesetz bei alternativer Kausalität 178–184
- 184–186 8.5.3 Wahrscheinlichkeits- bzw. Proportionalhaftung 184–186
- 186–191 8.6 Das Problem der Multikausalität 186–191
- 186–187 8.6.1 Überblick 186–187
- 187–189 8.6.2 Dezentralisierung bei Multikausalität? 187–189
- 189–191 8.6.3 Haftungsregeln mit Verhaltensstandards 189–191
- 191–192 8.7 Zusammenfassende Beurteilung von Haftungsregeln als Instrumente der Umweltpolitik 191–192
- 192–197 8.8 Exkurs: Kritik des Verursacherprinzips 192–197
- 197–223 9 Umwelttechnischer Fortschritt (dynamische Anreizwirkungen) 197–223
- 197–200 9.1 Fragestellung und Überblick 197–200
- 200–210 9.2 Dynamische Anreizwirkungen bei vollständiger Konkurrenz 200–210
- 200–202 9.2.1 Grundlegende Annahmen und Überlegungen 200–202
- 202–203 9.2.2 Effizienzbedingungen 202–203
- 203–207 9.2.3 Ex post-effiziente Anpassung der Umweltpolitik 203–207
- 207–210 9.2.4 Keine Anpassung der Umweltpolitik 207–210
- 210–219 9.3 Einige Grundgedanken der Innovationstheorie 210–219
- 210–211 9.3.1 Überblick 210–211
- 211–214 9.3.2 Innovationsanreize im Monopol und bei vollständiger Konkurrenz 211–214
- 214–216 9.3.3 Strategische Innovationsanreize im Oligopol 214–216
- 216–218 9.3.4 Patentrennen, Nicht-Patentrennen und spillover-Effekte 216–218
- 218–219 9.3.5 Zusammenfassung 218–219
- 219–222 9.4 Umwelttechnischer Fortschritt 219–222
- 219–220 9.4.1 Grundgedanken 219–220
- 220–222 9.4.2 Umwelttechnischer Fortschritt mit spillover-Effekten: Das Modell von Xepapadeas und Katsoulacos 220–222
- 222–223 9.5 Zusammenfassende Schlussfolgerungen 222–223
- 223–280 10 Internationale Aspekte des Umweltproblems 223–280
- 223–224 10.1 Überblick 223–224
- 224–234 10.2 Die optimale internationale Differenzierung von Umwelt standards bei vollständiger Konkurrenz 224–234
- 224–228 10.2.1 Nationale Umweltprobleme 224–228
- 228–232 10.2.2 Grenzüberschreitende Umweltprobleme 228–232
- 232–234 10.2.3 Globale Umweltprobleme 232–234
- 234–242 10.3 Koordination globaler Umweltprobleme: Das Beispiel des Treibhauseffekts 234–242
- 234–238 10.3.1 Problembeschreibung 234–238
- 238–242 10.3.2 Internationale Umweltkonferenzen 238–242
- 242–269 10.4 Öko-Dumping und strategische Handelspolitik 242–269
- 242–243 10.4.1 Grundgedanke und Überblick 242–243
- 243–245 10.4.2 Das Ursprungslandprinzip im GATT 243–245
- 245–250 10.4.3 Grundlagen der strategischen Handelspolitik 245–250
- 250–260 10.4.4 Umwelt, oligopolistische Weltmärkte und strategische Handelspolitik: Grundlegende Ergebnisse 250–260
- 260–264 10.4.5 Einige Modellerweiterungen zum Öko-Dumping in oligopolistischen Weltmärkten 260–264
- 264–269 10.4.6 Zusammenfassende Schlussfolgerungen: Protektionisti sche Maßnahmen gegen Öko-Dumping? 264–269
- 269–280 10.5 Exkurs: Eine formalere Darstellung grenzüber schreitender Umweltprobleme 269–280
- 269–270 10.5.1 Einführung 269–270
- 270–273 10.5.2 Modellannahmen, Gewinn- und Nutzenmaximierung 270–273
- 273–276 10.5.3 Nicht-kooperative Lösung 273–276
- 276–280 10.5.4 Kooperative Lösung 276–280
- 280–304 11 Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung 280–304
- 280–282 11.1 Grundgedanke und Überblick 280–282
- 282–283 11.2 Formen asymmetrischer Information und ihre Bedeutung 282–283
- 283–289 11.3 Abgaben und Zertifikate unter Unsicherheit – eine einfache graphische Analyse 283–289
- 283–284 11.3.1 Überblick 283–284
- 284–285 11.3.2 Fehleinschätzung der Grenznutzenfunktion der Schadstoffvermeidung 284–285
- 285–289 11.3.3 Fehleinschätzung der Grenzkostenfunktion der Schadstoffvermeidung 285–289
- 289–297 11.4 Asymmetrische Information und das Coase-Theorem 289–297
- 289–290 11.4.1 Überblick 289–290
- 290–297 11.4.2 Asymmetrische Information und Screening im Illing-Modell 290–297
- 297–302 11.5 Umwelttechnische Innovationen bei unvollständiger Information 297–302
- 297–300 11.5.1 Fragestellung und Annahmen des Modells 297–300
- 300–302 11.5.2 Das Verhalten der Umweltbehörde 300–302
- 302–304 11.6 Ausblick 302–304
- 304–337 12 Kosten-Nutzen-Analyse 304–337
- 304–305 12.1 Überblick 304–305
- 305–311 12.2 Kosten des Umweltschutzes 305–311
- 305–309 12.2.1 Kosten durchgeführter Umweltschutzmaßnahmen 305–309
- 309–311 12.2.2 Exkurs: Die Schätzung der Kosten künftiger Umweltschutzmaßnahmen am Beispiel eines Verbots von PVC im Verpackungsbereich 309–311
- 311–332 12.3 Nutzen des Umweltschutzes 311–332
- 311–313 12.3.1 Überblick 311–313
- 313–320 12.3.2 Öko-Bilanzen 313–320
- 320–322 12.3.3 Der Folgekostenansatz als pragmatische Variante der monetären Bewertung 320–322
- 322–328 12.3.4 Der Groves-Mechanismus 322–328
- 328–331 12.3.5 Direkte Methoden der Präferenzermittlung 328–331
- 331–332 12.3.6 Indirekte Methoden der Präferenzermittlung am Beispiel des Konzepts der hedonischen Preise 331–332
- 332–337 12.4 Umweltbezogene Revision der Sozialproduktberechnung? 332–337
- 337–363 13 Ressourcenökonomie 337–363
- 337–340 13.1 Grundgedanken und Überblick 337–340
- 340–343 13.2 Optimalitätsbedingungen bei nicht-erneuerbaren Ressourcen (Hotelling-Regel) 340–343
- 343–346 13.3 Dezentralisierung der Hotelling-Regel durch vollständige Märkte 343–346
- 346–347 13.4 Berücksichtigung positiver Abbaukosten 346–347
- 347–349 13.5 Monopolistische Ressourcenbesitzer 347–349
- 349–350 13.6 Zur praktischen Relevanz des Hotelling-Models 349–350
- 350–352 13.7 Zusammenfassung 350–352
- 352–363 13.8 Exkurs: Eine etwas formalere Darstellung des Grundproblems: Die optimale Kontrolltheorie 352–363
- 352–355 13.8.1 Das Grundmodell nicht-erneuerbarer Ressourcen 352–355
- 355–357 13.8.2 Ein Beispiel für nicht-erneuerbare Ressourcen 355–357
- 357–363 13.8.3 Erneuerbare Ressourcen 357–363
- 363–381 Literaturverzeichnis 363–381
- 381–384 Sachverzeichnis 381–384
- 384–384 Impressum 384–384