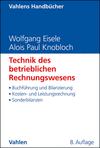Technik des betrieblichen Rechnungswesens
Buchführung und Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Sonderbilanzen
Zusammenfassung
Ein wahrer Klassiker zum betrieblichen Rechnungswesen.
"Der 'Eisele/Knobloch' gehört mit Sicherheit zum besten, was es auf dem Lehrbuchmarkt zu diesem Thema gibt."
in: Studium 90/2012
Die »Technik des betrieblichen Rechnungswesen« war und ist ein Gesamtwerk:
Es umfasst das betriebliche Rechnungswesen in der Breite ausgehend vom handels- und steuerrechtlichen Einzelabschluss und den dafür einschlägigen internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS), über die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung bis hin zu den Sonderfällen der Bilanzierung und in der Tiefe von der Auslegung der abstrakten Bilanzierungsnormen durch Rechtsprechung, Verwaltung und Schrifttum bis hin zum grundlegenden Buchungssatz.
"Das Werk vermittelt umfassendes anwendungsbezogenes Grundlagenwissen und fordert die Fähigkeit zur selbstständigen Problemlösung."
in: Controller Magazin 1/2012
"Das knapp 1.500 Seiten dicke Lehrbuch ist auch in der 8. Auflage ein Gesamtwerk: Es deckt konsequent alles ab, was man als Student wissen muss, wenn man sich auf das betriebliche Rechnungswesen spezialisiert. [...] Am bewährten didaktischen Konzept hat sich auch bei der Neuauflage nichts geändert: Durch die anwendungs- sowie praxisbezogene Wissensvermittlung wird der Leser schnell zum Profi auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens."
in: Studium 90/2012
Beste Autoren-Kompetenz
Prof. Dr. Wolfgang Eisele war Inhaber des Lehrstuhls für Rechnungswesen und Finanzierung an der Universität Hohenheim. Prof. Dr. Alois Paul Knobloch ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Finanzwirtschaft, an der Universität des Saarlandes.
- 1–22 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–22
- 23–34 Einleitung: Grundsachverhalte des betrieblichen Rechnungswesens 23–34
- 23–29 1 Der Unternehmensprozess als Abrechnungsgegenstand des betrieblichen Rechnungswesens 23–29
- 29–34 2 Aufbau, Gliederung und Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens 29–34
- Ergänzende Literatur
- 34–805 Teil A: Finanz-(Geschäfts-)Buchführung und Abschluss 34–805
- 34–62 1 Grundlagen der Buchführung 34–62
- 34–36 1.1 Wesen und Zweck der Buchführung 34–36
- 36–56 1.2 Die gesetzlichen Bestimmungen zur Buchführung 36–56
- 56–59 1.3 Fehlerhafte Buchführung und deren Rechtsfolgen 56–59
- 59–60 1.4 Mindesterfordernisse der Buchführung 59–60
- 60–62 Ergänzende Literatur 60–62
- 62–94 2 Inventur und Inventar 62–94
- 62–65 2.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 62–65
- 65–72 2.2 Inventurformen 65–72
- 72–93 2.3 Organisation und Technik der Inventur 72–93
- 93–94 Ergänzende Literatur 93–94
- 94–140 3 System und Technik der doppelten Buchführung 94–140
- 94–99 3.1 Bilanz 94–99
- 99–104 3.2 Bestandskonten 99–104
- 104–105 3.3 Eröffnungs- und Abschlusskonten 104–105
- 105–111 3.4 Eigenkapitalunterkonten 105–111
- 111–112 3.5 Gemischte Konten 111–112
- 112–119 3.6 Das Kontensystem 112–119
- 119–131 3.7 Bilanz- und Gewinn- und Verlust-Schemata von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie von Versicherungsunternehmen 119–131
- 131–139 3.8 Bilanz und Gesamterfolgsrechnung im IFRS-Abschluss 131–139
- 139–140 Ergänzende Literatur 139–140
- 140–184 4 Warenverkehr 140–184
- 140–142 4.1 Das ungeteilte (einheitliche, gemischte) Warenkonto 140–142
- 142–143 4.2 Das Wareneinkaufs- und das Warenverkaufskonto (getrenntes Warenkonto) 142–143
- 143–144 4.3 Der Warenkontenabschluss 143–144
- 144–156 4.4 Warenverkehr und Umsatzsteuer 144–156
- 156–171 4.5 Warenbezugsaufwand, Verpackungsaufwand, Einstandspreis- und Erlöskorrekturen 156–171
- 171–173 4.6 Warenentnahmen und Eigenverbrauch 171–173
- 173–174 4.7 Unfreiwillige Dezimierung von Warenvorräten 173–174
- 174–182 Übungsbeispiel 174–182
- 182–184 Ergänzende Literatur 182–184
- 184–209 5 Sonderfälle des Warenverkehrs 184–209
- 184–193 5.1 Kommissionsgeschäfte 184–193
- 193–198 5.2 Partizipationsgeschäfte 193–198
- 198–206 5.3 Das Abzahlungs-(Teilzahlungs-)Geschäft 198–206
- 206–208 5.4 Das Nachnahmegeschäft 206–208
- 208–209 Ergänzende Literatur 208–209
- 209–227 6 Wechselgeschäfte 209–227
- 209–213 6.1 Grundsachverhalte des Wechsels 209–213
- 213–216 6.2 Der Normallauf des Wechsels 213–216
- 216–220 6.3 Der Umkehrwechsel (Scheck-Wechsel-Verfahren) 216–220
- 220–221 6.4 Die Wechselprolongation 220–221
- 221–222 6.5 Wechselprotest und Rückgriff 221–222
- 222–223 6.6 Wechselbilanzierung und Wechselobligo 222–223
- 223–226 Übungsbeispiel 223–226
- 226–227 Ergänzende Literatur 226–227
- 227–337 7 Wertpapiere und Finanzinnovationen 227–337
- 227–252 7.1 Die Verbuchung von Wertpapieren 227–252
- 252–318 7.2 Die Verbuchung von Finanzinnovationen 252–318
- 318–337 7.3 Finanzinstrumente nach den IFRS 318–337
- 337–375 8 Personalaufwand 337–375
- 337–348 8.1 Grundsachverhalte der Arbeitsentlohnung 337–348
- 348–350 8.2 Die Lohn- und Gehaltsverbuchung 348–350
- 350–357 8.3 Die Behandlung von Sachbezügen 350–357
- 357–359 8.4 Vorschüsse und Abschlagszahlungen 357–359
- 359–369 8.5 Bilanzierung von Stock Options 359–369
- 369–374 8.6 Anteilsbasierte Vergütungen nach den IFRS 369–374
- 374–375 Ergänzende Literatur 374–375
- 375–386 9 Steuern und Zuwendungen 375–386
- 375–381 9.1 Steueraufwand 375–381
- 381–382 9.2 Bestehende Steuerschulden und Steuererstattungsansprüche nach den IFRS 381–382
- 382–385 9.3 Zuwendungen 382–385
- 385–386 Ergänzende Literatur 385–386
- 386–415 10 Leasing 386–415
- 386–394 10.1 Bilanzielle Zurechnungskriterien 386–394
- 394–403 10.2 Buchungstechnik 394–403
- 403–414 10.3 Leasing nach den IFRS 403–414
- 414–415 Ergänzende Literatur 414–415
- 415–448 11 Materialwirtschaft 415–448
- 415–419 11.1 Beschaffung, Verbrauch, Bestandsveränderungen und Verkauf 415–419
- 419–443 11.2 Bestands- und Verbrauchsbewertung 419–443
- 443–447 11.3 Behandlung von Vorräten nach den IFRS 443–447
- 447–448 Ergänzende Literatur 447–448
- 448–478 12 Anlagenwirtschaft 448–478
- 448–454 12.1 Gegenstand, Bewertung, Kauf, Abgang 448–454
- 454–470 12.2 Abschreibung von Anlagen 454–470
- 470–477 12.3 Sachanlagen und immaterielles Vermögen nach den IFRS 470–477
- 477–478 Ergänzende Literatur 477–478
- 478–609 13 Vorbereitender Abschluss und Abschlussübersicht 478–609
- 478–480 13.1 Die Behandlung von Wertdifferenzen 478–480
- 480–503 13.2 Die Verbuchung der Abschreibungen 480–503
- 503–512 13.3 Die Verbuchung von Zuschreibungen (Wertaufholungen) 503–512
- 512–517 13.4 Abschreibungen und Zuschreibungen nach den IFRS 512–517
- 517–520 13.5 Der Anlagespiegel 517–520
- 520–532 13.6 Rechnungsabgrenzung 520–532
- 532–568 13.7 Rückstellungen und steuerfreie Rücklagen 532–568
- 568–571 13.8 Verbindlichkeiten 568–571
- 571–591 13.9 Latente Steuern 571–591
- 591–595 13.10 Korrektur von Erfolgskonten 591–595
- 595–609 13.11 Der Abschluss 595–609
- 609–665 14 Erfolgsverbuchung und Rechtsform 609–665
- 609–610 14.1 Generelle Regelung 609–610
- 610–635 14.2 Die Erfolgsverbuchung bei der Einzelunternehmung und bei Personengesellschaften 610–635
- 635–664 14.3 Die Erfolgsverbuchung bei Kapitalgesellschaften 635–664
- 664–665 Ergänzende Literatur 664–665
- 665–754 15 Organisation der Buchführung 665–754
- 665–668 15.1 Historische Entwicklung der Buchführungsformen und Buchführungstechniken 665–668
- 668–674 15.2 Bestandteile der Buchführung 668–674
- 674–676 15.3 Systeme der Buchführung 674–676
- 676–685 15.4 Formen der Buchführung 676–685
- 685–737 15.5 Techniken der Buchführung 685–737
- 737–753 15.6 Kontenrahmen und Kontenpläne 737–753
- 753–754 Ergänzende Literatur 753–754
- 754–765 16 Organisatorische Verbindung von Geschäfts- und Betriebsbuchführung 754–765
- 754–755 16.1 Einkreissysteme 754–755
- 755–760 16.2 Zweikreissysteme 755–760
- 760–765 Übungsbeispiel 760–765
- 765–765 Ergänzende Literatur 765–765
- 765–805 Anlage zu Teil A: 765–805
- 765–771 Übungsaufgabe 1: Buchung Kommissionsgeschäft 765–771
- 771–773 Übungsaufgabe 2: Buchung Metageschäft 771–773
- 773–779 Übungsaufgabe 3: Filialbuchführung 773–779
- 779–783 Übungsaufgabe 4: Buchung auf Hauptbuchkonten (T-Konten) 779–783
- 783–789 Übungsaufgabe 5: Buchung auf Abschlussübersicht (OHG) 783–789
- 789–805 Übungsaufgabe 6: Buchung auf Abschlussübersicht (KG) 789–805
- 805–1028 Teil B: Kosten- und Leistungsrechnung 805–1028
- 805–808 1 Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung 805–808
- 808–818 2 Definitorische Grundlagen 808–818
- 808–810 2.1 Kosten und Leistungen 808–810
- 810–814 2.2 Rechnungstechnische Abgrenzungen 810–814
- 814–817 2.3 Formale Struktur der Kostenrechnung 814–817
- 817–818 Ergänzende Literatur 817–818
- 818–910 3 Kostenrechnung auf Vollkostenbasis 818–910
- 818–845 3.1 Kostenartenrechnung 818–845
- 845–888 3.2 Kostenstellenrechnung 845–888
- 888–910 3.3 Kostenträgerrechnung 888–910
- 910–939 4 Kostenrechnung auf Teilkostenbasis (Deckungsbeitrags rechnung) 910–939
- 910–913 4.1 Mängel der traditionellen Vollkostenrechnung 910–913
- 913–918 4.2 Das Problem der Kostenauflösung 913–918
- 918–938 4.3 Teilkostenrechnungssysteme 918–938
- 938–939 Ergänzende Literatur 938–939
- 939–947 5 Normalkostenrechnung 939–947
- 939–941 5.1 Normalisierte Verrechnungssätze 939–941
- 941–944 5.2 Starre und flexible Normalkostenrechnung 941–944
- 944–946 Übungsbeispiel 944–946
- 946–947 Ergänzende Literatur 946–947
- 947–956 6 Plankostenrechnung 947–956
- 947–950 6.1 Starre Plankostenrechnung 947–950
- 950–952 6.2 Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 950–952
- 952–954 6.3 Flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis (Grenzplankostenrechnung) 952–954
- 954–955 Übungsbeispiel 954–955
- 955–956 Ergänzende Literatur 955–956
- 956–1000 7 Strategische Erweiterung der Kostenrechnung 956–1000
- 956–957 7.1 Rahmenbedingungen 956–957
- 957–959 7.2 Neuorientierung der Kostenrechnung 957–959
- 959–973 7.3 Prozesskostenrechnung 959–973
- 973–984 7.4 Zielkostenmanagement (Target Costing) 973–984
- 984–990 7.5 Lebenszyklusrechnung 984–990
- 990–1000 7.6 Umweltorientierte Kostenrechnung 990–1000
- 1000–1006 8 Leistungsrechnung 1000–1006
- 1000–1000 8.1 Grundlagen 1000–1000
- 1000–1002 8.2 Innerbetriebliche Leistungsrechnung und Bestandsrechnung 1000–1002
- 1002–1004 8.3 Erlösrechnung 1002–1004
- 1004–1005 Übungsbeispiel 1004–1005
- 1005–1006 Ergänzende Literatur 1005–1006
- 1006–1028 9 Kurzfristige Erfolgsrechnung 1006–1028
- 1006–1021 9.1 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren in der Kostenrechnung 1006–1021
- 1021–1023 9.2 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren nach Handelsrecht 1021–1023
- 1023–1026 9.3 Harmonisierung von interner und externer Erfolgsrechnung 1023–1026
- 1026–1026 Ergänzende Literatur 1026–1026
- 1026–1028 Symbolverzeichnis Teil B 1026–1028
- 1028–1321 Teil C: Sonderbilanzen 1028–1321
- 1028–1032 1 Systematik der Sonderbilanzen 1028–1032
- 1032–1246 2 Sonderbilanzen zur Unternehmensfortführung 1032–1246
- 1032–1074 2.1 Gründungsbilanzen 1032–1074
- 1074–1186 2.2 Umwandlungsbilanzen 1074–1186
- 1186–1246 2.3 Sanierungsbilanzen 1186–1246
- 1246–1321 3 Sonderbilanzen zur Unternehmensauflösung 1246–1321
- 1246–1288 3.1 Liquidationsbilanzen 1246–1288
- 1288–1321 3.2 Sonderbilanzen nach dem Insolvenzrecht 1288–1321
- 1321–1386 Anhang: Kontenrahmen 1321–1386
- 1321–1326 A.1 Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie (GKR) 1321–1326
- 1326–1330 A.2 Kontenrahmen des Groß- und Außenhandels 1326–1330
- 1330–1334 A.3 Einzelhandelskontenrahmen (EKR) 1330–1334
- 1334–1340 A.4 Industrie-Kontenrahmen (IKR) 1334–1340
- 1340–1363 A.5 DATEV-Kontenrahmen SKR 03 1340–1363
- 1363–1386 A.6 DATEV-Kontenrahmen SKR 04 1363–1386
- 1386–1397 Abkürzungsverzeichnis 1386–1397
- 1397–1432 Literaturverzeichnis 1397–1432
- 1432–1437 Urteile und Erlasse 1432–1437
- 1437–1456 Stichwortverzeichnis 1437–1456
- 1456–1456 Impressum 1456–1456